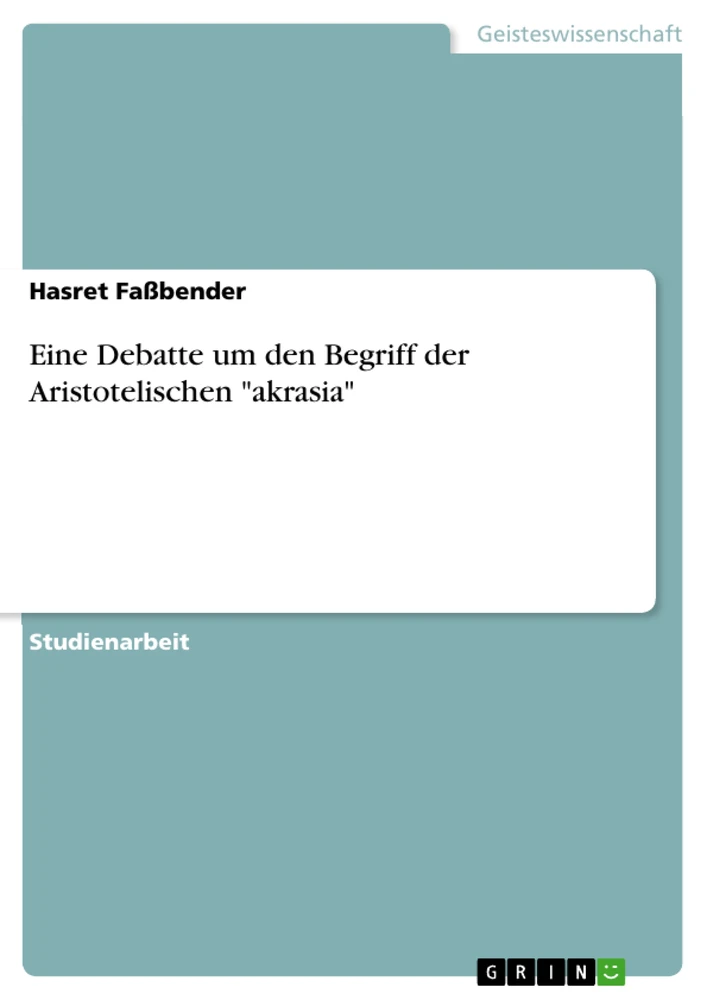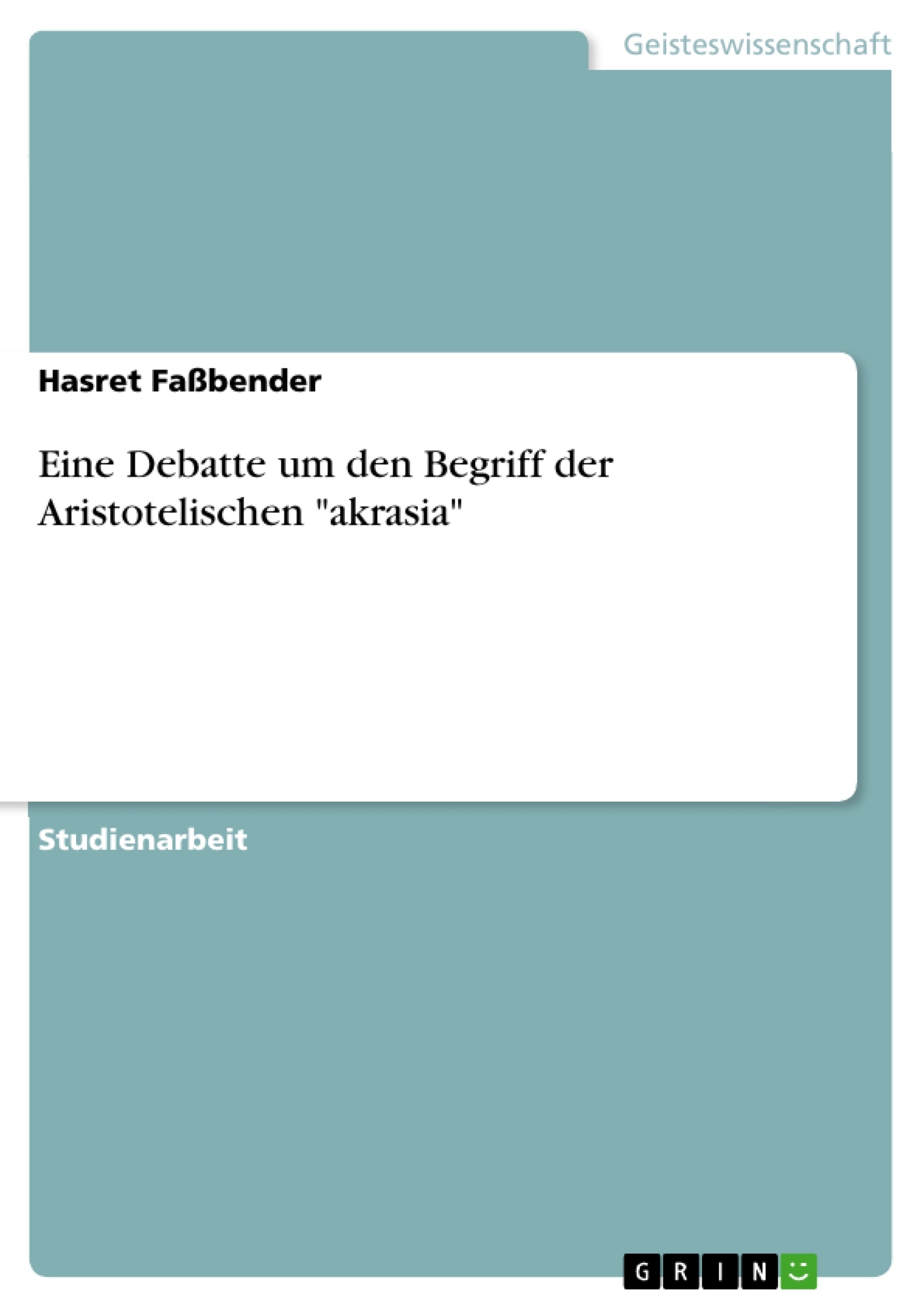Der Mensch handelt. Dies ist der thematische Fokus der Anthropologie. In der philosophischen Tradition ist seit Anbeginn darüber nachgedacht worden, wie sich dieser Umstand, in eine Theorie einbetten lässt, die den Menschen in einem umfassenderen Sinne als „Person“, „moral agent“ oder „Subjekt“ denkt. Ziel war es eine Vorstellung von der Art und Weise zu gewinnen, wie Menschen handeln. Ausgehend von den rationalistischen Tendenzen der Aufklärung wurde das „Handeln aus Gründen“ mehr und mehr zum Mittelpunkt der Überlegungen. Ebenso finden, die aus der an-gelsächsisch-empiristischen Tradition entlehnten Bestimmungen über „desire“ und „belief“ Eingang in den Diskurs. Mit neuesten Denkströmungen könnte man sich sogar fragen, ob es möglich ist, dass Gefühle Gründe sein können, die zum Handeln motivieren. Neben den klassischen Programmen hat sich die Moderne vor allem auf sprachphilosophische und logische Voraussetzungen von Handlungen konzentriert.
In diesem weiten Feld philosophischer, soziologischer und psychologischer Untersuchungen fällt auf, dass ein alltagssprachlich durchaus gebräuchlicher und verbreiteter Begriff wie „Willensschwäche“ sich einer ad hoc Definition entzieht. Dieser Begriff scheint, obwohl er in lebensweltlichen Zusammenhängen prima facie über beeindruckendes Erklärungspotential verfügt, nicht zu greifen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, in systematisch-kritischer Absicht den „Nebel“ um den Begriff der „Willensschwäche“ etwas zu lichten und zwei Evaluierungen des von Aristoteles geprägten Begriffs der akrasia vorzustellen. Zu diesem Zweck dienen die klassisch-traditionellen Positionen Platons und Aristoteles als Ausgangspunkt, um anschließend mit Jens Timmermann und Ursula Wolf – zwei modernen Philosophen – das Phänomen zu erörtern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzept der Willensschwäche in der Platonischen und Aristotelischen Tradition
- Die Platonische Tradition
- Die Aristotelische Tradition
- Die Explikation der Aristotelischen akrasia nach Jens Timmermann und Ursula Wolf
- Die akrasia nach Jens Timmermann
- Die akrasia nach Ursula Wolf
- Schlussbemerkung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Begriff der Willensschwäche und beleuchtet, wie er in der philosophischen Tradition verstanden und diskutiert wird. Der Fokus liegt dabei auf der Aristotelischen akrasia, die im Kontext der Platonischen Tradition betrachtet wird. Die Arbeit analysiert zwei moderne Interpretationen des Begriffs durch Jens Timmermann und Ursula Wolf.
- Die philosophische Tradition der Willensschwäche
- Die Aristotelische akrasia
- Moderne Interpretationen der akrasia
- Die Bedeutung von Wissen und Einsicht für die Handlung
- Die Rolle von Gefühlen und Antrieben bei der Handlungsentscheidung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Willensschwäche ein und erläutert, wie es in der Philosophie, Soziologie und Psychologie behandelt wird. Sie stellt die Frage nach der Definition von Willensschwäche und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, den Begriff der akrasia genauer zu beleuchten.
Das Konzept der Willensschwäche in der Platonischen und Aristotelischen Tradition
Dieses Kapitel untersucht das Konzept der Willensschwäche in der antiken Philosophie. Es beleuchtet die Platonische Tradition und erklärt, wie Sokrates/Platon akrasia verstehen. Anschließend wird die Aristotelische Tradition behandelt, die eine flexiblere Sichtweise auf die Seelenordnung und die ethische Konzeption des Stagiriten aufzeigt.
Die Explikation der Aristotelischen akrasia nach Jens Timmermann und Ursula Wolf
Dieses Kapitel präsentiert die moderne Interpretation der Aristotelischen akrasia durch Jens Timmermann und Ursula Wolf. Es vergleicht und analysiert die Ansätze beider Philosophen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Konzepte der Willensschwäche, der akrasia, der Platonischen und Aristotelischen Tradition, der Vernunft und der Handlungstheorie. Die Arbeit behandelt die Rolle von Wissen und Einsicht sowie die Bedeutung von Gefühlen und Antrieben bei der Handlungsentscheidung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „akrasia“?
Akrasia wird meist als „Willensschwäche“ oder „Handeln wider besseres Wissen“ übersetzt.
Wie unterscheidet sich Aristoteles' Sicht auf akrasia von Platon?
Während Platon (Sokrates) glaubt, dass niemand wissentlich falsch handelt, gesteht Aristoteles ein, dass man trotz theoretischen Wissens durch Affekte fehlgeleitet werden kann.
Welche modernen Philosophen werden in dieser Arbeit analysiert?
Die Arbeit stellt die Interpretationen von Jens Timmermann und Ursula Wolf vor.
Können Gefühle Gründe für Handlungen sein?
Ja, die Arbeit untersucht, inwieweit Gefühle und Antriebe als motivierende Gründe in die Handlungstheorie integriert werden können.
Warum ist Willensschwäche ein Problem für die Anthropologie?
Weil sie das Bild des Menschen als rein rational handelndes Subjekt in Frage stellt und die Komplexität menschlicher Entscheidungsprozesse aufzeigt.
- Quote paper
- Hasret Faßbender (Author), 2003, Eine Debatte um den Begriff der Aristotelischen "akrasia", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187739