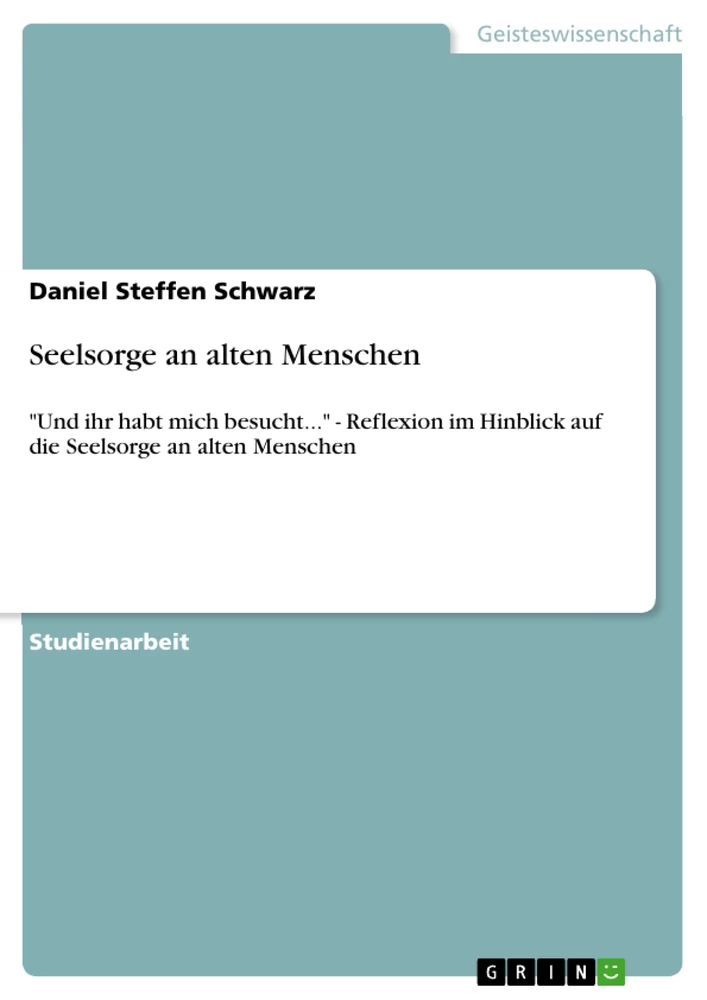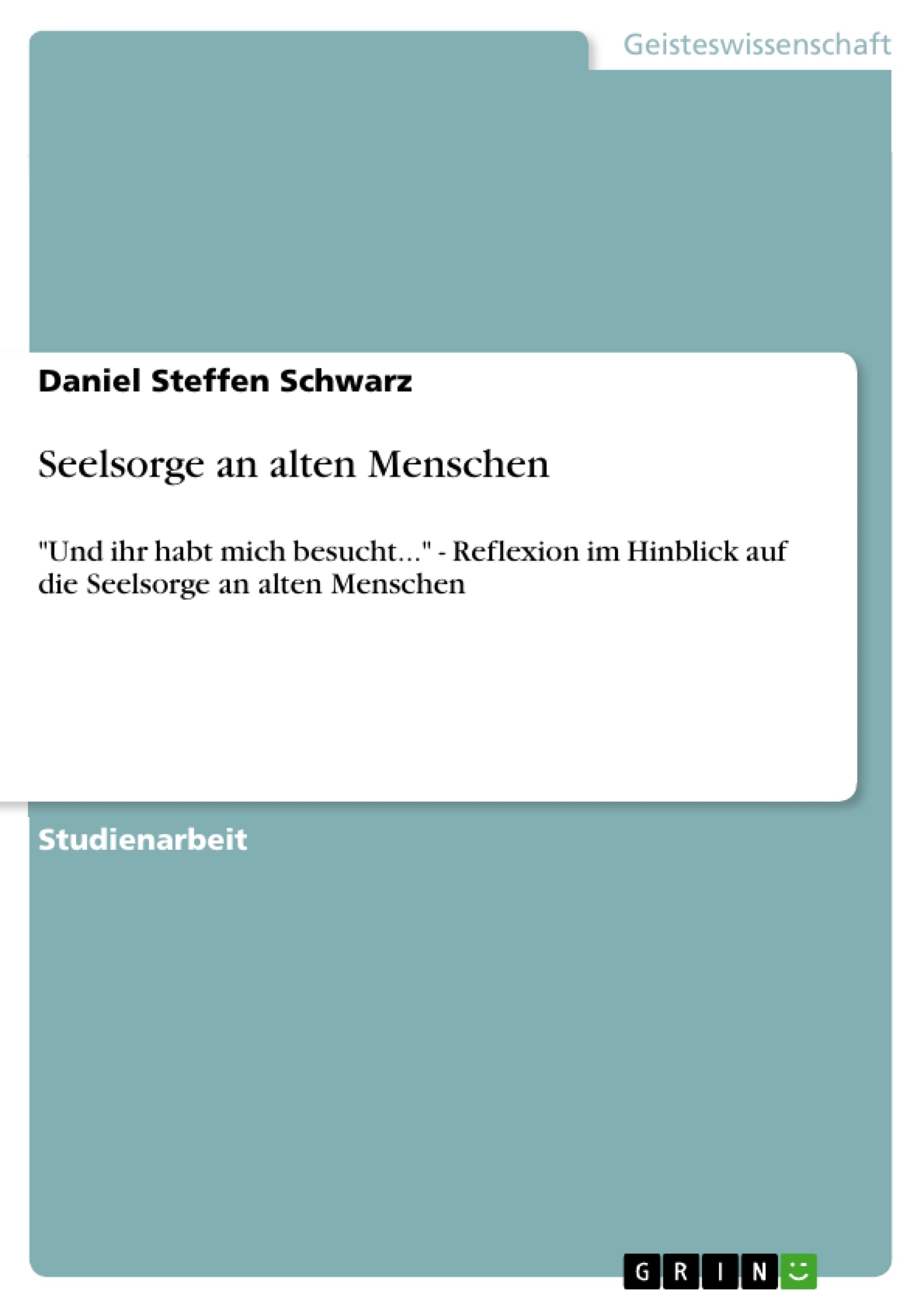Die Untersuchung reflektiert das Seelsorgeverständnis unter besonderer Berücksichtigung der Seelsorge an alten Menschen. Danach wird die seelsorgerliche Praxis des Autors dokumentiert und ausgewertet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reflexion des eigenen Seelsorgeverständnis
- Biblisch-theologische Erörterung zum Wesen der Seelsorge an alten Menschen
- Reflexion meiner Rolle als Seelsorger
- Besonderheiten des Lebens alter Menschen
- Vorschläge für die Praxis der Seelsorge an alten Menschen
- Die Praxis meines Seelsorgeprojektes
- Kontext des Projektes
- Eine Seelsorgebeziehung bahnt sich an
- Der 1. Besuch: Mitsein am Altenbett
- Der 2. Besuch: „,,Sie sind immer so lieb zu mir“
- Der 3. Besuch: „Mein Sohn ist wieder da"
- Auswertung des Seelsorgeprojektes
- Bibliographie
- Fachliteratur
- Quellen aus dem Internet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Seelsorge an alten Menschen und untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten dieser Form der pastoralen Begleitung. Sie basiert auf einem konkreten Seelsorgeprojekt, das im Rahmen der Vikarsausbildung durchgeführt wurde.
- Biblisch-theologische Fundierung der Seelsorge
- Reflexion der Rolle des Seelsorgers
- Besonderheiten des Lebens alter Menschen
- Methoden der seelsorgerlichen Begegnung
- Praxisbeispiele aus dem Seelsorgeprojekt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die demographische Entwicklung und die Bedeutung der Seelsorge an alten Menschen in den Vordergrund. Sie erläutert die Motivation des Autors, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und die These der Arbeit zu formulieren.
Das erste Kapitel befasst sich mit der biblisch-theologischen Erörterung des Wesens der Seelsorge. Es wird die Sorge Gottes um den Menschen als Grundlage der Seelsorge herausgestellt und die Bedeutung der Liebe, des Erbarmens und der Menschenwürde betont.
Das zweite Kapitel beschreibt das konkrete Seelsorgeprojekt. Es werden die Rahmenbedingungen des Projektes, die seelsorgerlichen Begegnungen mit der Gesprächspartnerin Frau B und die Auszüge aus Verbatim vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Seelsorge an alten Menschen, die biblisch-theologische Fundierung der Seelsorge, die Rolle des Seelsorgers, die Besonderheiten des Lebens alter Menschen, die Methoden der seelsorgerlichen Begegnung und die Praxisbeispiele aus dem Seelsorgeprojekt.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Besonderheiten der Seelsorge an alten Menschen?
Sie erfordert ein tiefes Verständnis für die Lebenssituation im Alter, Themen wie Einsamkeit, Krankheit und die Vorbereitung auf das Lebensende.
Was ist die biblisch-theologische Grundlage der Seelsorge?
Die Grundlage ist die Sorge Gottes um den Menschen, die durch Liebe, Erbarmen und die Anerkennung der Menschenwürde zum Ausdruck kommt.
Welche Rolle nimmt der Seelsorger ein?
Der Seelsorger ist ein Begleiter, der durch "Mitsein" und aktives Zuhören eine vertrauensvolle Beziehung aufbaut.
Was ist ein "Verbatim" in der Seelsorgeausbildung?
Es ist ein Wortprotokoll eines Seelsorgegesprächs, das zur Reflexion und Auswertung der eigenen pastoralen Praxis dient.
Warum ist dieses Thema angesichts der demographischen Entwicklung wichtig?
Da die Zahl älterer Menschen steigt, wächst auch der Bedarf an qualifizierter kirchlicher Begleitung in Heimen und im privaten Umfeld.
- Arbeit zitieren
- Daniel Steffen Schwarz (Autor:in), 2011, Seelsorge an alten Menschen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187794