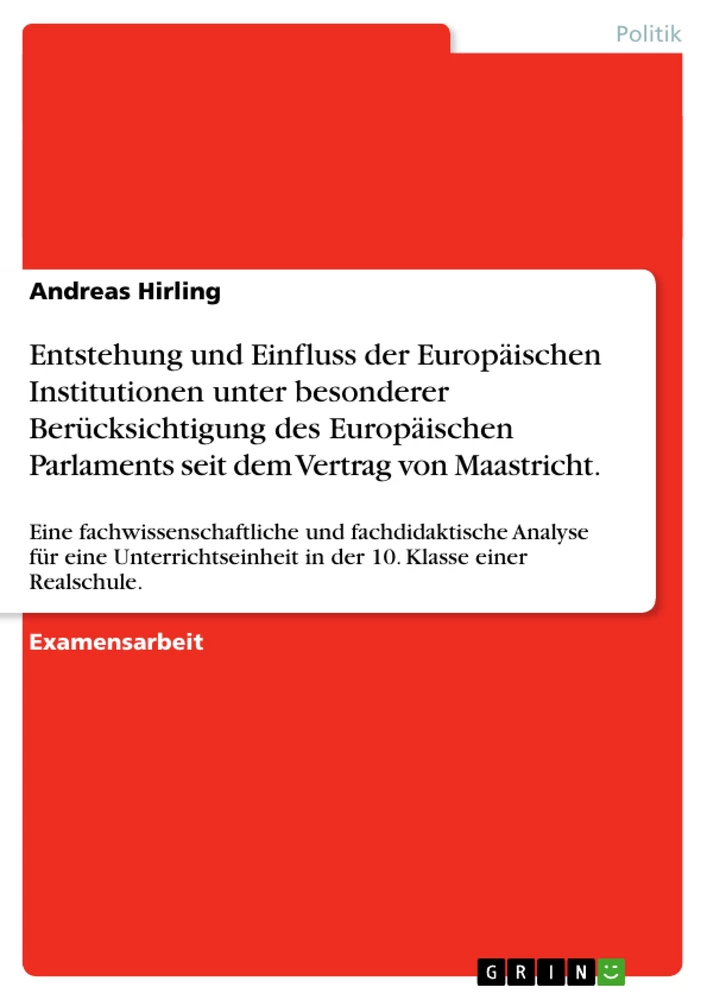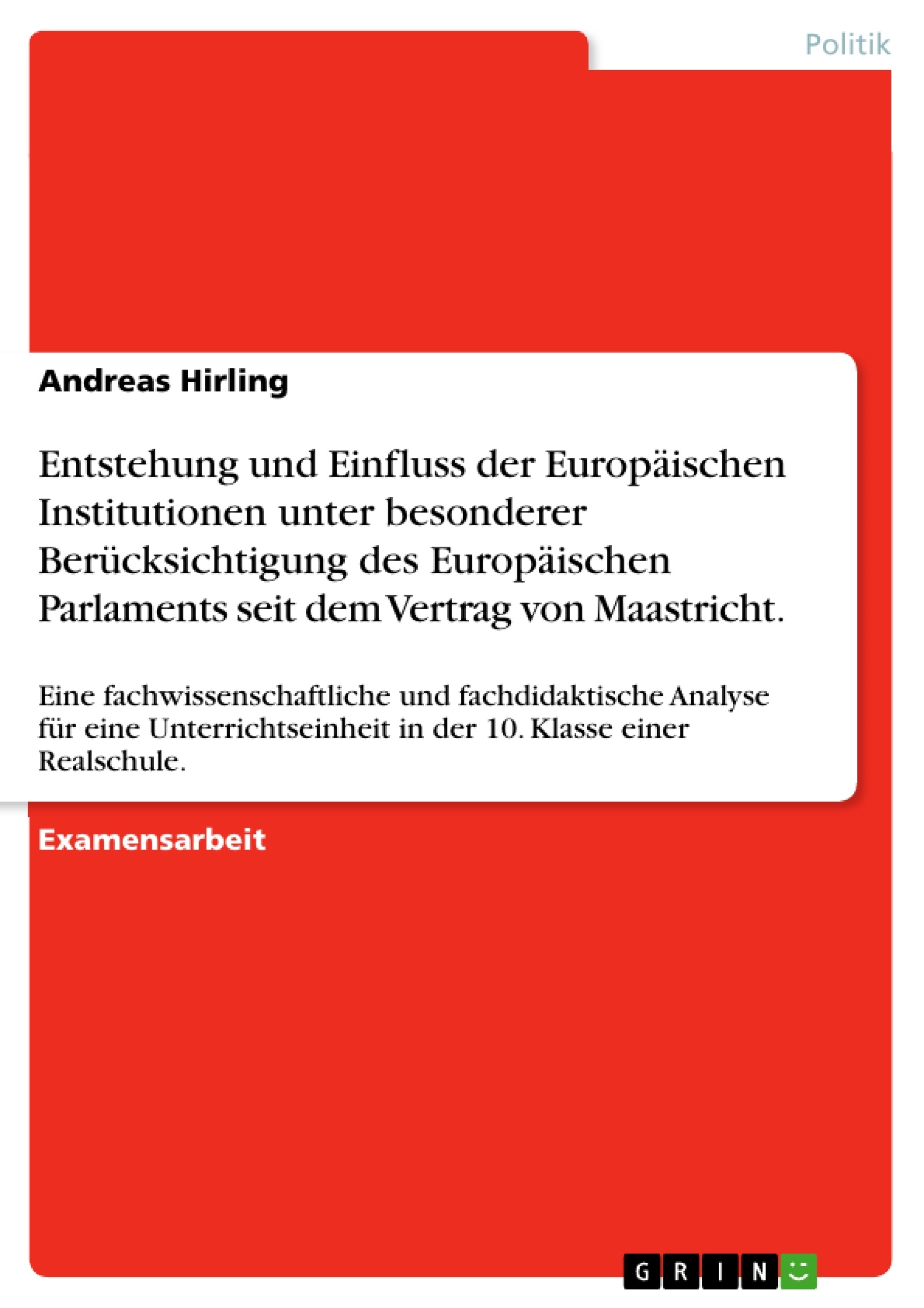„Das EU-Debakel in Frankreich und den Niederlanden stürzt die Europäische Union in ihre wohl tiefste Krise“ , so beurteilt der Spiegel die gescheiterten Referenden vom 29. Mai (Frankreich) und 1. Juni 2005 (Niederlande). Innerhalb von 72 Stunden habe sich das Szenarium in Europa verfinstert; zu diesem Fazit gelangt die Madrider Zeitung „ABC“. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass der Prozess der nun schon seit über 50 Jahren andauernden Europäischen Integration noch längst nicht abgeschlossen ist, im Gegenteil: noch nie schien der Reformdruck auf die Europäische Union so groß zu sein wie heute.
Die Anforderungen, denen die EU gerade heute entgegentreten muss, sind besonders in den letzten Jahren stetig gewachsen.
Daneben besteht die Frage nach ihrer künftigen internationalen Rolle neben anderen weltpolitischen Akteuren wie z.B. den USA oder China. Des Weiteren sucht man nach Wegen einer grundlegenden Reformierung ihres institutionellen Systems, um sowohl die ökonomische als auch die politische Stabilität der EU künftig zu sichern. Die Erarbeitung eines europäischen Verfassungsentwurfs war der letzte Versuch längst überfällige Reformvorhaben zu realisieren.
EU gerecht? Wie geht es nun nach den beiden gescheiterten Referenden weiter? Die Besonderheiten und Defizite „europäischen Regierens“ werden in dieser Arbeit anhand der wesentlich beteiligten Institutionen herausgestellt. Wie wirken diese bei zentralen Entscheidungs- und Rechtsetzungsprozessen zusammen, welche Bedeutung haben sie innerhalb des institutionellen Systems der EU und wo liegen die Unterschiede im Vergleich zu denen nationaler Staaten? Mit der Bedeutung des Europäischen Parlaments im politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess, möchte ich mich dabei in ausführlicherer Form auseinandersetzen.
In einem sich anschließenden didaktischen Teil möchte ich verschiedene inhaltliche sowie methodische Überlegungen zum Thema „Europa/ Europäische Union im Unterricht“ anstellen und die Bedeutung eines „europazentrierten“ Politikunterrichts anhand verschiedener Gesichtspunkte näher erörtern.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das Institutionelle System der Europäischen Union
- 1. „Institutionen“: Begriffsbestimmung und Bedeutung für politische Gemeinwesen
- 2. Zwischen Intergouvernementalismus und Supranationalismus: Die EU in einer institutionellen „Gratwanderung“
- 3. Die Europäische Union: Ein Mehrebenensystem der besonderen Art
- 4. Die Organe der Europäischen Union: Ein erster Überblick
- III. Die Organe innerhalb des „institutionellen Dreiecks“ der EU: Parlament, Kommission und Rat der EU
- 1. Die Europäische Kommission
- 1.1 Stellung der Kommission im Institutionensystem der EU
- 1.2 Das Verfahren zur Neubesetzung der Kommission
- 1.2.1 Vertragliche Regelungen
- 1.2.2 Der Kommissionspräsident: Ein Amt von zentraler Bedeutung
- 1.2.3 Weitreichende Einflussmöglichkeiten des Parlaments
- 1.3 Die Binnenstruktur der Kommission
- 1.3.1 Zusammensetzung/ Interne Organisation
- 1.3.2 Arbeitsformen
- 1.3.3 Kommissare, Generaldirektionen und Kabinette: Ein Spannungsfeld?
- 1.4 Die „neue Kommission“ – Der Vertrag von Nizza und weitere Reformperspektiven
- 2. Der Rat der EU/ Ministerrat
- 2.1 Die Stellung des Rates im Institutionensystem der EU
- 2.2 Die Binnenstruktur des Rates
- 2.2.1 Zusammensetzung
- 2.2.2 Interne Organisation/ Arbeitsweise
- 2.3 Das Problem bei Stimmengewichtung und Abstimmungsmodalitäten im Rat: Ein Dauerthema?
- 2.3.1 Abstimmungsmodalitäten und Mehrheitsfindung vor „Nizza“
- 2.3.2 Die Änderungen durch den Vertrag von Nizza
- 2.4 Zentrale politische Aufgaben
- 2.4.1 Aufgaben im Überblick
- 2.4.2 Legislativ- und Exekutivaufgaben: Der Rat in einer nicht unproblematischen Rolle
- 2.4.3 Ernennungs- und Kontrollmöglichkeiten
- 3. Das Europäische Parlament
- 3.1 Stellung und Bedeutung des Parlaments im Institutionensystem der EU
- 3.2 Die Binnenstruktur des Parlaments
- 3.2.1 Mandatszuweisung und Sitzverteilung
- 3.2.2 Interne Organisation/ Arbeitsweise
- 3.3 Aufgaben und Einfluss des Europäischen Parlaments anhand zentraler Rechtsetzungs- und Entscheidungsprozesse innerhalb der EG/EU
- 3.3.1 Grundlegendes
- 3.3.2 Übersicht über Aufgaben und Befugnisse des EP
- a) Beratungsbefugnis
- b) Mitwirkung an der Rechtsetzung
- c) Kontrolle
- d) Wahl/ Ernennungen
- 3.3.3 Die legislative Funktion des EP: Das Mitentscheidungsverfahren
- 3.3.4 Der EU-Haushalt und die Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten des EP
- a) Grundlegendes zum EU-Haushalt
- b) Das EU-Haushalts-Verfahren
- c) EU-Haushalt: Der Einfluss des EP bleibt begrenzt
- 3.3.5 Weitere Möglichkeiten parlamentarischer Mitwirkung und Kontrolle
- a) Gegenüber der Kommission
- b) Gegenüber dem Rat der EU
- c) Fazit
- 3.4 Die Wahlen zum Europäischen Parlament
- 3.4.1 Die Wahlen zum EP als wissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand
- 3.4.2 Die heterogenen Wahlsysteme der Mitgliedsstaaten
- 3.4.3 Europawahlen: Wahlen ohne Bedeutung?
- IV. EU-Verfassung: Die Zukunft der Europäischen Union und ihrer Institutionen
- 1. Die Notwendigkeit einer Europäischen Verfassung
- 2. Die (institutionellen) Änderungen durch den EU-Verfassungsentwurf
- 2.1 Die Schaffung neuer Organe: Der Präsident des Europäischen Rates und der Außenminister der EU
- 2.2 Das europäische Parlament - politisch aufgewertet?
- 2.3 Die Europäische Kommission
- 3. Der EU-Verfassungsentwurf: Fortschritt für den weiteren Integrationsprozess?
- 4. Exkurs: Scheitert das „Europäische Verfassungsprojekt“? Europas Zukunft bleibt nach wie vor ungewiss.
- V. Europa im Unterricht: Methodisch-didaktische Überlegungen für einen europazentrierten Politikunterricht
- 1. Thema „Europa“: Kontroversen und neue Ansätze in der politischen Bildung
- 2. „Europa“ im (neuen) Bildungsplan der Realschule
- 3. Die Komplexität der Europäischen Union und ihrer Institutionen: Eine Herausforderung für den Unterricht
- 4. Unterrichtspraxis: Anregungen zu Inhalt und Methodik
- VI. Abschließende Überlegungen
- Institutionelle Entwicklung der Europäischen Union seit Maastricht
- Zusammenspiel von Europäischem Parlament, Rat und Kommission
- Herausforderungen des europäischen Integrationsprozesses
- Demokratiedefizit der EU
- Didaktische Konzepte für den Politikunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Entstehung und den Einfluss europäischer Institutionen, insbesondere des Europäischen Parlaments, seit dem Vertrag von Maastricht. Sie untersucht die institutionelle Struktur der EU, die Rolle der wichtigsten Organe im Entscheidungsprozess, und die Herausforderungen des europäischen Integrationsprozesses. Die fachdidaktische Analyse zielt darauf ab, eine geeignete Unterrichtseinheit für die 10. Klasse einer Realschule zu entwickeln.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die aktuelle Krise der EU und die Notwendigkeit von Reformen. Kapitel II untersucht das institutionelle System der EU, die Gratwanderung zwischen Intergouvernementalismus und Supranationalismus, und das Mehrebenensystem der EU. Kapitel III analysiert detailliert die Europäischen Kommission, den Rat der EU, und das Europäische Parlament als zentrale Organe. Es werden deren interne Strukturen, Arbeitsweisen und die Beteiligung an zentralen Entscheidungsprozessen untersucht. Kapitel IV beleuchtet den EU-Verfassungsentwurf und seine vorgesehenen institutionellen Änderungen.
Schlüsselwörter
Europäische Union, Europäische Institutionen, Europäisches Parlament, Rat der EU, Europäische Kommission, Vertrag von Maastricht, europäische Integration, supranational, intergouvernemental, Demokratiedefizit, EU-Verfassung, Politikunterricht, Didaktik.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Zeitraum deckt die Analyse der EU-Institutionen ab?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung seit dem Vertrag von Maastricht und berücksichtigt Ereignisse bis zum EU-Verfassungsentwurf 2005.
Was ist das "institutionelle Dreieck" der EU?
Es besteht aus dem Europäischen Parlament, dem Rat der EU (Ministerrat) und der Europäischen Kommission.
Welche Rolle spielt das Europäische Parlament im Entscheidungsprozess?
Die Arbeit untersucht die legislative Funktion des EP, insbesondere das Mitentscheidungsverfahren sowie seine Kontrollrechte gegenüber der Kommission.
Was versteht man unter dem "Demokratiedefizit" der EU?
Es beschreibt die Kritik an den Defiziten der demokratischen Legitimation und Beteiligung innerhalb der Entscheidungsprozesse der EU.
Wie wird das Thema "Europa" im Unterricht behandelt?
Die Arbeit bietet didaktische Überlegungen für einen europazentrierten Politikunterricht, speziell für die 10. Klasse der Realschule.
Welche Bedeutung hatte der Vertrag von Nizza?
Der Vertrag von Nizza brachte wichtige Reformen der Abstimmungsmodalitäten im Rat und der Binnenstruktur der Kommission mit sich.
- Citar trabajo
- Andreas Hirling (Autor), 2005, Entstehung und Einfluss der Europäischen Institutionen unter besonderer Berücksichtigung des Europäischen Parlaments seit dem Vertrag von Maastricht. , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187803