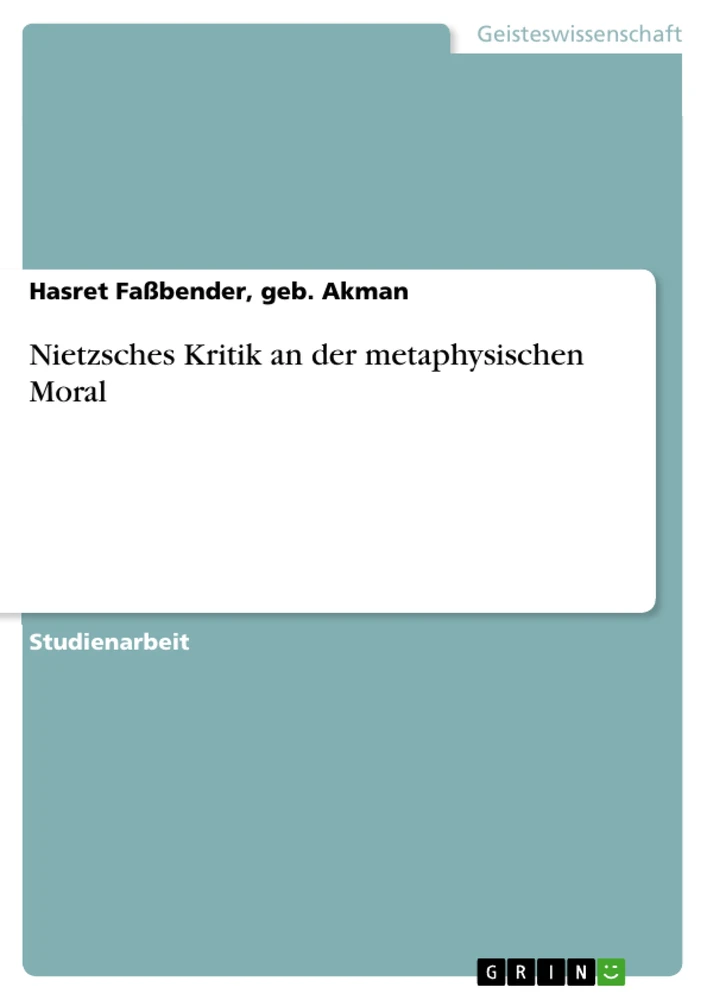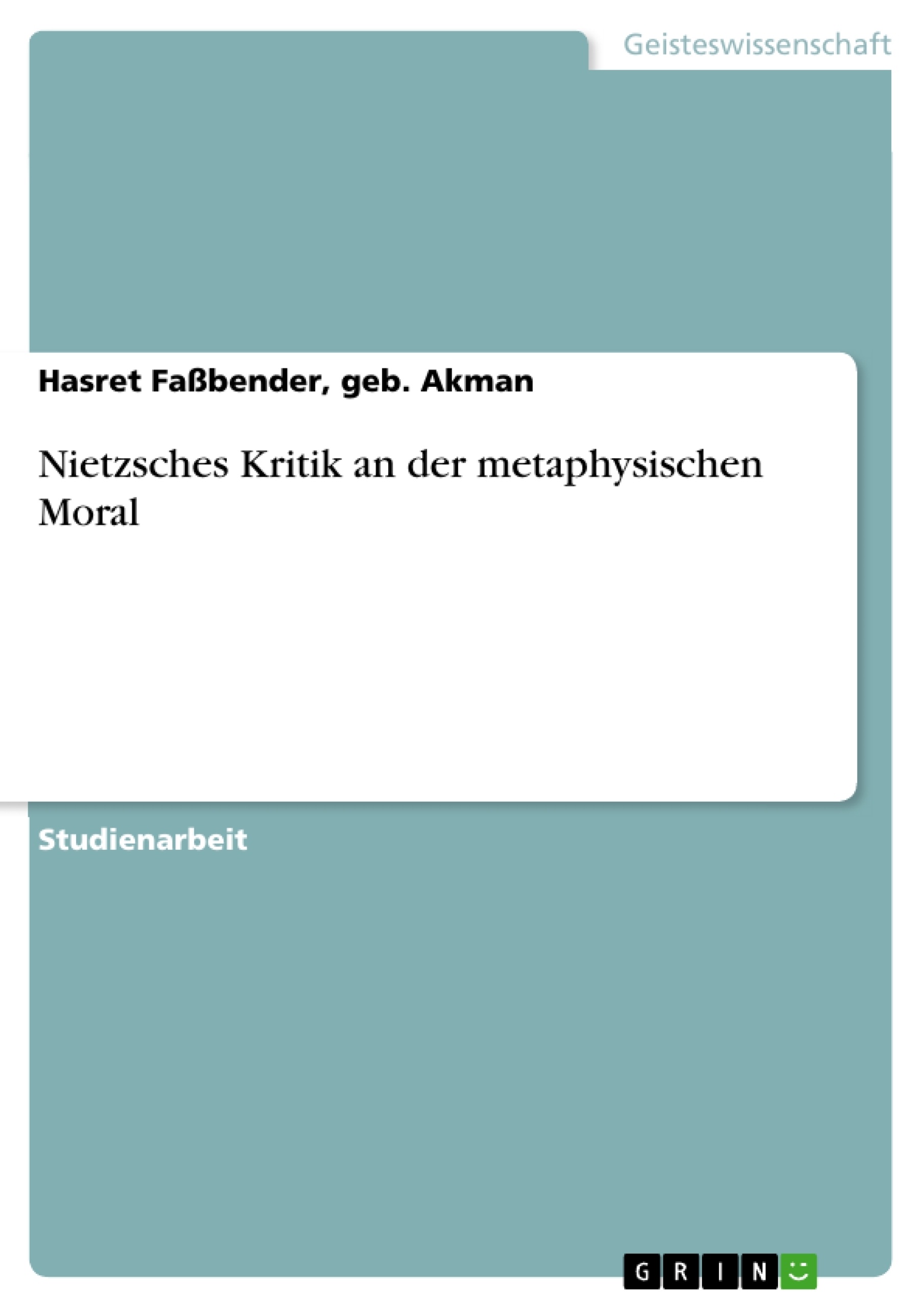Wie kaum ein Philosoph seines Zeitalters hat der am 15.10.1844 in Röcken geborene Friedrich Wilhelm Nietzsche eine polarisierende Wirkung auf seine Exegeten. Die Meinungen oszillieren zwischen Abstoßung und Bewunderung. Seine Biographie und sein Werk übten einen großen Einfluss auf Literatur, Philosophie und die Psychologie aus. In der Literatur inspirierte er u.a. Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig, Heinrich Mann, Thomas Mann, Gottfried Benn und Hermann Hesse. Unter den Philosophen erstreckte sich sein Einfluss auf u.a. Martin Heidegger und Karl Jaspers, wie auch auf die Psychologen Sigmund Freud, Ludwig Klages und Carl Gustav Jung. Der Grund warum Nietzsche so umstritten ist, liegt in erster Linie in seiner Wirkungsgeschichte. Die Nationalsozialisten griffen seine Gedanken vom „Willen zur Macht“, der „Herrenmoral“ missbräuchlich auf und politisierten diese in propagandistischer Weise.
Systematisch betrachtet lässt sich seine Philosophie in drei Phasen einteilen [...].
Die vorliegende Arbeit hat sich zur Aufgabe gemacht, die Kritik Nietzsches an der metaphysischen Moral aus der Formel Gott ist tot! herauszuarbeiten und zu überprüfen, ob der daraus resultierende Immoralismus konsistent durchdacht ist.
Hierzu wird im ersten Schritt die oben erwähnte Demontage der Moral in Nietzsches Spätschriften "Jenseits von Gut und Böse" (1886) und "Zur Genealogie der Moral" (1887) dargestellt. Da die Kritik am Christentum ein wichtiger Bestandteil für die Kritik an der metaphysischen Moral ist, wird im folgenden Kapitel darauf Bezug genommen werden. Nachstehend widmet sich die vorliegende Arbeit der Kritik der metaphysischen Moral selbst. Den drei zentralen Gedanken „ewige Wiederkehr“, „Wille zur Macht“ und „Übermensch“ kann kein Platz eingeräumt werden, da sonst der Rahmen dieser Ausarbeitung gesprengt werden würde. Was jedoch unbedingt für das Verständnis Nietzsches mit in die vorliegende Erörterung in Betracht gezogen wird, ist der Gedanke der „ewigen Wiederkehr“. Dieser bildet m.E. das konstruktive Zentrum, respektive das Fundament Nietzsches Philosophie und wird daher ein Unterkapitel dieser Arbeit bilden. Im letzten Kapitel – der Schlussbetrachtung – werden abschließend die vorherigen Ausarbeitungen evaluiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die Demontage der Moral
- II. Nietzsches Kritik am Christentum
- III. Nietzsche und die Metaphysik
- III. 1 Das konstruktive Zentrum: „Die ewige Wiederkehr des Gleichen“
- III. 2 Nietzsches Abkehr von der Metaphysik
- III. 3 Nietzsche und der Tod Gottes
- III. 4 Nihilismus als Konsequenz aus Gottes Tod
- IV. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Friedrich Nietzsches Kritik an der metaphysischen Moral, die auf der Aussage „Gott ist tot!“ basiert. Sie untersucht, ob Nietzsches Immoralismus konsequent durchdacht ist.
- Demontage der Moral in Nietzsches Spätschriften
- Kritik am Christentum als Teil der Kritik an der metaphysischen Moral
- Nietzsches Konzept der „ewigen Wiederkehr“ als zentrales Element seiner Philosophie
- Die Folgen des „Todes Gottes“ und der daraus resultierende Nihilismus
- Nietzsches Kritik an der traditionellen Wertordnung und seine Umwertung aller Werte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt Friedrich Nietzsche als einen polarisierenden Philosophen vor und gibt einen kurzen Überblick über seine Philosophie in drei Phasen.
- I. Die Demontage der Moral: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Nietzsches Kritik an der Moral in seinen Spätschriften. Es argumentiert, dass Moral eine Maske für egozentrische Bedürfnisse ist und dass altruistische Handlungen auf einen grundlegenden Egoismus zurückzuführen sind.
- II. Nietzsches Kritik am Christentum: Dieses Kapitel untersucht Nietzsches Kritik am Christentum und die Verbindung dieser Kritik mit seiner Kritik an der metaphysischen Moral.
- III. Nietzsche und die Metaphysik: Dieses Kapitel untersucht Nietzsches Beziehung zur Metaphysik. Es widmet sich besonders dem Konzept der „ewigen Wiederkehr“ als dem konstruktiven Zentrum von Nietzsches Philosophie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der metaphysischen Moral, Immoralismus, Nietzsche, Kritik am Christentum, "ewige Wiederkehr", "Wille zur Macht", "Übermensch", Tod Gottes, Nihilismus und Umwertung der Werte.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Nietzsches Formel „Gott ist tot“ für die Moral?
Die Arbeit untersucht, wie diese Aussage zur Demontage der metaphysischen Moral führt und welche Konsequenzen dies für die traditionelle Wertordnung hat.
Welche Werke Nietzsches stehen im Fokus der Analyse?
Primär werden die Spätschriften „Jenseits von Gut und Böse“ (1886) und „Zur Genealogie der Moral“ (1887) herangezogen.
Was versteht Nietzsche unter der „ewigen Wiederkehr“?
Dieses Konzept wird als das konstruktive Zentrum und Fundament von Nietzsches Philosophie beschrieben, das eine Abkehr von der Metaphysik markiert.
Warum ist Nietzsches Philosophie bis heute umstritten?
Ein Grund liegt in der Wirkungsgeschichte, insbesondere in der missbräuchlichen propagandistischen Nutzung seiner Begriffe wie „Wille zur Macht“ durch die Nationalsozialisten.
Was ist die Folge des Nihilismus laut dieser Arbeit?
Die Arbeit prüft, ob der aus dem Tod Gottes resultierende Immoralismus und Nihilismus als philosophisches System konsistent durchdacht ist.
- Arbeit zitieren
- M.A. Hasret Faßbender, geb. Akman (Autor:in), 2002, Nietzsches Kritik an der metaphysischen Moral, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187835