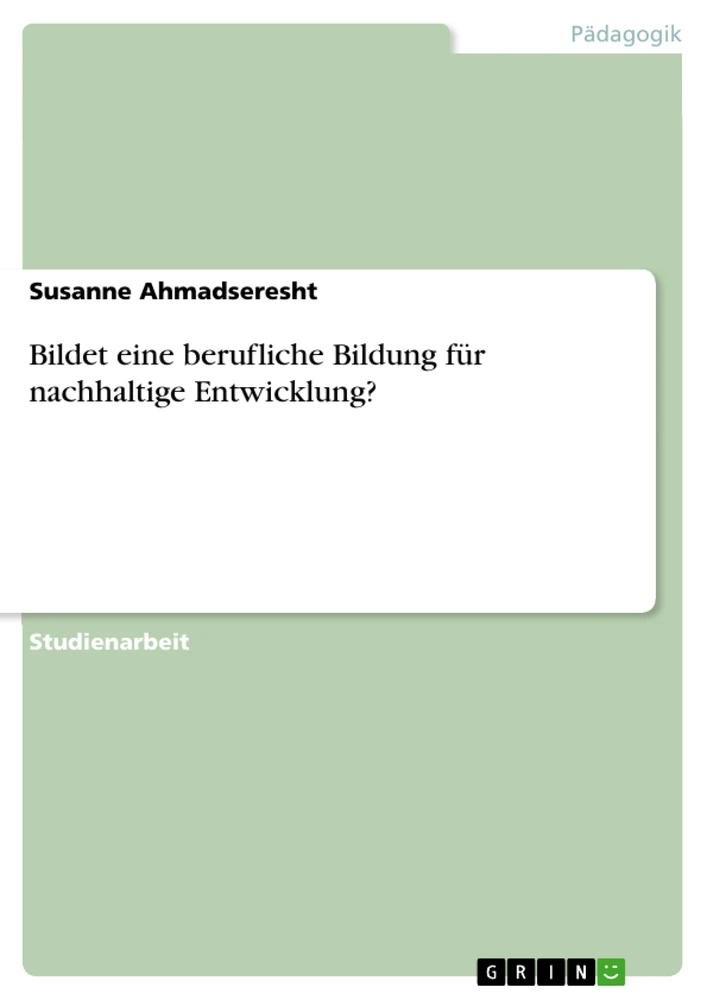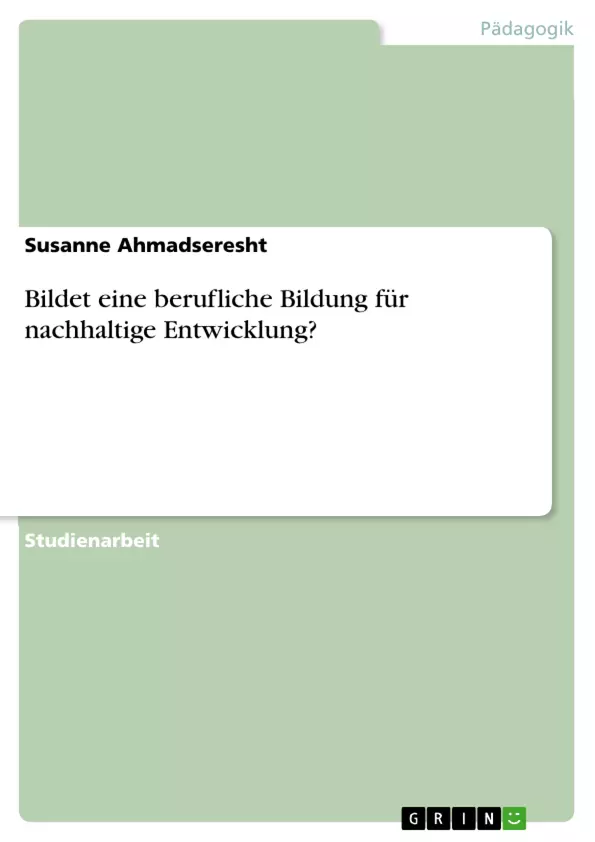Mit der beruflichen Ausbildung junger Menschen verfolgt unsere Gesellschaft das Ziel, die Betriebe mit Fachkräften zu versorgen und das Innovationspotential innerhalb der Betriebe zu fördern.
Bis zum Jahr 2020 werden Arbeitsprozesse – wo immer es möglich ist – automatisiert. Übrig bleiben die Betriebe mit komplexen Arbeitsabläufen. Produktionsorientierte Tätigkeiten und primäre Dienstleistungen werden immer mehr verschwinden. Dagegen wird die Nachfrage nach sekundären Dienstleistungen wie zum Beispiel Beratung, Betreuung, Lehre, Management, Forschung und Entwicklung weiter ansteigen.
Die Anforderungen an das Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte werden also zukünftig stetig steigen. Hierauf muss die berufliche Bildung reagieren, wenn sie „up to date“ sein will. Dazu gehört, dass sie sowohl selbst nachhaltig ist, als auch als Impulsgeber für eine nach¬haltige Entwicklung in unserem Land fungiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Begrifflichkeiten
- Berufliche Bildung
- Beruf
- Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung
- Bildungstheoretischer Hintergrund beruflicher Bildung
- Abriss
- Ausbildung im Dualen System
- Allgemeinbildung vs. Berufsbildung
- Berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung?
- Lebenslanges Lernen als Herausforderung
- Persönlichkeitsbildung und Handlungsorientierung
- Beständigkeit durch Wandel
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern die berufliche Bildung einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann. Sie analysiert die Rolle der beruflichen Bildung im Kontext gesellschaftlicher Herausforderungen und zeigt die Bedeutung von lebenslangem Lernen, Persönlichkeitsbildung und Handlungsorientierung auf.
- Die Bedeutung der beruflichen Bildung für die gesellschaftliche Entwicklung
- Die Rolle der Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung
- Die Herausforderungen und Chancen des lebenslangen Lernens
- Die Bedeutung von Persönlichkeitsbildung und Handlungsorientierung für die berufliche Bildung
- Die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung in der beruflichen Bildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie kann die berufliche Bildung einen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung leisten?
Im ersten Teil der Arbeit werden die zentralen Begrifflichkeiten der Arbeit definiert: Berufliche Bildung, Beruf, Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung. Es wird gezeigt, dass die berufliche Bildung in Deutschland im dualen System stattfindet und dass der Begriff des Berufs sowohl in der Umgangssprache als auch in der wissenschaftlichen Literatur vielfältig interpretiert wird.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich den bildungstheoretischen Hintergründen beruflicher Bildung. Es wird ein Abriss der relevanten Theorien gegeben und die Bedeutung des dualen Ausbildungssystems und der Unterscheidung zwischen Allgemeinbildung und Berufsbildung diskutiert.
Im dritten Teil der Arbeit werden die Erkenntnisse aus den ersten beiden Teilen zusammengeführt, um die Frage nach dem Beitrag der beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu beantworten. Es werden die Aspekte Lebenslanges Lernen, Persönlichkeitsbildung und Handlungsorientierung in den Mittelpunkt gestellt.
Schlüsselwörter
Berufliche Bildung, Nachhaltigkeit, Lebenslanges Lernen, Persönlichkeitsbildung, Handlungsorientierung, Duales System, Beruf, Ausbildung, Nachhaltige Entwicklung, Gesellschaftliche Herausforderungen, Zukunft der Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung?
Nachhaltigkeit bedeutet, dass die Bildung selbst zukunftsfähig ist und Fachkräfte befähigt, ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortungsvoll zu handeln.
Wie verändern sich Arbeitsabläufe bis 2020?
Einfache Tätigkeiten werden automatisiert; es bleiben komplexe Abläufe und eine steigende Nachfrage nach sekundären Dienstleistungen wie Beratung und Management.
Welche Rolle spielt das lebenslange Lernen?
Aufgrund des stetig steigenden Qualifikationsniveaus ist lebenslanges Lernen eine zentrale Herausforderung, um im Berufsleben „up to date“ zu bleiben.
Was ist der Unterschied zwischen Allgemeinbildung und Berufsbildung?
Die Arbeit diskutiert die bildungstheoretische Abgrenzung und wie beide Bereiche für eine ganzheitliche Persönlichkeitsbildung zusammenwirken sollten.
Wie fungiert berufliche Bildung als Impulsgeber für die Gesellschaft?
Indem sie Innovationen in Betrieben fördert und Fachkräfte ausbildet, die aktiv an einer nachhaltigen Entwicklung des Landes mitwirken.
- Citation du texte
- Susanne Ahmadseresht (Auteur), 2010, Bildet eine berufliche Bildung für nachhaltige Entwicklung? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187837