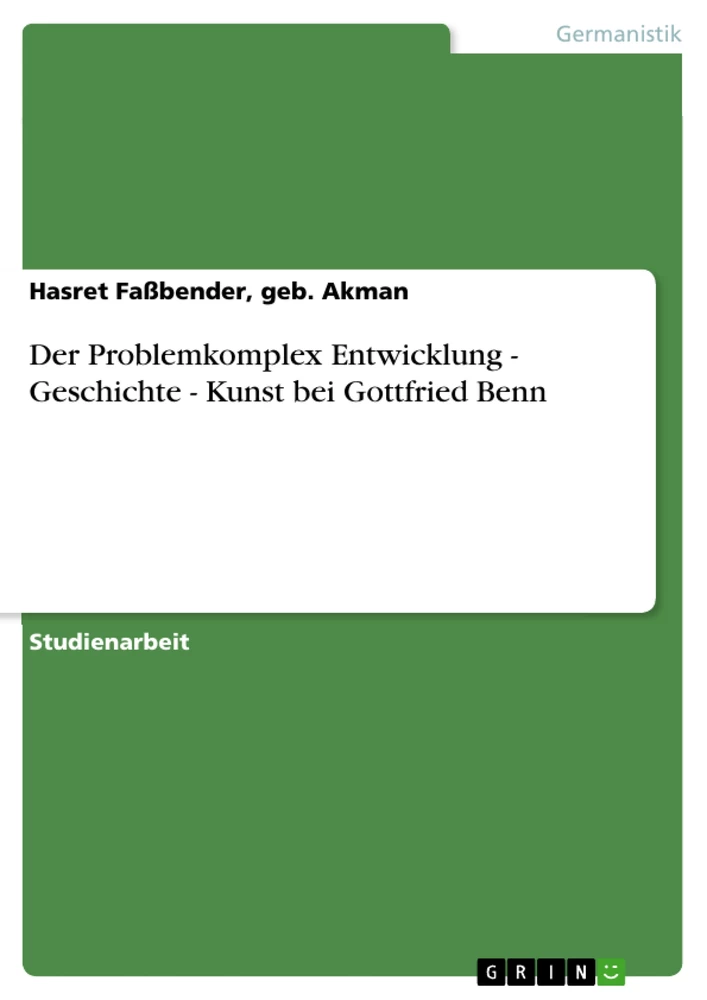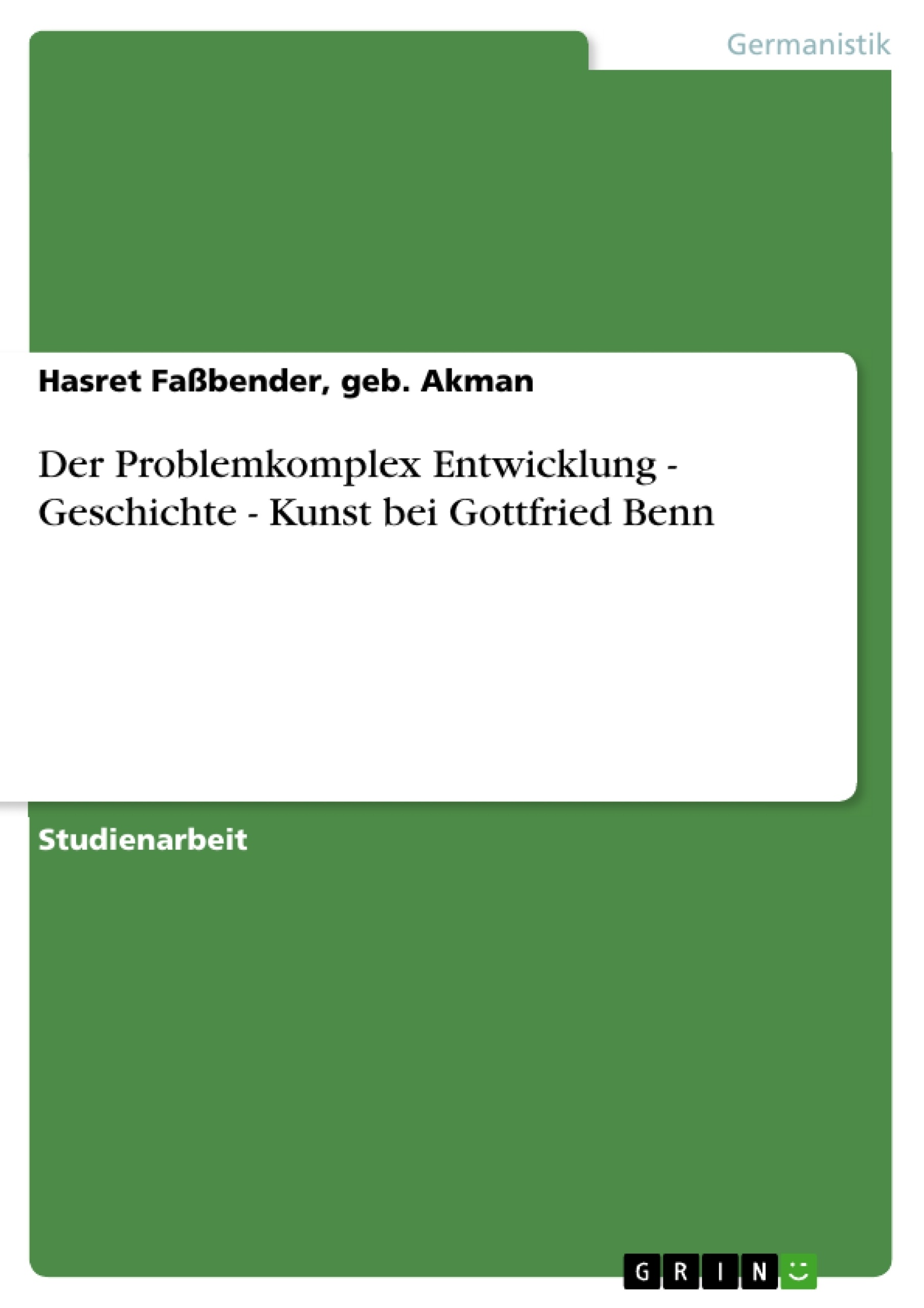Mit der vorliegenden Arbeit soll der Versuch unternommen werden, die Auseinandersetzung und Orientierung Gottfried Benns zum Themenkomplex Menschenbild-Geschichte und Kunst- bzw. Dichtungstheorie zu rekonstruieren und darzustellen.
Im Rahmen dieser Arbeit soll nicht die Darstellung der Geschichts-philosophie, Dichtungstheorie oder das Weltbild Benns in aller Ausführlichkeit angestrebt werden. Es geht vielmehr darum, die Abhängigkeit aller Themenkomplexe voneinander skizzieren. Hierbei wird sich die vorliegende Arbeit auf die Veranschaulichung der wesentlichen Züge seiner Theorien über Mensch, Leben, Geschichte, Dichtung und Kunst konzentrieren.
Die Problematisierung der vielen verschiedenen Einflüsse, die auf Benn wirkten, und in wieweit sie sein Weltbild veränderten oder bestärkten, soll im Rahmen dieser Arbeit nicht in aller Ausführlichkeit geleistet werden. Jedoch ist es an dieser Stelle wohl unumgänglich, zunächst den Einfluss Nietzsches zu umreißen, um seinen weltanschaulichen Entwurf - zumindest in groben Zügen - rekonstruieren zu können. Vor allem in den Prosaschriften Benns - Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre - und in der Nachkriegszeit, hat Benn keinen Namen so oft genannt wie den Nietzsches.
Die Motivation Benns, wissenschaftstheoretische Ansätze und Inhalte kritisch zu reflektieren, die in dem Bemühen wurzelt, einer, dem Menschen in seiner ganzen Lebenswirklichkeit gerecht werdenden Anthropologie auf den Weg zu helfen, soll folgend Platz einnehmen. Dass diese Anthropologie für seine Auseinandersetzung mit Entwicklung, Geschichte und Kunst von immanenter Bedeutung ist, wird im Nachstehenden seine Aufgabe finden.
Mit dem Ziel, Zusammenhänge des Menschenverständnisses und dem Verständnis von Geschichte bei Benn mit seinem Selbstverständnis als Künstler und seiner Theorie der Dichtung aufzudecken, soll letztlich mit Hilfe des Prosawerks Weinhaus Wolf (1937) eine exemplarische Allegorisierung vollzogen werden.
Sicherlich werden die folgenden Ausführungen dem Dichter Benn nicht vollkommen gerecht werden. Mithin sollen die folgenden Kapitel zwar kurz aber ad oculus, Gottfried Benns problematisches Verhältnis und seine Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex Entwicklung-Geschichte exhibieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Nietzsches Einfluss auf Benn
- II. Benns Verständnis von Entwicklung-Geschichte-Kunst
- II. 1 Entwicklungs- bzw. Menschenbild
- II. 2 Kunst- und Dichtungstheorie
- II. 3 Zyklische Geschichtsphilosophie
- III. Die zyklische Geschichtsphilosophie Benns dargelegt am Prosawerk Weinhaus Wolf
- IV. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, Gottfried Benns Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex Menschenbild, Geschichte und Kunst beziehungsweise Dichtungstheorie zu rekonstruieren und darzustellen. Die Abhängigkeit dieser Themenkomplexe voneinander steht im Mittelpunkt, wobei sich die Arbeit auf die Veranschaulichung der wesentlichen Züge seiner Theorien über Mensch, Leben, Geschichte, Dichtung und Kunst konzentriert. Die Arbeit untersucht, wie Benns Verständnis von Entwicklung, Geschichte und Kunst aus seinem Menschenbild und seinem Selbstverständnis als Künstler resultiert.
- Nietzsches Einfluss auf Benns Weltanschauung und Kunstverständnis
- Benns Theorie von Entwicklung und Mensch
- Benns Kunst- und Dichtungstheorie
- Benns zyklische Geschichtsphilosophie
- Benns Verwendung des Prosawerks "Weinhaus Wolf" als Beispiel für seine zyklische Geschichtsphilosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Forschungsziele und den Fokus auf Benns Theorien über Mensch, Leben, Geschichte, Dichtung und Kunst dar. Sie betont die Abhängigkeit dieser Themenkomplexe voneinander und erläutert die Bedeutung von Nietzsches Einfluss auf Benns Weltbild.
Kapitel I untersucht den Einfluss Nietzsches auf Benns Menschenbild. Es wird gezeigt, wie Benn Nietzsche mit den Augen des Künstlers betrachtet und dessen Kunsttheorie als Inspiration für seine eigene Dichtung nutzt.
Kapitel II befasst sich mit Benns Verständnis von Entwicklung, Geschichte und Kunst. Es analysiert seine Theorien über Mensch, Leben und Kunst, sowie seine zyklische Geschichtsphilosophie.
Kapitel III beleuchtet die zyklische Geschichtsphilosophie Benns anhand des Prosawerks "Weinhaus Wolf". Dieses Kapitel veranschaulicht, wie Benn seine Theorien über Mensch, Geschichte und Kunst in seinem Werk literarisch verarbeitet.
Schlüsselwörter
Gottfried Benn, Nietzsche, Menschenbild, Geschichte, Kunst, Dichtung, Entwicklung, Zyklus, "Weinhaus Wolf", Anthropologie, Kunsttheorie, Dichtungstheorie.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte Nietzsche auf Gottfried Benn?
Nietzsche prägte massiv Benns Weltbild, insbesondere seine Sicht auf den Menschen, die Kunst und die Überwindung traditioneller Geschichtsbilder.
Was versteht Benn unter einer zyklischen Geschichtsphilosophie?
Benn lehnt ein lineares Fortschrittsmodell ab und sieht Geschichte eher als eine Abfolge von Zyklen oder statischen Zuständen.
Welche Rolle spielt das Werk „Weinhaus Wolf“ in der Analyse?
Es dient als literarisches Beispiel für die Allegorisierung von Benns Theorien über Mensch, Geschichte und Kunst.
Wie hängen Menschenbild und Dichtungstheorie bei Benn zusammen?
Benns Anthropologie, also seine Lehre vom Menschen, ist die Grundlage für seine Auffassung, dass Kunst die einzige überdauernde Realität darstellt.
Was ist das Ziel von Benns anthropologischem Entwurf?
Er versuchte, eine Sichtweise zu entwickeln, die der Lebenswirklichkeit des modernen Menschen gerecht wird und wissenschaftstheoretische Ansätze kritisch reflektiert.
- Arbeit zitieren
- M.A. Hasret Faßbender, geb. Akman (Autor:in), 2001, Der Problemkomplex Entwicklung - Geschichte - Kunst bei Gottfried Benn, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187856