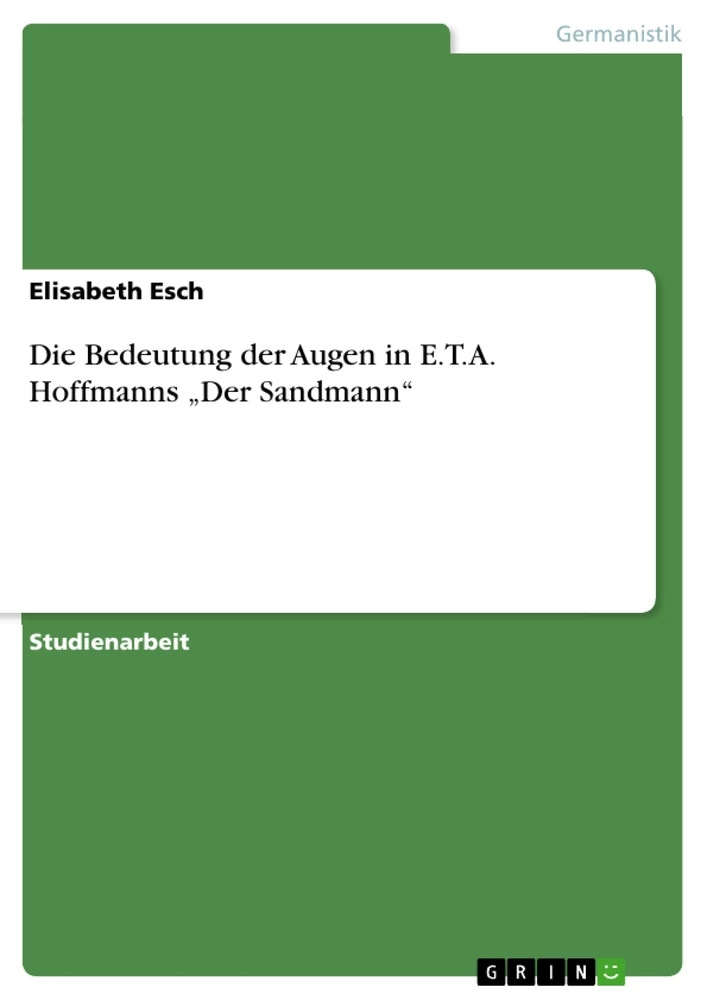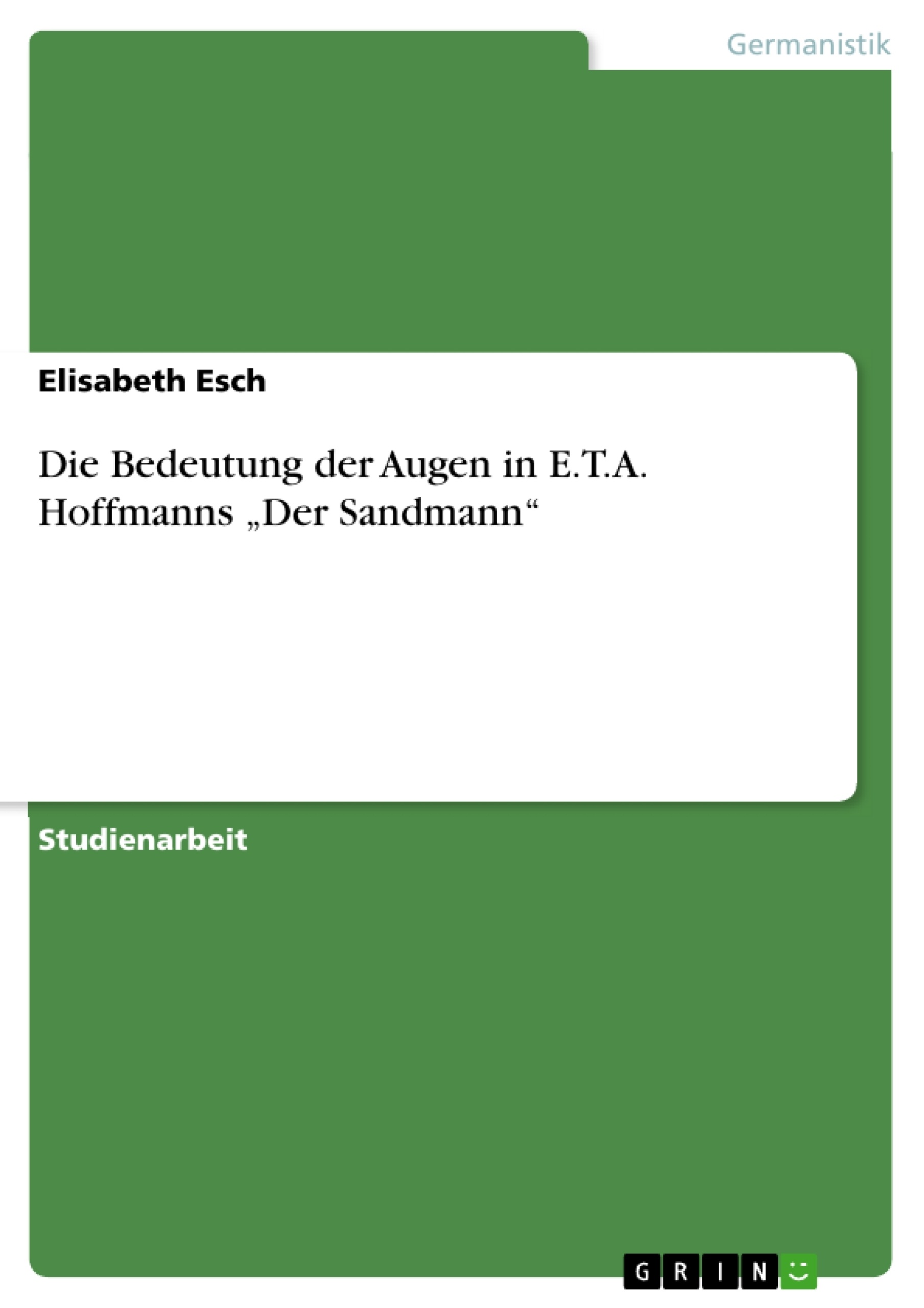Das 1817 veröffentlichte Werk „Der Sandmann“ von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann handelt nicht von der Sagengestalt des Sandmannes, der mithilfe seines magischen Sandes liebevoll den Kindern Träume bringt. Vielmehr handelt es von dem Protagonisten Nathanael, der in der Gestalt des Sandmannes seine größte Angst sieht, die Angst vor dem Verlust der Augen. Seine Kinderfrau erzählt ihm das schreckliche Märchen des Sandmannes, in welchem dieser mithilfe des Sandes brutal die Augen der Kinder raubt. Nathanael sieht sich seiner größten Angst ausgeliefert, die sich durch sein ganzes Leben ziehen wird, bis hin zu seinem Tod.
Die folgende Ausarbeitung wird sich mit einem der Motive in Hoffmanns Werk auseinandersetzen. Es wird erläutert, inwieweit die Augen eine besondere Rolle spielen und warum Nathanael so große Angst verspürt, diese zu verlieren. Zunächst wird allgemein auf den Mythos des Auges eingegangen, anschließend dargestellt, inwiefern Hoffmann die handelnden Personen mithilfe ihrer Augen charakterisiert. Dabei wird auf die Figuren Coppelius beziehungsweise Coppola, Klara, Olimpia und Nathanael eingegangen, weil sie in dem Werk als prägend für das Motiv der Augen gelten. Es wird kurz psychoanalytisch erklärt, warum Nathanaels Angst vor dem Augenverlust gleichgesetzt werden kann mit der Kastrationsangst. Im weiteren Verlauf wird genauer auf die Stationen des Lebens Nathanaels eingegangen, die prägend für seine Angst scheinen, die zum Schluss in zwei Wahnsinnsanfällen enden wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- 2. Der Mythos des Auges
- 3. Die Bedeutung der Augen für die Charakterisierung
- 3.1. Coppelius/Coppola
- 3.2. Klara
- 3.3. Olimpia
- 3.4. Nathanael
- 4. Das Augenmotiv im Zusammenhang mit Nathanaels Wahnsinn
- 4.1. Das Märchen von dem Sandmann
- 4.2. Die alchemistischen Versuche und der Tod des Vaters
- 4.3. Nathanaels Dichtung über seine Vorahnung
- 4.4. Das Perspektiv des Coppolas
- 4.5. Endgültiger Ausbruch des Wahnsinns
- 4.5.1. Erster Wahnsinnsanfall
- 4.5.2. Der Selbstmord Nathanaels
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die zentrale Rolle des Augenmotivs in E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“. Das Ziel ist es, die Bedeutung der Augen für die Charakterisierung der Figuren und den Verlauf der Handlung zu analysieren, insbesondere im Kontext von Nathanaels fortschreitendem Wahnsinn. Die Arbeit beleuchtet den Mythos des Auges und untersucht, wie dieser Mythos in Hoffmanns Erzählung verarbeitet wird.
- Der Mythos des Auges in der Literatur und seine Bedeutung
- Die Charakterisierung der Figuren durch ihre Augen
- Der Zusammenhang zwischen Augenmotiv und Nathanaels Wahnsinn
- Die psychologische Interpretation von Nathanaels Angst vor dem Augenverlust
- Die Rolle der künstlichen Augen und optischen Geräte (z.B. das Perspektiv)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit: Die Einleitung beschreibt den Ausgangspunkt der Arbeit: die Analyse des Augenmotivs in E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“. Im Gegensatz zur gängigen Vorstellung des Sandmannes als träumevermittelnde Figur wird hier der Fokus auf Nathanaels Angst vor dem Augenverlust gelegt, die als zentrale Thematik der Erzählung dargestellt wird. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der den Mythos des Auges, die Charakterisierung der Figuren durch ihre Augen und die Entwicklung von Nathanaels Wahnsinn umfasst. Die Einleitung legt den Grundstein für eine detaillierte Untersuchung der verschiedenen Aspekte des Augenmotivs und ihrer Bedeutung für die Interpretation des Gesamtwerks.
2. Der Mythos des Auges: Dieses Kapitel beleuchtet den Mythos des Auges als zentrales Motiv in Hoffmanns Erzählung. Es werden sowohl physische Augen als auch künstliche Sehhilfen wie Brillen und das Perspektiv Coppolas betrachtet, die als Transformationsmedium und zentrales Handlungselement beschrieben werden. Die Analyse betont die Doppeldeutigkeit des Auges: als wichtigstes Sinnesorgan und Spiegel der Seele, das sowohl Erkenntnis als auch gesellschaftliche Beziehungen ermöglicht. Der Verlust des Sehvermögens wird als Metapher für den Verlust von Erkenntnis und Verständnis der Welt dargestellt, wodurch die Bedeutung des Augenmotivs im Kontext der Erzählung fundiert wird.
3. Die Bedeutung der Augen für die Charakterisierung: Dieses Kapitel untersucht die Augen als „Fenster der Seele“ und analysiert, wie Hoffmann die Charaktere durch die Darstellung ihrer Augen charakterisiert. Es werden Coppelius/Coppola, Klara, Olimpia und Nathanael im Detail betrachtet, wobei die besonderen Eigenschaften der Augen jeder Figur hervorgehoben werden, um ihre Persönlichkeit und Rolle in der Erzählung zu verdeutlichen. Der Fokus liegt auf der Veranschaulichung innerer Zustände und Emotionen durch die Augen, wobei insbesondere die künstlichen Augen Olimpiens als zentraler Aspekt der Thematik herausgearbeitet werden.
4. Das Augenmotiv im Zusammenhang mit Nathanaels Wahnsinn: Dieses Kapitel stellt die Verbindung zwischen dem Augenmotiv und Nathanaels fortschreitendem Wahnsinn her. Es analysiert verschiedene Schlüsselszenen, wie das Märchen vom Sandmann, die alchemistischen Experimente, Nathanaels Dichtung und die Begegnungen mit Coppola. Die Kapitel untersuchen, wie diese Ereignisse Nathanaels Angst vor dem Augenverlust verstärken und letztendlich zu seinen Wahnsinnsanfällen und seinem Selbstmord führen. Das Perspektiv Coppolas wird als wichtiges Werkzeug der Täuschung und als Katalysator für Nathanaels psychischen Zusammenbruch identifiziert. Durch die Analyse der einzelnen Stationen wird die Entwicklung von Nathanaels Wahnsinn nachvollziehbar dargestellt.
Schlüsselwörter
E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, Augenmotiv, Wahnsinn, Nathanael, Coppelius/Coppola, Klara, Olimpia, Mythos des Auges, Charakterisierung, Psychoanalyse, Kastrationsangst, Perspektiv, Sehen, Erkenntnis, Realität.
Häufig gestellte Fragen zu E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die zentrale Rolle des Augenmotivs in E.T.A. Hoffmanns Erzählung "Der Sandmann". Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Augen für die Charakterisierung der Figuren und den Verlauf der Handlung, insbesondere im Kontext von Nathanaels fortschreitendem Wahnsinn. Die Arbeit untersucht den Mythos des Auges und seine Verarbeitung in Hoffmanns Werk.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Mythos des Auges in der Literatur, die Charakterisierung der Figuren durch ihre Augen, den Zusammenhang zwischen Augenmotiv und Nathanaels Wahnsinn, die psychologische Interpretation von Nathanaels Angst vor Augenverlust und die Rolle künstlicher Augen und optischer Geräte (wie das Perspektiv).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 beschreibt Gegenstand und Zielsetzung. Kapitel 2 beleuchtet den Mythos des Auges. Kapitel 3 untersucht die Bedeutung der Augen für die Charakterisierung der Figuren (Coppelius/Coppola, Klara, Olimpia, Nathanael). Kapitel 4 analysiert den Zusammenhang zwischen Augenmotiv und Nathanaels Wahnsinn, inklusive Schlüsselereignissen wie dem Märchen vom Sandmann und den Begegnungen mit Coppola. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird das Augenmotiv im Zusammenhang mit Nathanaels Wahnsinn dargestellt?
Das Kapitel 4 stellt die Verbindung zwischen dem Augenmotiv und Nathanaels Wahnsinn her. Es analysiert verschiedene Schlüsselszenen (Märchen vom Sandmann, alchemistische Experimente, Nathanaels Dichtung, Begegnungen mit Coppola), die seine Angst vor Augenverlust verstärken und zu seinen Wahnsinnsanfällen und Selbstmord führen. Coppolas Perspektiv wird als Werkzeug der Täuschung und Katalysator für Nathanaels psychischen Zusammenbruch identifiziert.
Welche Rolle spielen die Augen für die Charakterisierung der Figuren?
Kapitel 3 analysiert die Augen als "Fenster der Seele". Es werden die Augen von Coppelius/Coppola, Klara, Olimpia und Nathanael detailliert betrachtet, um ihre Persönlichkeit und Rolle in der Erzählung zu verdeutlichen. Die künstlichen Augen Olimpiens werden als zentraler Aspekt der Thematik herausgearbeitet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, Augenmotiv, Wahnsinn, Nathanael, Coppelius/Coppola, Klara, Olimpia, Mythos des Auges, Charakterisierung, Psychoanalyse, Kastrationsangst, Perspektiv, Sehen, Erkenntnis, Realität.
Wie wird der Mythos des Auges in der Arbeit behandelt?
Kapitel 2 beleuchtet den Mythos des Auges als zentrales Motiv. Es werden physische und künstliche Sehhilfen (Brillen, Perspektiv) als Transformationsmedium und Handlungselement betrachtet. Die Doppeldeutigkeit des Auges (Sinnesorgan und Spiegel der Seele) und der Verlust des Sehvermögens als Metapher für Erkenntnisverlust werden hervorgehoben.
- Quote paper
- Elisabeth Esch (Author), 2011, Die Bedeutung der Augen in E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187874