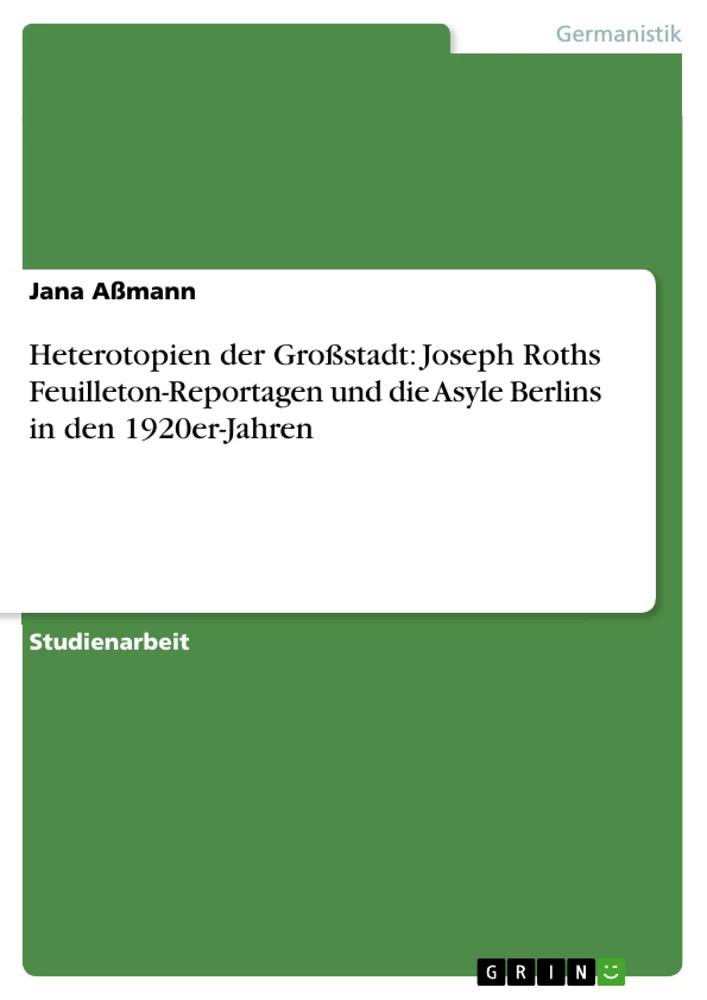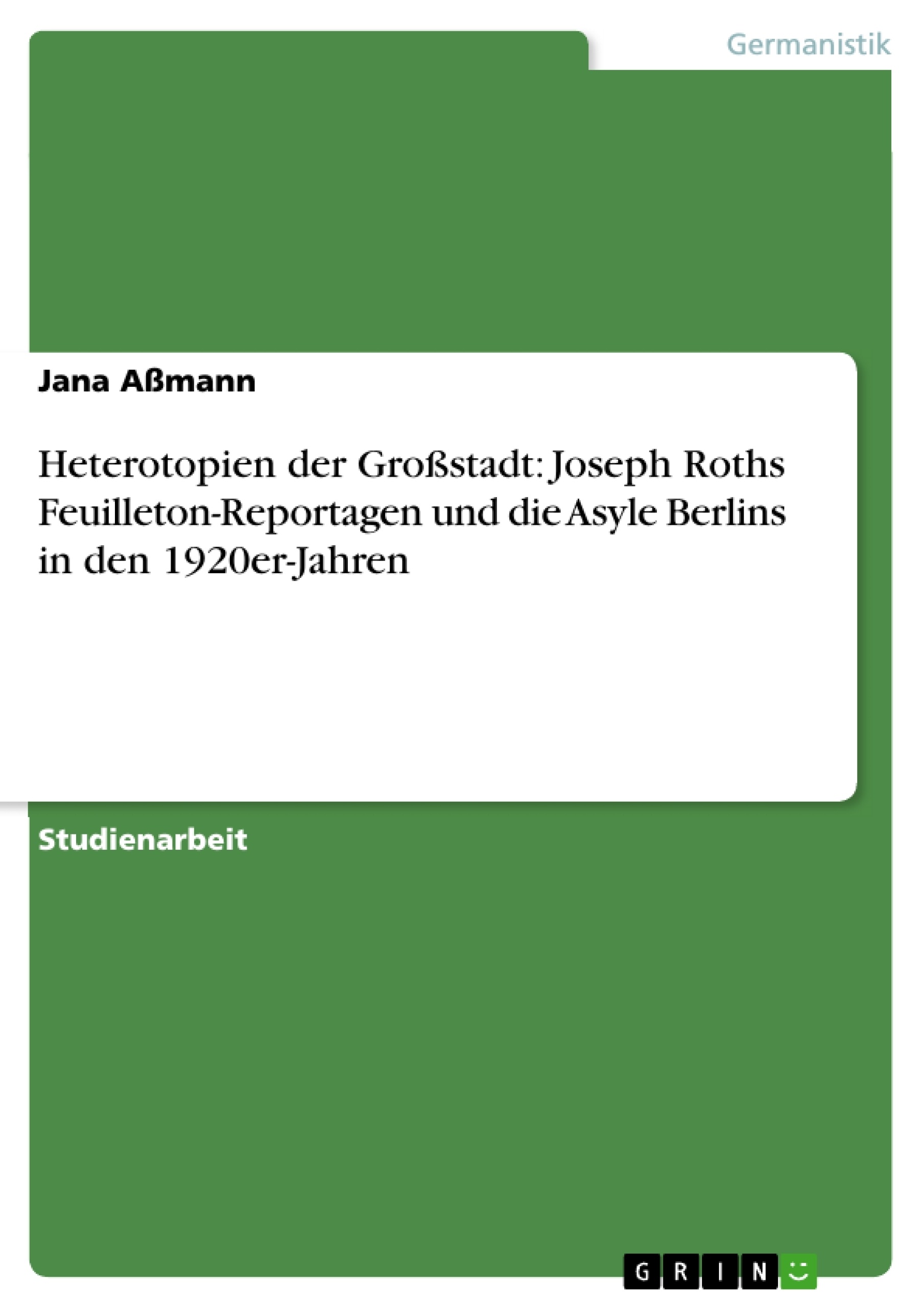Joseph Roth zieht im Juni 1920 von Wien nach Berlin. Dort möchte er seine journalistische Karriere, die noch in den Anfängen steht, weiter ausbauen und schreibt zu diesem Zweck für das Feuilleton verschiedener Zeitungen. Roth erlebt die Stadt in einer historischen Umbruchphase: Die Folgen des Ersten Weltkriegs, der im Vertrag von Versailles festgelegten Reparationszahlungen und des nur langsam voranschreitenden Abbaus von Lebensmittelrationen machen sich vor allem in der Hauptstadt der Weimarer Republik bemerkbar. Armut und soziales Elend kennzeichnen den Alltag vieler Menschen in Berlin. Roth widmet sich in seinen Reportagen vermehrt denjenigen, denen diese Jahre nach dem Weltkrieg am meisten geschadet haben. Dafür sucht er die abgelegenen und teilweise versteckten Orte auf, an denen sich die Menschen aufhalten, die weder Arbeit noch eine Wohnung haben, ihr Leben durch illegale Tätigkeiten finanzieren oder aus politischen und sozialen Gründen nach Berlin geflüchtet sind. Seine Art der feuilletonistischen Kulturberichterstattung gleicht somit einer Sozialreportage. Das Aufsuchen von oftmals übersehenen Orten und die detaillierte Erfassung ihrer Besonderheiten führt dazu, dass sich Roth mit der Zeit ein individuelles Bild Berlins schafft.
In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, diese Orte in ihrem Wesen und ihrer Funktion für die Großstadt Berlin und ihre Bewohner näher zu beschreiben. Anhand der Theorien von Michel Foucault und Henri Lefèbvre soll nachgewiesen werden, dass es sich bei den von Joseph Roth besuchten Asylorten um so genannte „Heterotopien“ bzw. „Hetero-Topien“ handelt, die zur Heterogenität und Diversität Berlins beitragen und bestimmten sozialen Gruppen zugeordnet werden können. Zu diesem Zweck wird zunächst unter Berücksichtigung der Denkansätze von Foucault und Lefèbvre das Konzept der Heterotopie erläutert. In einem zweiten Schritt sollen Joseph Roths Reportagen in Hinblick auf diese Theorien untersucht werden, um zu verdeutlichen, dass die Großstadt Berlin ein zutiefst heterogenes Areal ist, in dem unterschiedliche Räume in Kontrast zueinander treten, sich überlagern oder parallel existieren. Dabei soll der Fokus nicht darauf gelegt werden, wie Roth die sozialen Missstände, deren Zeuge er wird, bewertet, sondern vielmehr, wie er die aufgesuchten Räume beschreibt und wahrnimmt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das Konzept der Heterotopie bei Michel Foucault und Henri Lefebvre
- III. Berliner Heterotopien
- 1. Unterkünfte
- a) Das Obdachlosenheim
- b) Das Kunstasyl
- c) Das Dampfbad
- 2. Cafés, Kneipen, Lokale
- a) Kaschemmennächte
- b) Flüchtlingscafés
- 1. Unterkünfte
- IV. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Joseph Roths Reportagen aus den 1920er Jahren in Berlin und untersucht, wie er die Asylorte der Stadt, in denen sich sozial Benachteiligte aufhielten, wahrnahm und beschrieb. Ziel ist es, anhand der Theorien von Michel Foucault und Henri Lefebvre nachzuweisen, dass diese Orte als „Heterotopien“ betrachtet werden können, die zur Heterogenität und Diversität Berlins beitrugen.
- Joseph Roths Reportagen als Spiegelbild der sozialen Misstände in Berlin in den 1920er Jahren
- Das Konzept der Heterotopie bei Michel Foucault und Henri Lefebvre
- Die Funktion von Asylorten in der Großstadt Berlin
- Roths Sicht auf die von ihm besuchten Orte und die Menschen, die sie bewohnten
- Die Rolle der Heterotopien in der Gestaltung des Stadtraums
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Joseph Roth, ein junger Journalist, zog 1920 nach Berlin und erlebte die Stadt in einer Zeit großer sozialer und politischer Umbrüche. Seine Reportagen, die er für verschiedene Zeitungen schrieb, konzentrierten sich auf die Menschen, die von den Folgen des Ersten Weltkriegs und der wirtschaftlichen Krise am stärksten betroffen waren. Roth suchte die abgelegenen und vergessenen Orte auf, an denen sich diese Menschen aufhielten, und zeichnete ein detailliertes Bild vom Berliner Untergrund.
II. Das Konzept der Heterotopie bei Michel Foucault und Henri Lefebvre
Michel Foucault definiert Heterotopien als reale Orte, die eine enge Beziehung zu allen anderen Räumen haben, diese aber gleichzeitig in Frage stellen oder kontrastieren. Sie sind Orte, die außerhalb aller Orte liegen, obwohl sie sich lokalisieren lassen. Foucault unterscheidet zwischen Krisen- und Abweichungsheterotopien. Erstere sind Orte für Menschen in einer temporären, biologisch bedingten Krisensituation, während letztere für Menschen vorgesehen sind, die dauerhaft von der gesellschaftlichen Norm abweichen.
III. Berliner Heterotopien
Die Reportagen von Joseph Roth zeigen, dass Berlin in den 1920er Jahren ein zutiefst heterogenes Areal war, in dem unterschiedliche Räume in Kontrast zueinander traten, sich überlagerten oder parallel existierten. Roth besuchte Orte wie Obdachlosenheime, Kunstasyle, Dampfbad, Kaschemmen und Flüchtlingscafés. Diese Orte waren für verschiedene soziale Gruppen gedacht und boten ihnen einen Raum außerhalb der gesellschaftlichen Norm.
Schlüsselwörter
Heterotopien, Großstadt, Berlin, Joseph Roth, Feuilleton, Reportagen, Asylorte, soziale Missstände, 1920er Jahre, Michel Foucault, Henri Lefebvre, Stadtbild, Heterogenität, Diversität, soziale Gruppen, Krisenheterotopien, Abweichungsheterotopien.
Häufig gestellte Fragen
Welche Orte in Berlin beschrieb Joseph Roth in seinen Reportagen?
Roth widmete sich abgelegenen Orten wie Obdachlosenheimen, Kunstasylen, Dampfbädern, Kaschemmen und Flüchtlingscafés.
Was bedeutet der Begriff "Heterotopie" in diesem Kontext?
Basierend auf Michel Foucault sind Heterotopien reale Orte, die außerhalb der gesellschaftlichen Norm stehen oder diese kontrastieren, wie etwa Asylorte für Randgruppen.
Wie war die soziale Situation in Berlin in den 1920er-Jahren?
Der Alltag war geprägt von Armut, sozialem Elend und den Folgen des Ersten Weltkriegs, was Roth in seinen "Sozialreportagen" dokumentierte.
Welche Rolle spielen Foucault und Lefèbvre in der Arbeit?
Ihre Theorien dienen als Analyseinstrumente, um nachzuweisen, dass die von Roth besuchten Orte zur Heterogenität und Diversität der Großstadt beitrugen.
Was unterscheidet Krisen- von Abweichungsheterotopien?
Krisenheterotopien sind für temporäre Krisen (biologisch bedingt) vorgesehen, während Abweichungsheterotopien für Menschen gedacht sind, die dauerhaft von der Norm abweichen.
- Arbeit zitieren
- Jana Aßmann (Autor:in), 2010, Heterotopien der Großstadt: Joseph Roths Feuilleton-Reportagen und die Asyle Berlins in den 1920er-Jahren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187888