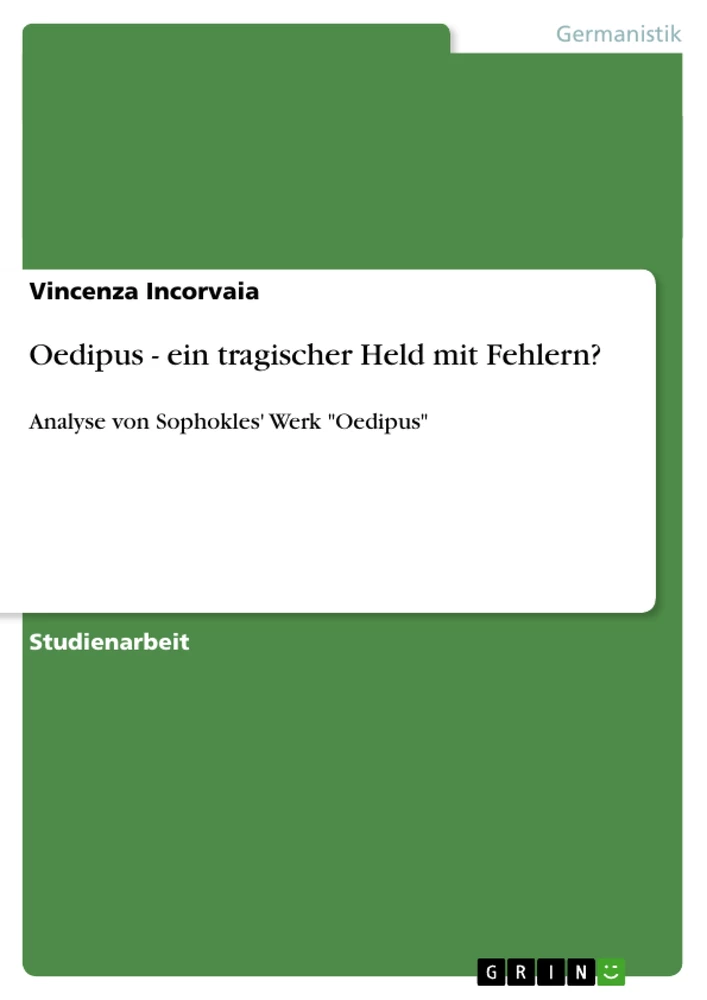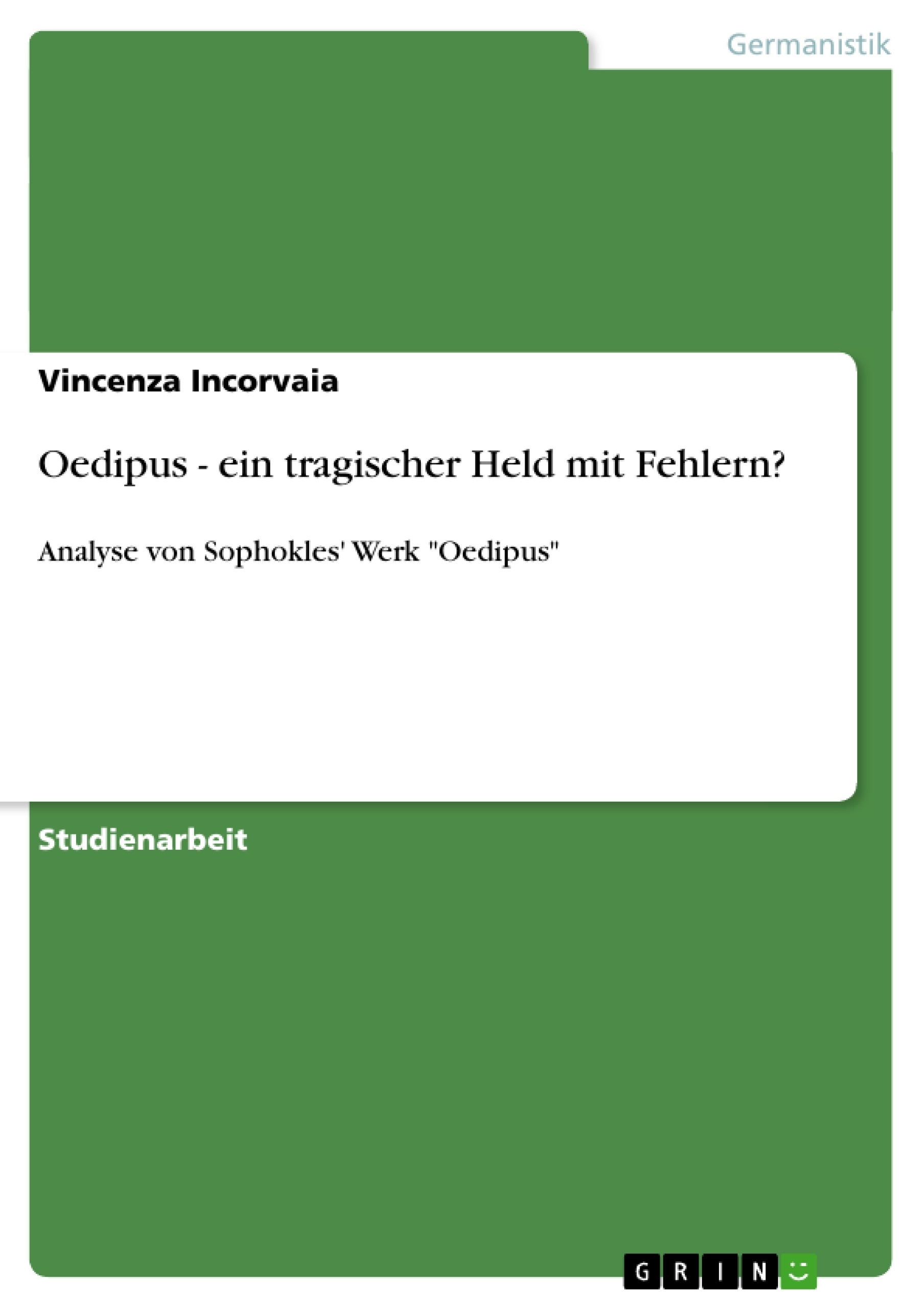Mit Ödipus hat Sophokles ein Werk geschaffen, das den Zuschauer bzw. den Leser vor die spannende Frage nach der Schuld bzw. der Unschuld des Protagonisten stellt.
Diese Diskussion besteht seit jeher und wird vermutlich nie enden, da es keine richtige Antwort gibt.
Ob man Ödipus nun für schuldig bzw. für nicht schuldig erklärt, ist davon abhängig, worin man die Ursache für das Unglück des tragischen Helden sucht. Sieht man die Gründe für das „menschliche Unglück“ in dem Handeln der Figur oder stürzt sie hauptsächlich durch das Schicksal bzw. durch Fremdeinwirkung in ihr Unglück?
Ist Ödipus' Blindheit und Selbstüberschätzung Schuld an seinem Schicksal oder ist er einfach das Opfer des Schicksals, das für ihn bestimmt war?1
Diese Arbeit basiert auf Aristoteles Meinung, dass ganz bestimmte Merkmale notwendig sind, um eine gute Tragödie zu schaffen.2 Aus diesen Merkmalen ergibt sich nämlich die Tragödie als „rein menschliches Geschehen“.3 Es ist keine Interpretation des gesamten Werkes vorgesehen, sondern die Betrachtung einiger Situationen, die aufzeigen, inwiefern Ödipus dem tragischen Helden nach Aristoteles entspricht. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht auch die Frage, inwiefern Ödipus selbst Schuld an seinem Schicksal trägt und welche Charaktereigenschaften für sein Scheitern von Bedeutung sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aristoteles' Poetik
- Oedipus Charaktereigenschaften
- Blindheit
- Ödipus Selbstüberschätzung
- Fazit
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse von Sophokles' Werk „Ödipus“, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob der Protagonist schuldig oder unschuldig ist. Der Fokus liegt dabei auf Aristoteles' Poetik und der Frage, inwiefern Ödipus dem tragischen Helden nach Aristoteles entspricht. Zudem wird untersucht, inwieweit Ödipus selbst Schuld an seinem Schicksal trägt und welche Charaktereigenschaften für sein Scheitern von Bedeutung sind.
- Analyse von Ödipus' Schuld und Unschuld
- Betrachtung von Ödipus im Kontext der Aristoteles' Poetik
- Untersuchung von Ödipus' Charaktereigenschaften
- Erforschung der Rolle von Blindheit und Selbstüberschätzung im Schicksal von Ödipus
- Beurteilung des Einflusses von Schicksal und Fremdeinwirkung auf Ödipus' Unglück
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und beleuchtet die Problematik der Schuld und Unschuld des Protagonisten Ödipus. Die Frage nach der Ursache für Ödipus' Unglück wird aufgeworfen: Ist es sein Handeln, das Schicksal oder eine Kombination aus beidem?
Aristoteles' Poetik
Dieses Kapitel befasst sich mit Aristoteles' Definition der Tragödie und stellt die „rein menschlichen Geschehnisse“ in den Vordergrund. Es wird aufgezeigt, wie Aristoteles' Poetik die Tragödie als „Umschlag vom Glück ins Unglück“ beschreibt und Ödipus als Beispiel für diese Theorie herangezogen wird.
Oedipus Charaktereigenschaften
Blindheit
In diesem Abschnitt wird Ödipus' Blindheit und ihr Zusammenhang mit der Tragödie analysiert. Die Szene mit Theresias wird beleuchtet, in der Sophokles die Vertauschung von Sehendem und Blinden inszeniert. Ödipus' „Mangel an Hellhörigkeit“ wird aufgezeigt, da er trotz eindeutiger Hinweise auf seine wahren Eltern die Wahrheit nicht wahrhaben will. Die Blindheit wird als eine Art metaphorische und körperliche Eigenschaft dargestellt, die Ödipus seinen Fehlern gegenüber blind macht.
Ödipus Selbstüberschätzung
Hier wird Ödipus' Selbstüberschätzung im Kontext seiner Intelligenz und seines Ruhms als Retter Thebens betrachtet. Sein übereiltes Urteilen wird beleuchtet und die Frage gestellt, ob sein Ansehen als „Rästellöser“ zu einer falschen Selbstsicherheit geführt hat.
- Citation du texte
- Vincenza Incorvaia (Auteur), 2009, Oedipus - ein tragischer Held mit Fehlern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187938