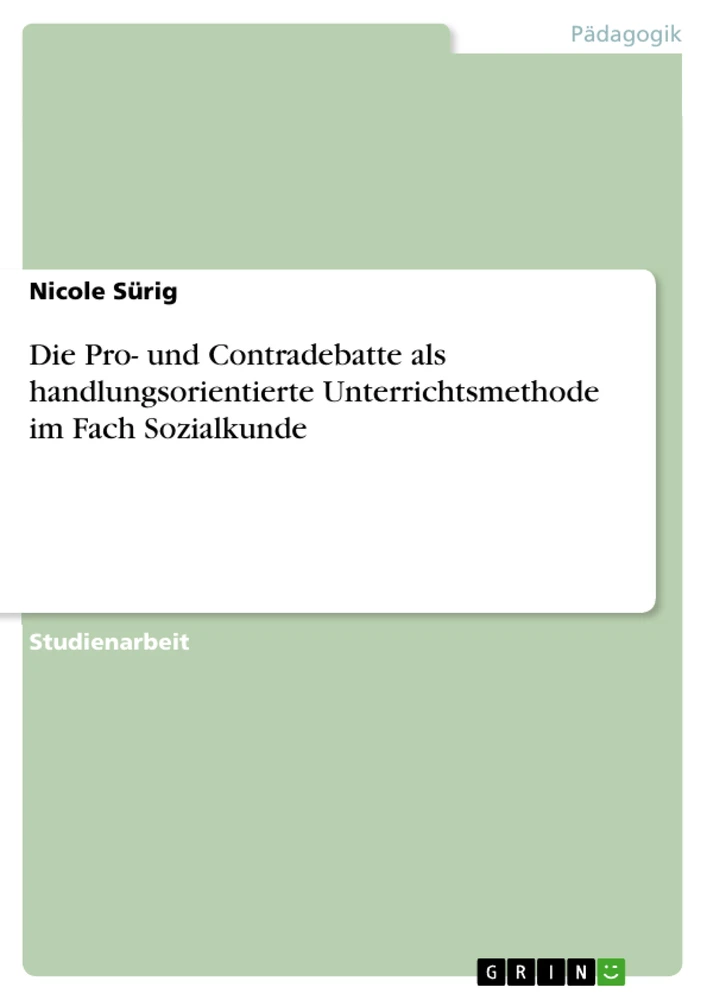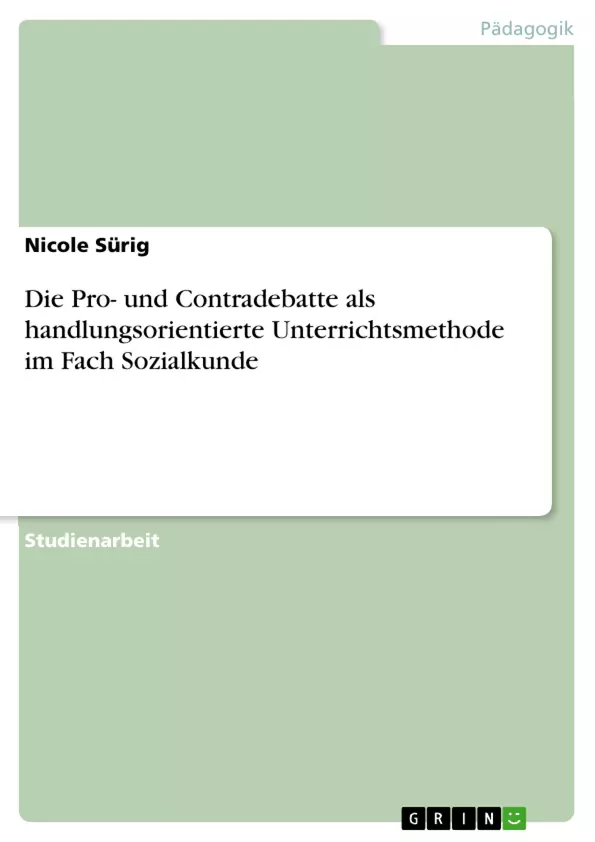Das Unterrichtsfach Sozialkunde, beziehungsweise auch Politikunterricht genannt, leistet einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der individuellen Leistungsfähigkeit, da die Schüler durch Handlungsorientierung von passivem zu aktivem, gestaltendem Handeln ermutigt werden. So wird hierbei auch der Schwerpunkt auf die Entwicklung von Personal- und Sozialkompetenz gesetzt. Durch diese sollen die Schüler lernen, Konflikte partnerschaftlich und gewaltfrei zu bewältigen.
Im Sozialkundeunterricht wiederholen die Schüler fachspezifische Methoden, lernen neue kennen und wenden sie an um diese Konfliktsituationen lösen zu können. So auch die Methode der Pro- und Contradebatte, die neben anderen handlungsorientierten Unterrichtsmethoden, wie zum Beispiel Projekte, Erkundungen, Fallanalysen und Rollenspiele, eine zentrale Position im Sozialkundeunterricht einnimmt. Die Pro- und Contradebatte setzt den Schwerpunkt des Unterrichts darauf, die subjektiven Interessen der Schüler zu polarisieren und motiviert gleichzeitig zum eigenverantwortlichen und selbstständigen Handeln.
Definitionsgemäß, ist die Pro- und Contradebatte eine hoch formalisierte, an strengen Regeln orientierte Methode für den Politikunterricht, die vor allem einen Beitrag zur rationalen politischen Urteilsbildung leisten soll. Sie unterscheidet sich deutlich von Unterrichtsgesprächen und Diskussionen im Unterricht und ist deshalb von diesen abzugrenzen. Im Unterrichtsgespräch geht es vor allem, um die Beantwortung von Fragen, um die Problematisierung von Sachverhalten und über das vertiefende Nachdenken in Bezug auf ein gegebenes Thema. So sollen die Schüler im Unterrichtsgespräch erst mit dem Thema vertraut gemacht werden. Die Diskussion dagegen setzt diese Vertrautheit schon voraus, denn im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung. Diskussionen sind in der Regel offen und müssen zeitlich nicht begrenzt sein.
Die Pro- und Contradebatte ist hingegen strenger geregelt. Sie ist zeitlich befristet und kann als Streitgespräch auf gehobenem Niveau verstanden werden. Es geht darum, unterschiedliche Positionen klar herauszuarbeiten, gegensätzliche Meinungen zu äußern, zu vertreten und zu begründen, sie vergleichend gegenüberzustellen und durch eine Abstimmung eine formale Entscheidung herbeizuführen.....
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte der Pro- und Contradebatte
- Zum Stellenwert der Pro- und Contradebatte
- Planung einer Pro- und Contradebatte
- Grundlegende Entscheidungen
- Einteilung der Beteiligten in Gruppen
- Formen der Pro- und Contradebatte
- Erste Form der Debattenführung
- Zweite Form der Debattenführung
- Die Amerikanische Debatte
- Die Pro- und Contradebatte am Beispiel
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Pro- und Contradebatte als handlungsorientierte Unterrichtsmethode im Fach Sozialkunde. Sie beleuchtet die Geschichte der Debattenkultur, ihren Stellenwert im Unterricht und die verschiedenen Formen der Debattenführung. Darüber hinaus werden Planungsschritte für die Durchführung einer Pro- und Contradebatte im Detail erläutert.
- Die Entwicklung der Pro- und Contradebatte im historischen Kontext
- Die Bedeutung der Pro- und Contradebatte für die Entwicklung von Kompetenzen im Sozialkundeunterricht
- Die verschiedenen Formen der Pro- und Contradebatte
- Planung und Durchführung einer Pro- und Contradebatte im Unterricht
- Die Pro- und Contradebatte als Methode zur Förderung von politischer Urteilsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Pro- und Contradebatte als eine zentrale Methode im Sozialkundeunterricht vor und hebt ihre Bedeutung für die Entwicklung von Handlungskompetenz und die Förderung der Konfliktlösungskompetenz hervor. Die Methode wird in ihrer Bedeutung für das politische Lernen und die Entwicklung von Urteilsfähigkeit erläutert. Sie grenzt sich deutlich von Unterrichtsgesprächen und Diskussionen ab.
Geschichte der Pro- und Contradebatte
Dieses Kapitel beleuchtet die lange Tradition von Debatten im angelsächsischen Kulturraum. Es geht auf den Einfluss des Liberalismus und die Bedeutung der Meinungsfreiheit für die Entwicklung der Debattenkultur ein. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Debatten im englischen Parlament, im "Speaker's Corner" im Hydepark London und im schulischen Kontext in Großbritannien und den USA.
Zum Stellenwert der Pro- und Contradebatte
Dieser Abschnitt behandelt die Bedeutung der Pro- und Contradebatte für den Sozialkundeunterricht. Er erläutert, wie die Methode zur Entwicklung von Kompetenzen wie Kreativität, Schlagfertigkeit, Toleranz und Humor beiträgt. Außerdem wird die Rolle der Pro- und Contradebatte für die Förderung von kritischem Denken und der Fähigkeit zur argumentativen Auseinandersetzung hervorgehoben.
Planung einer Pro- und Contradebatte
Das Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Planungsschritten, die bei der Durchführung einer Pro- und Contradebatte im Unterricht zu beachten sind. Es werden grundlegende Entscheidungen, wie die Themenwahl und die Festlegung von Regeln, sowie die Einteilung der Schüler in Gruppen behandelt.
Schlüsselwörter
Pro- und Contradebatte, Sozialkundeunterricht, Politikunterricht, Handlungsorientierung, Konfliktlösung, politische Urteilsbildung, Debattenkultur, Meinungsfreiheit, argumentative Auseinandersetzung, strategisches Denken, taktische Überlegungen, methodisches Vorgehen, Planung, Durchführung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel der Pro- und Contradebatte im Sozialkundeunterricht?
Das Ziel ist die Förderung der rationalen politischen Urteilsbildung sowie der Ausbau der Personal- und Sozialkompetenz der Schüler durch aktives Handeln.
Wie unterscheidet sich die Debatte von einem normalen Unterrichtsgespräch?
Während das Unterrichtsgespräch der Einführung in ein Thema dient, ist die Pro- und Contradebatte hoch formalisiert, folgt strengen Regeln, ist zeitlich begrenzt und zielt auf eine formale Entscheidung ab.
Welche Kompetenzen werden durch diese Methode besonders gefördert?
Die Schüler entwickeln Kreativität, Schlagfertigkeit, Toleranz, kritisches Denken und die Fähigkeit, gegensätzliche Meinungen argumentativ zu vertreten.
Was ist die „Amerikanische Debatte“?
Es handelt sich um eine spezifische Form der Debattenführung, die im Text als eine der Varianten neben klassischen europäischen Modellen vorgestellt wird.
Welchen historischen Ursprung hat die Debattenkultur?
Die Methode hat eine lange Tradition im angelsächsischen Raum, beeinflusst durch das britische Parlament und die Tradition der Redefreiheit (z.B. Speaker's Corner).
- Arbeit zitieren
- Studienrätin Nicole Sürig (Autor:in), 2006, Die Pro- und Contradebatte als handlungsorientierte Unterrichtsmethode im Fach Sozialkunde, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188031