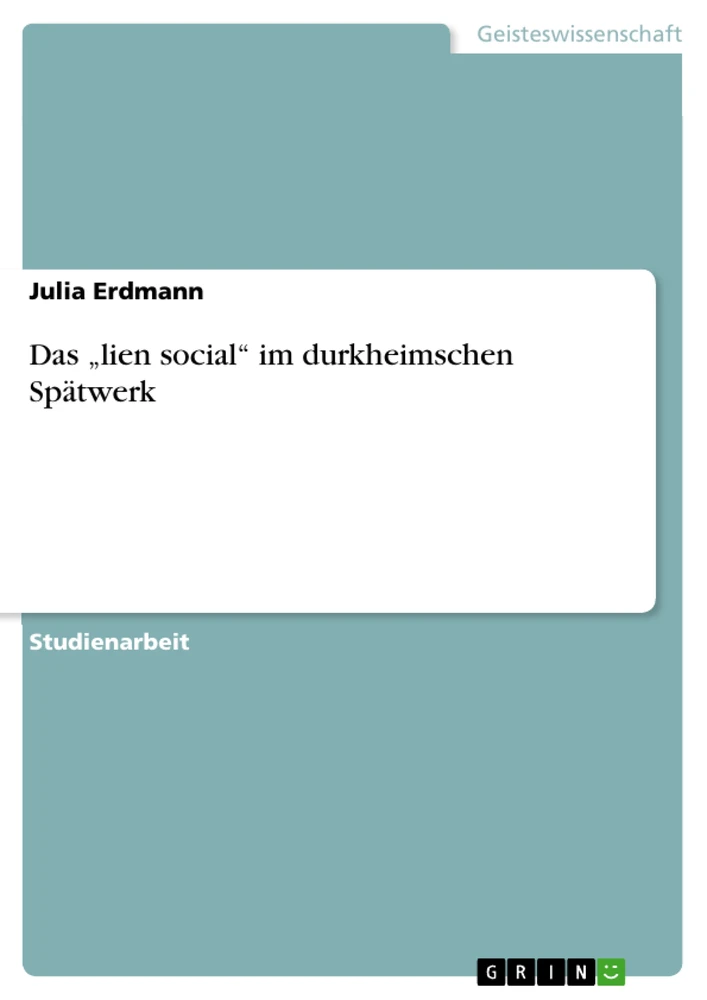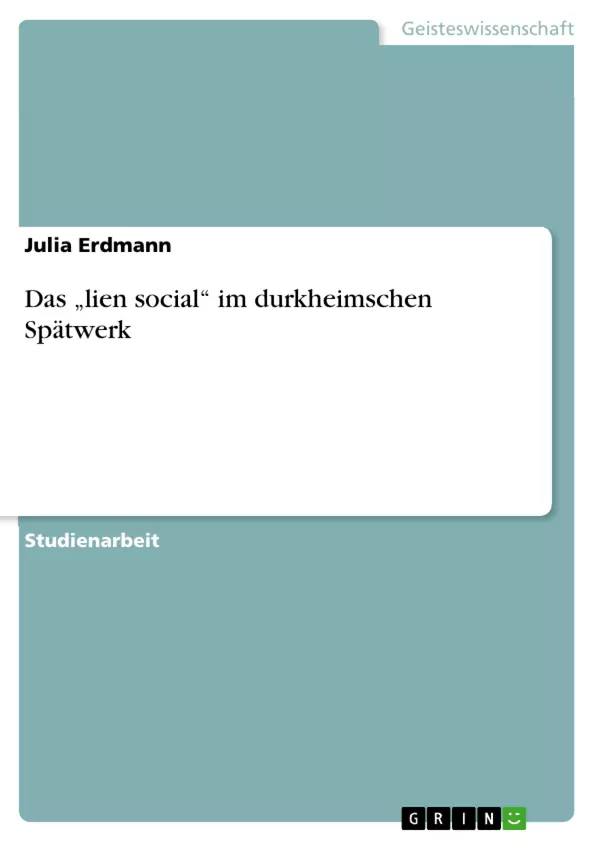Die Hinwendung Emile Durkheims (1858 – 1917) zur Religion wird oft als „kulturelle Wende“ (Alexander zit. n. Müller 2003, S. 162) in seinem Werk bezeichnet, als eine Entwicklung vom „strukturellen zum kulturellen Durkheim“ (Müller 2003, S. 170). Doch damit ist keinesfalls gemeint, dass Durkheim 1912 mit der Veröffentlichung seines Bu-ches „Die elementaren Formen des religiösen Lebens“ „plötzlich die Religion entdeckt und sie als allmächtigen Erklärungsfaktor etabliert hätte“ (Müller 2003, S. 170), vielmehr spielt sie in einigen seinen vorherigen Werken, wie im „Selbstmord“ , der schon 1897 erschien, oder „Über soziale Arbeitsteilung“ aus dem Jahr 1893, bereits eine große Rolle als wichtige Erklärungsgröße. Der Grund für die Hinwendung Durkheims zur Ergründung des Wesens der Religion war zum einen seine Begeisterung für bekannte Religionswissenschaftler seiner Zeit, wie Sir James G. Frazer oder William Robertson Smith. Zum anderen die Erarbeitung einer Grundlage für das später geplante genauere Studium der modernen Moral und Kultur. Doch auf Grund seines frühen Todes 1917 war ihm diese detaillierte Untersuchung des Moralkomplexes und die Entwicklung vom „moralischen Kollektivismus […] [hin zum] Individualismus“( Müller 2003, S. 163) nicht mehr möglich.
Dennoch versucht Durkheim in seiner Auseinandersetzung mit der primitiven Religion der australischen Stammesgesellgesellschaften noch einmal die Antwort auf die Frage zu finden, was die Gesellschaft zusammenhält. Seine Erkenntnisse über die mechanische und organische Solidarität als Bindeglieder der Gesellschaft aus dem Jahr 1893 scheinen ihm fast 20 Jahre später nicht mehr zu genügen. Was er auf Basis der Erkenntnisse seines Werkes „Die elementaren Formen des religiösen Lebens“ und den Gedankengängen aus einem früheren Aufsatz zum Thema Individualismus letztlich als das „lien social“ (Durk-heim zit. n. Koenig 2008, S. 7) – das soziale Band – das die Gesellschaft zusammenhält, identifiziert, und wie er es auf die Gesellschaft seiner Zeit überträgt, soll in dieser Arbeit offen gelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Gedanken
- Allgemeine Begriffsklärung
- Die durkheimsche religionssoziologische Studie
- Der historische Kontext
- Ausgangspunkte der Studie
- Die Untersuchung des Totemismus australischer Volksstämme
- Fazit der gewonnenen Erkenntnisse über Religion
- Der Ursprung der Moral in der Religion
- Abschließende Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, Durkheims späte Hinwendung zur Religion und die Frage nach dem „lien social“ – dem sozialen Band – im Kontext seiner religionssoziologischen Studie „Die elementaren Formen des religiösen Lebens“ zu analysieren. Die Arbeit untersucht, wie Durkheim, ausgehend von der primitiven Religion australischer Stammesgesellschaften, die Gesellschaft zusammenhält und seine Erkenntnisse auf die Gesellschaft seiner Zeit überträgt.
- Durkheims „kulturelle Wende“ und die Hinwendung zur Religionssoziologie
- Die Bedeutung der Religion für die Moral und das gesellschaftliche Zusammenleben
- Der Begriff des „lien social“ und seine Bedeutung für die gesellschaftliche Integration
- Die Rolle des Totemismus in der Entstehung von Religion und Moral
- Durkheims Analyse der mechanischen und organischen Solidarität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die Durkheims Hinwendung zur Religion als eine "kulturelle Wende" in seinem Werk darstellt und die zentrale Fragestellung der Arbeit nach dem "lien social" einführt.
Im zweiten Kapitel werden die zentralen Begriffe der Arbeit, wie Religionssoziologie, Religion und Moral, geklärt. Hier wird Durkheims spezifische Definition von Religion als ein System von Glaubensvorstellungen und Riten, das eine Unterscheidung zwischen profanen und heiligen Dingen beinhaltet, hervorgehoben. Die Moral wird als ein System von sanktionsbewehrten Verhaltensregeln definiert, das der Gesellschaft Orientierung und Stabilität verleiht.
Das dritte Kapitel befasst sich mit Durkheims religionssoziologischer Studie "Die elementaren Formen des religiösen Lebens". Es werden der historische Kontext, die Ausgangspunkte der Studie und die Untersuchung des Totemismus australischer Volksstämme beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind Religionssoziologie, Religion, Moral, "lien social", Totemismus, mechanische Solidarität, organische Solidarität, Primitive Gesellschaften, Emile Durkheim, "Die elementaren Formen des religiösen Lebens".
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „lien social“ bei Durkheim?
„Lien social“ bezeichnet das soziale Band, das eine Gesellschaft zusammenhält und die Individuen in eine moralische Gemeinschaft integriert.
Warum wandte sich Durkheim in seinem Spätwerk der Religion zu?
Er sah in der Religion die Urform aller sozialen Organisation und Moral. Durch das Studium „primitiver“ Religionen (Totemismus) wollte er die elementaren Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenhalts verstehen.
Was ist der Unterschied zwischen mechanischer und organischer Solidarität?
Mechanische Solidarität herrscht in traditionellen Gesellschaften durch Ähnlichkeit der Individuen; organische Solidarität entsteht in modernen Gesellschaften durch Arbeitsteilung und gegenseitige Abhängigkeit.
Wie definiert Durkheim „Religion“?
Für Durkheim ist Religion ein solidarisches System von Glaubensvorstellungen und Riten, die sich auf heilige Dinge beziehen und eine moralische Gemeinschaft (Kirche) bilden.
Welche Rolle spielt der Totemismus in seiner Studie?
Durkheim untersuchte den Totemismus australischer Stämme, um zu zeigen, dass das heilige Objekt (der Totem) letztlich ein Symbol für die Gesellschaft selbst ist, die im Ritual verehrt wird.
Was versteht Durkheim unter der Unterscheidung von „profan“ und „heilig“?
Dies ist die fundamentale Klassifizierung religiösen Denkens. Heilige Dinge sind geschützt und abgesondert, während profane Dinge den gewöhnlichen, alltäglichen Bereich betreffen.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Julia Erdmann (Author), 2011, Das „lien social“ im durkheimschen Spätwerk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188049