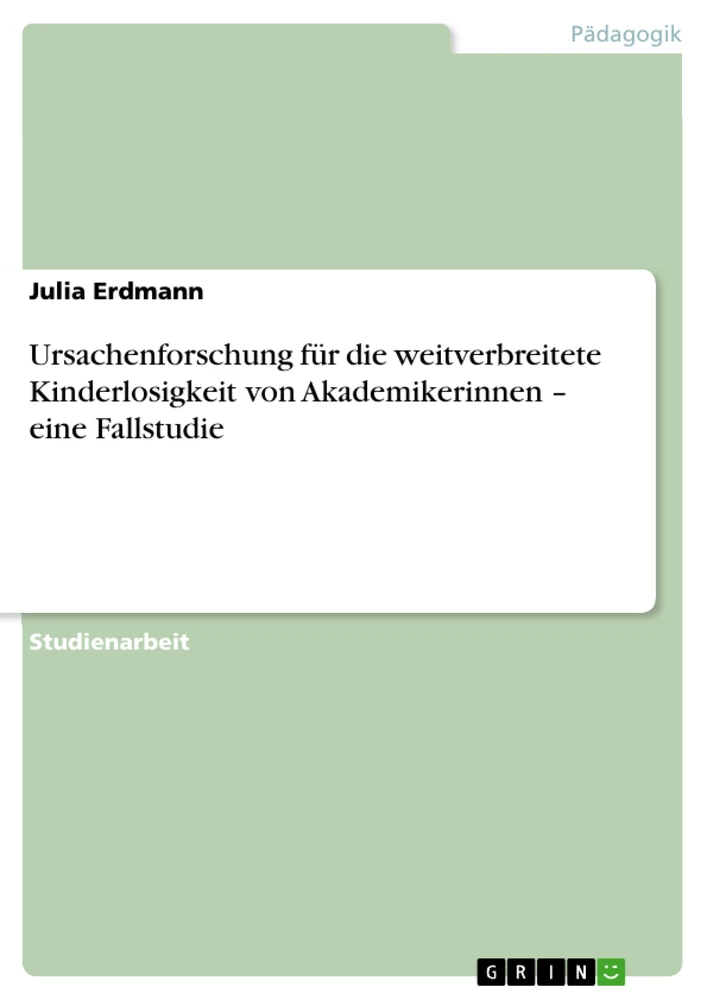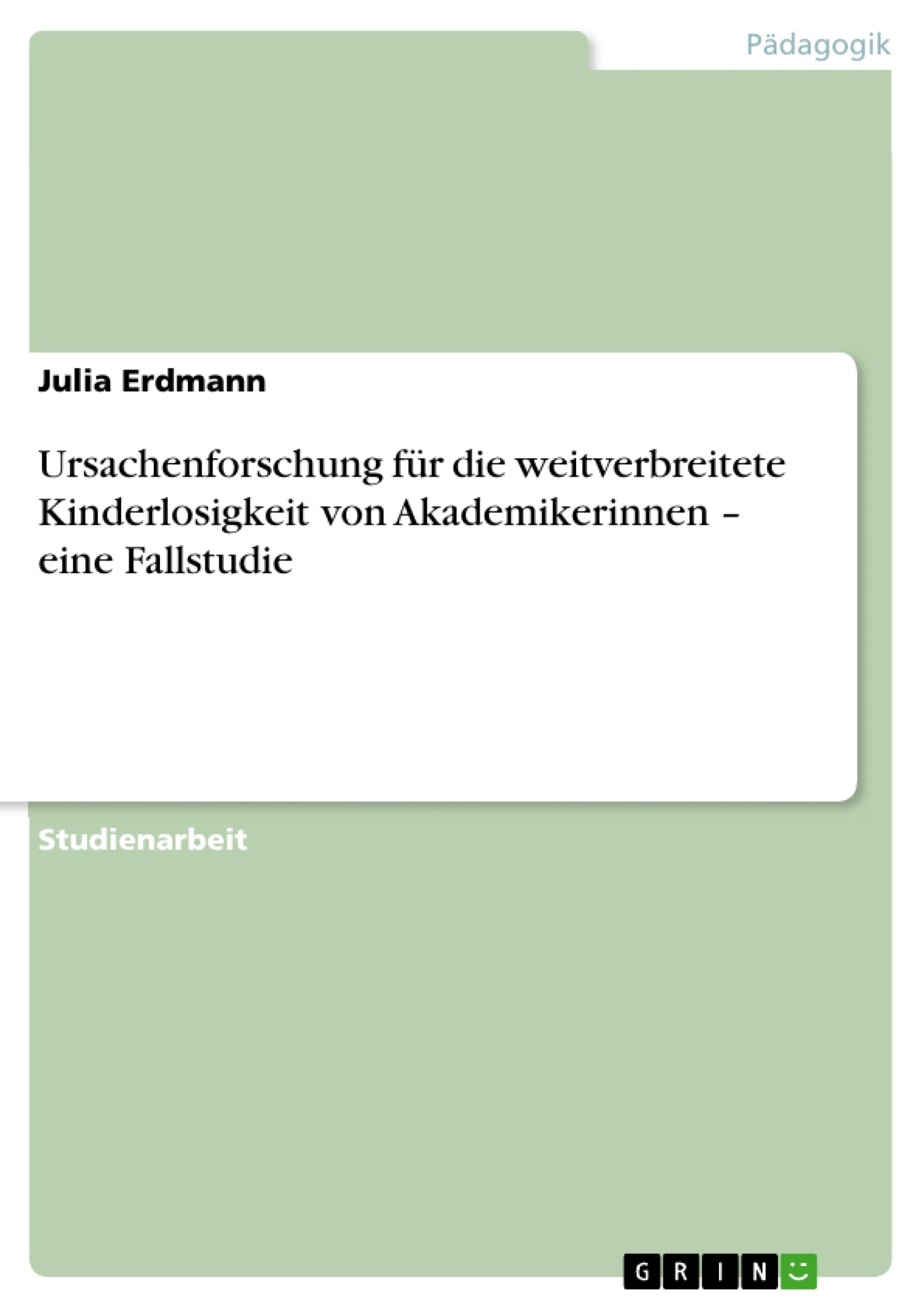Seit 1972 werden in der Bundesrepublik Deutschland weniger Kinder geboren, als Menschen sterben. Die Geburtenrate liegt unter dem Reproduktionsniveau der Bevölkerung und ohne Zuwanderung würde die deutsche Bevölkerung zunehmend schrumpfen. Seit Beginn der 80er Jahre ist die wachsende Kinderlosigkeit ein Grund für die niedrigen Geburtenzahlen. Während vom Geburtsjahrgang 1950 nur lediglich 15% aller Frauen zeitlebens kinderlos blieben, wird für den Geburtsjahrgang 1965 prognostiziert, das jede dritte Frau kinderlos bleibt. Insbesondere Akademikerinnen sind von diesem Trend mit deutlich steigender Tendenz betroffen. „40% der Akademikerinnen haben und wollen auch keine Kinder “(Lehmann 2003, S. 10). Der Anteil der dauerhaft kinderlosen Frauen ist im Bereich der sehr gut gebildeten Akademikerinnen also deutlich höher als in sämtlichen anderen Berufsgruppen.
Es stellt sich deshalb die Frage, warum gerade diese Gruppe von Frauen von einer derartig hohen Rate an Kinderlosigkeit betroffen ist. Wirtschaftliche Gründe kommen dafür eher nicht in Betracht, da Akademikerinnen in der Regel zu den deutlich besser verdienenden Bevölkerungsschichten zählen. Die Ursachen müssen folglich anders gelagert sein und bedürfen einer genaueren Untersuchung und Ergründung.
Anhand einer qualitativen Fallstudie an der Universität Erlangen-Nürnberg im Auftrag des Lehrstuhls für Organisationspädagogik soll den Ursachen für dieses Phänomen auf den Grund gegangen werden. Dabei steht im Mittelpunkt der Untersuchung die Frage, ob organisationelle Barrieren seitens der Universität vorliegen, die die Verwirklichung des Kinderwunsches beeinträchtigen oder sogar verhindern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitende Gedanken zur Brisanz des ausgewählten Forschungsgegenstandes
- 2. Die wichtigsten Ausgangspunkte für die geplante Forschung
- 2.1 Der Forschungsgegenstand
- 2.2 Die Formulierung der Forschungsfrage
- 2.3 Das Erkenntnisinteresse
- 2.4 Das Forschungsfeld
- 2.5 Ressourcen und Rahmenbedingungen
- 3. Methodologischer Rahmen
- 3.1 Die zur Verwendung kommenden Forschungsmethoden
- 3.2 Gründe für die Wahl der Forschungsmethoden
- 4. Der Weg zur Datenerhebung
- 4.1 Der Eintritt ins Feld
- 4.2 Die ausgewählte Auswertungsmethode
- 5. Abschließende Gedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, die Ursachen für die weitverbreitete Kinderlosigkeit von Akademikerinnen an der Universität Erlangen-Nürnberg zu ergründen. Die Untersuchung konzentriert sich auf die individuelle Entscheidungsfindung der Dozentinnen, insbesondere auf die Rolle von organisatorischen Faktoren im Vergleich zu persönlichen Beweggründen.
- Die steigende Kinderlosigkeit von Akademikerinnen im Kontext der demografischen Entwicklung in Deutschland
- Die Rolle von organisationalen Barrieren an der Universität Erlangen-Nürnberg bei der Verwirklichung des Kinderwunsches
- Die individuellen Beweggründe der Dozentinnen für oder gegen ein Kind
- Die Bedeutung von persönlichen Erfahrungen und Lebensentwürfen im Entscheidungsprozess
- Die Auswirkungen der Hochschulpolitik auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitende Gedanken zur Brisanz des ausgewählten Forschungsgegenstandes
Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Themas Kinderlosigkeit von Akademikerinnen im Kontext der niedrigen Geburtenrate in Deutschland. Es wird die besondere Problematik für Akademikerinnen hervorgehoben, da sie trotz ihrer hohen Bildung und finanziellen Ressourcen vermehrt kinderlos bleiben.
2. Die wichtigsten Ausgangspunkte für die geplante Forschung
Dieser Abschnitt stellt den Forschungsgegenstand, die Forschungsfrage und das Erkenntnisinteresse der Studie vor. Die Zielgruppe wird auf Dozentinnen an der Universität Erlangen-Nürnberg eingegrenzt. Die Auswahlkriterien für die neun zu untersuchenden Dozentinnen werden erläutert, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
3. Methodologischer Rahmen
Es werden die Forschungsmethoden vorgestellt, die zur Beantwortung der Forschungsfrage verwendet werden sollen. Der Abschnitt beinhaltet die Begründung für die Wahl der Methoden und deren Einsatz im Forschungsprozess.
4. Der Weg zur Datenerhebung
Dieser Teil beschreibt den Prozess der Datenerhebung und der Datenauswertung. Es werden die Schritte des Eintritts ins Feld und die gewählte Auswertungsmethode dargestellt.
5. Abschließende Gedanken
Dieser Abschnitt wird in der Vorschau nicht berücksichtigt, da er die Schlussfolgerungen der Forschungsarbeit enthält.
Schlüsselwörter
Akademikerinnen, Kinderlosigkeit, Universität Erlangen-Nürnberg, Hochschulpolitik, Familienpolitik, qualitative Forschungsmethoden, Fallstudie, Entscheidungsfindung, individuelle Beweggründe, organisationelle Barrieren, Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Häufig gestellte Fragen zur Kinderlosigkeit bei Akademikerinnen
Warum sind Akademikerinnen überdurchschnittlich oft kinderlos?
Während im Schnitt jede dritte Frau kinderlos bleibt, liegt die Quote bei Akademikerinnen bei etwa 40 %. Gründe liegen oft in organisationalen Barrieren und der schwierigen Vereinbarkeit von Karriere und Familie.
Spielen wirtschaftliche Gründe eine Rolle?
Eher nein, da Akademikerinnen meist zu den besserverdienenden Schichten gehören. Die Ursachen sind eher in der Struktur des Beschäftigungssystems und persönlichen Lebensentwürfen zu suchen.
Welche organisationalen Barrieren gibt es an Universitäten?
Dazu zählen unsichere Beschäftigungsverhältnisse, hoher Publikationsdruck und fehlende flexible Betreuungsmöglichkeiten innerhalb des Hochschulbetriebs.
Was ist das Ziel der Fallstudie an der Universität Erlangen-Nürnberg?
Die qualitative Studie untersucht mittels Interviews mit Dozentinnen, ob universitäre Strukturen den Kinderwunsch aktiv beeinträchtigen oder verhindern.
Wie hat sich der Trend zur Kinderlosigkeit historisch entwickelt?
Beim Geburtsjahrgang 1950 blieben nur 15 % kinderlos; beim Jahrgang 1965 wird bereits prognostiziert, dass jede dritte Frau zeitlebens ohne Kind bleibt.
- Citar trabajo
- Bachelor of Arts Julia Erdmann (Autor), 2010, Ursachenforschung für die weitverbreitete Kinderlosigkeit von Akademikerinnen – eine Fallstudie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188053