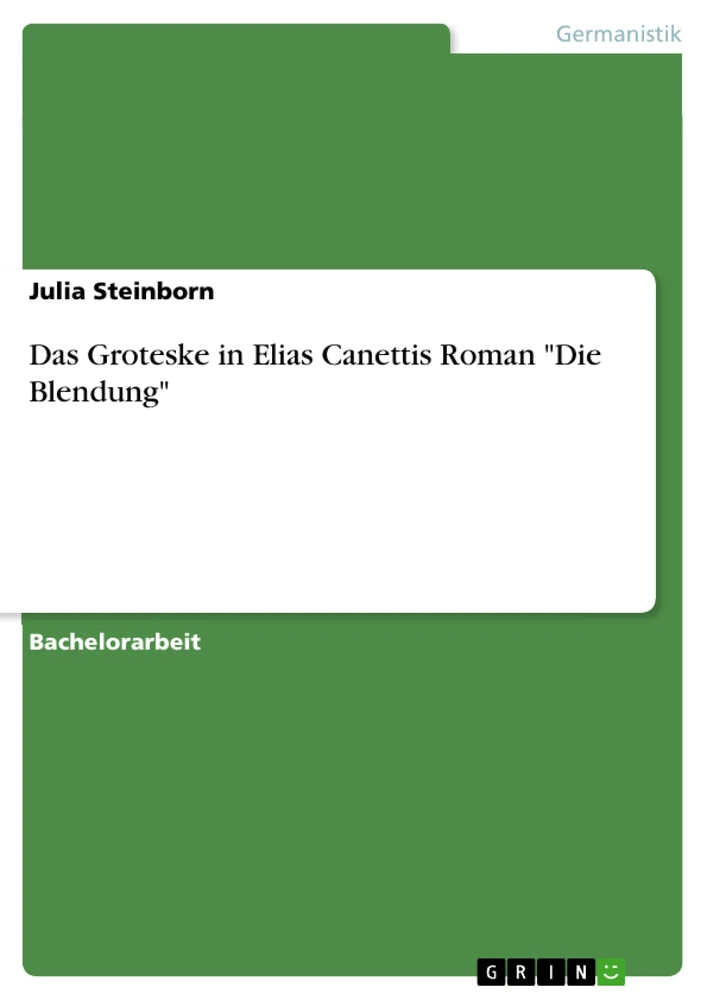Die wissenschaftliche Untersuchung des Grotesken in der speziellen Anwendung auf einen Roman – und in diesem Fall auf Elias Canettis „Die Blendung“ – lässt bereits zu Beginn zwei wesentliche Probleme erkennen: Zum einen existiert in der Literaturwissenschaft derzeit noch keine allgemeingültige Definition des Grotesken, sodass die Quellenlage umfassend, aber keineswegs eindeutig ist. Zum anderen ist die Beschäftigung mit Canettis Werken ein relativ junges Terrain und kann trotz der wachsenden Zahl an Aufsätzen und Besprechungen nicht als einheitlich angesehen werden. Eine Untersuchung der grotesken Mittel in der ‚Blendung‘ setzt demnach eine klare Struktur der theoretischen und praktischen Analyse und Definitionsgebung voraus. Aus diesem Grund wird diese Arbeit zu Beginn die Forschungslage um den Begriff des Grotesken vorstellen, um schließlich eine für die Untersuchung gültige Definition zu entwickeln. Unterstützt wird dies durch eine dreiteilige Gliederung: Im Kapitel 2.1 wird der Aspekt der Lesererwartung und Enttäuschung näher beleuchtet, in 2.2 das Verhältnis zwischen Komik und Grauen geklärt und im Abschnitt 2.3 werden die Begriffe ‚Normalität‘, ‚Wahnsinn‘ und ‚das Hässliche‘ definiert. An dieser theoretischen Grundlage orientiert sich schließlich im Kapitel 3 die Untersuchung des Grotesken speziell am Werk „Die Blendung“.
Auch hier erfolgt eine Einteilung in drei Abschnitte. Zu Beginn werden die grotesken Elemente an den Figuren des Romans aufgezeigt, wobei der Schwerpunkt auf der Hauptfigur Peter Kien und den Nebenfiguren Therese Krumbholz, Benedikt Pfaff, Siegfried Fischerle und Georg Kien liegt. Anschließend werden im Kapitel 3.2 die Figurenhandlung und die Romanhandlung analysiert, um schließlich in ihrem Zusammenwirken betrachtet werden zu können. Den Abschluss bildet die Betrachtung der sprachlichen Ebene, die sowohl Figurensprache, Erzählsprache und Sachbezeichnungen, als auch die Erzählperspektive des Autors miteinschließt.
Ziel dieser Arbeit ist es, die grotesken Mittel in der ‚Blendung‘ nicht nur zu benennen, sondern auch ihren Einfluss aufeinander zu verdeutlichen. Es wird somit verständlich werden, warum man bei Elias Canettis Roman von einem grotesken Werk spricht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Groteske
- 2.1 Erwartung und Enttäuschung
- 2.2 Komik und Grauen
- 2.3 Normalität, Wahnsinn und das Hässliche
- 3 Das Groteske in „Die Blendung“
- 3.1 Figuren
- 3.1.1 Peter Kien
- 3.1.2 Georg Kien
- 3.1.3 Therese Krumbholz
- 3.1.4 Benedikt Pfaff
- 3.1.5 Siegfried Fischerle
- 3.1.6 Weitere Figuren
- 3.2 Groteske der Handlung
- 3.3 Bezeichnungen, Namen und Erzählsprache
- 4 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Groteske in Elias Canettis Roman „Die Blendung“ und zielt darauf ab, die grotesken Mittel in ihrer Vielfältigkeit und ihrem Einfluss aufeinander zu analysieren. Dabei werden die spezifischen Merkmale des Grotesken in Canettis Werk herausgearbeitet und es wird gezeigt, warum „Die Blendung“ als groteskes Werk bezeichnet werden kann.
- Analyse des Grotesken im Kontext der Literaturwissenschaft
- Anwendung des Grotesken in Elias Canettis „Die Blendung“
- Die Rolle grotesker Figuren und deren Interaktion in der Romanhandlung
- Die Sprache als Mittel der grotesken Darstellung
- Der Einfluss des Grotesken auf die Lesererwartung und die Interpretation des Romans
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Grotesken in Elias Canettis Roman „Die Blendung“ ein und beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Untersuchung dieses literarischen Phänomens verbunden sind.
Kapitel 2 befasst sich mit der Definition des Grotesken und beleuchtet verschiedene Aspekte dieses literarischen Stilmittels. Die Erwartung und Enttäuschung des Lesers, das Verhältnis von Komik und Grauen sowie die Konzepte von Normalität, Wahnsinn und Hässlichkeit werden im Detail betrachtet.
Kapitel 3 untersucht die Anwendung des Grotesken in „Die Blendung“. Zunächst werden die grotesken Elemente an den Figuren des Romans beleuchtet, mit besonderem Fokus auf die Hauptfigur Peter Kien und die Nebenfiguren Therese Krumbholz, Benedikt Pfaff, Siegfried Fischerle und Georg Kien. Anschließend werden die Figurenhandlung und die Romanhandlung in ihrer Gesamtheit analysiert.
Schlüsselwörter
Groteske, Elias Canetti, „Die Blendung“, Erwartung, Enttäuschung, Komik, Grauen, Normalität, Wahnsinn, Hässlichkeit, Figuren, Handlung, Sprache, Erzählperspektive
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Elias Canettis Roman „Die Blendung“?
Der Roman beschreibt den geistigen und physischen Verfall des weltfremden Sinologen Peter Kien, der durch seine eigene Isolation und die Bosheit seiner Mitmenschen in den Wahnsinn getrieben wird.
Was macht den Roman zu einem „grotesken“ Werk?
Die Mischung aus Komik und Grauen, die extremen, oft hässlichen oder wahnsinnigen Charaktere und die ständige Enttäuschung der Lesererwartungen sind zentrale groteske Mittel.
Wer ist die Hauptfigur Peter Kien?
Peter Kien ist ein bedeutender Sinologe, der in einer riesigen Bibliothek lebt, den Kontakt zur Realität verloren hat und schließlich an seinem eigenen Wahn zugrunde geht.
Welche Nebenfiguren tragen zum grotesken Charakter bei?
Figuren wie die Haushälterin Therese Krumbholz, der brutale Hausbesorger Benedikt Pfaff und der bucklige Siegfried Fischerle verkörpern verschiedene Aspekte des Hässlichen und Absurden.
Wie wird das Groteske auf sprachlicher Ebene umgesetzt?
Durch eine spezifische Erzählsprache, Sachbezeichnungen und eine Erzählperspektive, die die Verzerrung der Realität im Kopf der Figuren widerspiegelt.
- Quote paper
- Julia Steinborn (Author), 2011, Das Groteske in Elias Canettis Roman "Die Blendung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188083