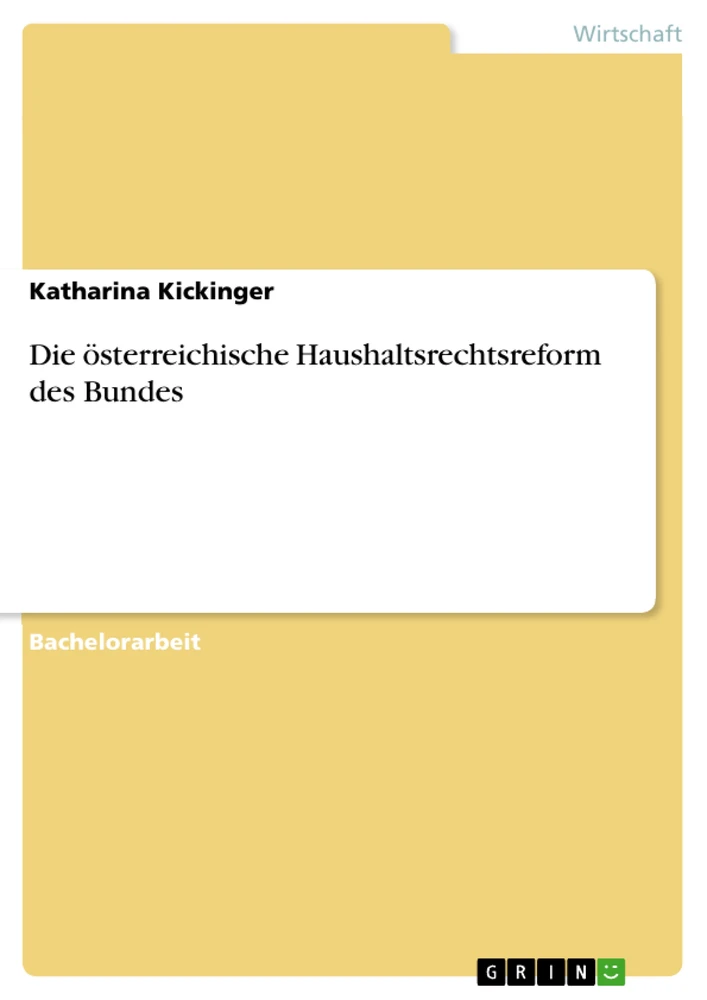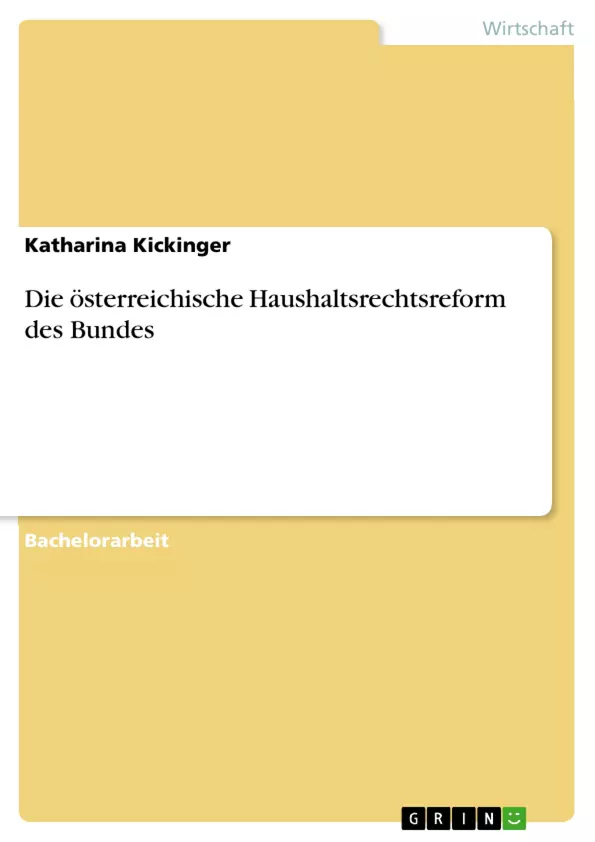Als das österreichische Parlament im Jahr 2007 und 2009 die Haushaltsrechtsreform des Bundes beschloss, war das Einführen der wirkungsorientierten Haushaltsführung, die im Mittelpunkt der Reform steht, bereits vorgesehen. Dies soll im Jahr 2013 implementiert werden. (vgl. Bundesministerium für Finanzen 2011b)
Der Grund für eine Erneuerung der Haushaltsführung liegt in der Vergangenheit.
Noch vor dem ersten Weltkrieg betrug die Staatsquote nur einen Bruchteil des Wertes, den sie heute hat (vorher 12% - heute knapp die Hälfte). Der Grund dafür ist, dass die Funktion des Staates damals nicht so erheblich war wie zum Beispiel die der Justiz. Einige Zeit später wurde der Staatseinfluss breiter. Dies spiegelte sich in Worten wie Wohlfahrtsstaat wieder und geschah vor allem zwischen den 50er und 80er Jahren. Klarerweise wurden ebenso die Budgets erhöht und deckten immer mehr Themen ab. Doch diese positive Auswirkung wurde schlecht umgesetzt (vgl. Universität Wien);
die Budgets waren inputorientiert, was soviel bedeutet, dass die getätigten Ausgaben für die Leistungen stehen, auch, wenn dies nicht so war. Darüber hinaus bediente man sich einer „bottom up“ – Budgetierung, welche zum „Inkrementalismus“ führte; das Gegenteil von Inkrementalismus ist eine programmorientierte Haushaltsführung.
Weiters wurde versucht, parallel zu den jährlichen Budgets, mittelfristige Orientierungshilfen zu führen. Dies blieb jedoch erfolglos. Orientiert man sich am „Gram-Rudman-Act“ in den USA, oder am „Schuldendeckel“ in Deutschland, so muss erwähnt werden, dass auch gesetzliche Beschränkungen bislang ohne Wirkung blieben.
Im Folgenden wird erklärt, wie die neue Haushaltsrechtsreform genau diesen Fehlern entgegen wirken soll und hoffentlich auch wird. (vgl. Weigel, 1992)
Inhaltsverzeichnis
- BAKKALAUREATSARBEIT
- EINLEITUNG
- DIE BUDGETRECHTSREFORM.
- ALLGEMEINES
- NEUERUNGEN
- AUFBAU DER HAUSHALTSRECHTSREFORM..
- Die erste Etappe der Haushaltsrechtsreform.............
- Die zweite Etappe der Haushaltsrechtsreform.
- Gender Budgeting.
- CONCLUSIO
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Haushaltsrechtsreform in Österreich und ihre Auswirkungen auf die öffentliche Finanzverwaltung. Sie analysiert die Hintergründe der Reform, die neuen Prinzipien der wirkungsorientierten Haushaltsführung und die konkrete Umsetzung in den verschiedenen Phasen der Reform.
- Die Entstehung der Haushaltsrechtsreform und die Notwendigkeit einer Veränderung in der österreichischen Budgetpolitik
- Die Einführung der wirkungsorientierten Haushaltsführung und ihre Bedeutung für eine effiziente Verwendung von Steuergeldern
- Die konkrete Umsetzung der Reform, insbesondere die Einführung des Bundesfinanzrahmengesetzes (BFRG) und die neuen Prinzipien der Mittelverwendung
- Die Auswirkungen der Reform auf die verschiedenen Bereiche der öffentlichen Verwaltung, wie z.B. die Ausgabenstruktur und die Entscheidungsfindung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die Entstehung der Haushaltsrechtsreform und die Notwendigkeit einer Veränderung in der österreichischen Budgetpolitik. Sie beleuchtet die Defizite der bisherigen inputorientierten Haushaltsführung und die Notwendigkeit einer stärkeren Fokussierung auf die Effizienz und Wirkung der staatlichen Ausgaben.
Das Kapitel "Die Budgetrechtsreform" befasst sich mit der umfassenden Reform des österreichischen Haushaltsrechts, die in zwei Etappen umgesetzt wird. Es werden die wichtigsten Neuerungen erläutert, darunter die Einführung des Bundesfinanzrahmengesetzes (BFRG), die wirkungsorientierte Haushaltsführung und das Prinzip des Gender Budgeting.
Schlüsselwörter
Haushaltsrechtsreform, Österreich, wirkungsorientierte Haushaltsführung, Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG), Gender Budgeting, Effizienz, Transparenz, Mittelverwendung, öffentliche Finanzverwaltung, Budgetpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der österreichischen Haushaltsrechtsreform?
Ziel ist die Einführung einer wirkungsorientierten Haushaltsführung, die weg von reiner Inputorientierung hin zu Effizienz, Transparenz und messbaren Ergebnissen führt.
Was bedeutet wirkungsorientierte Haushaltsführung?
Es bedeutet, dass Budgets nicht mehr nur nach Ausgaben (Input) geplant werden, sondern nach den Zielen und Wirkungen, die mit dem Geld für die Gesellschaft erreicht werden sollen.
Was ist das Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG)?
Das BFRG ist ein zentrales Instrument der Reform, das einen verbindlichen mehrjährigen Rahmen für die Staatsausgaben festlegt, um eine mittelfristige Budgetplanung zu sichern.
Was versteht man unter Gender Budgeting?
Gender Budgeting ist ein Prinzip der Reform, bei dem die Auswirkungen des Budgets auf die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern analysiert und gesteuert werden.
Warum war die alte Haushaltsführung ineffizient?
Das alte System war oft „bottom-up“ orientiert und führte zum Inkrementalismus, bei dem Budgets einfach fortgeschrieben wurden, ohne die tatsächliche Leistung oder Notwendigkeit zu hinterfragen.
- Arbeit zitieren
- Katharina Kickinger (Autor:in), 2012, Die österreichische Haushaltsrechtsreform des Bundes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188119