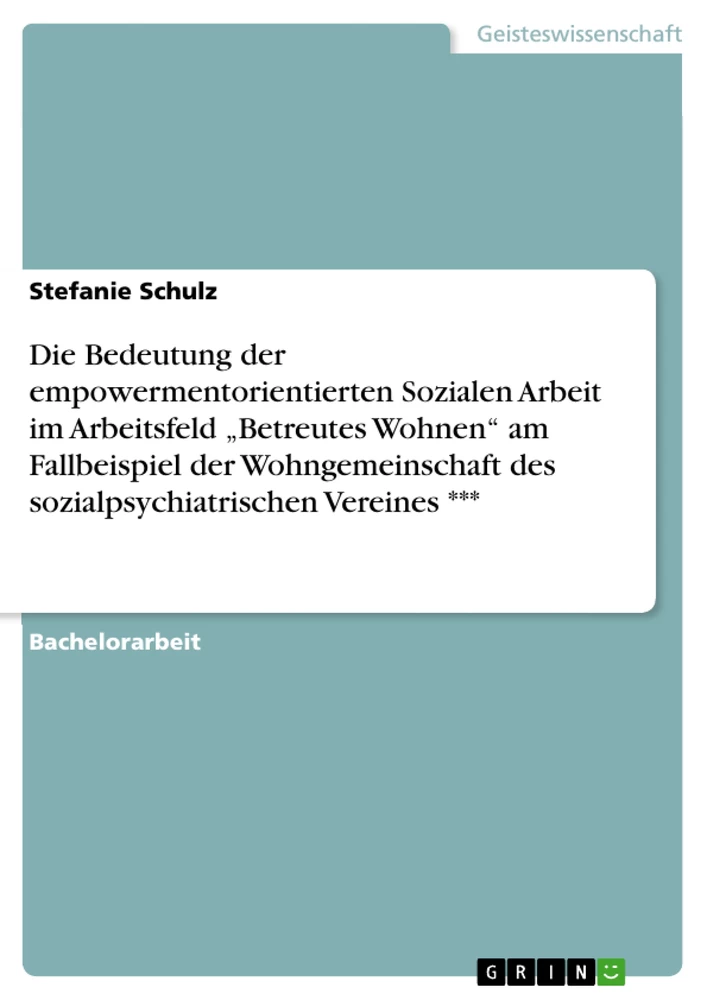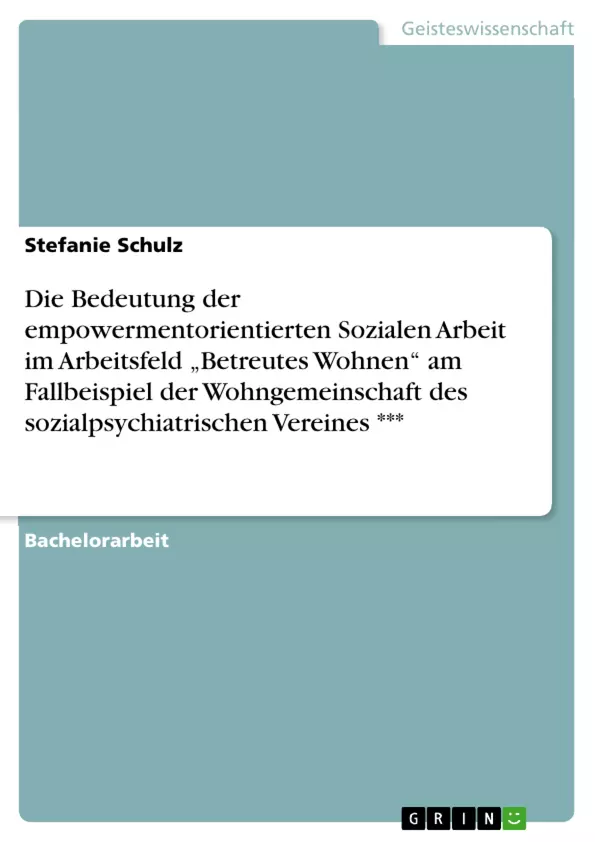Diese Bachelor-Arbeit setzt sich mit der Thematik „Die Bedeutung der empowermentorientierten sozialen Arbeit im Arbeitsfeld ‚Betreutes Wohnen‘ am Fallbeispiel der Wohngemeinschaft des sozialpsychiatrischen Vereins ***“ auseinander. Das Empowerment-Konzept findet in der psychosozialen Praxis eine hohe Resonanz, auch wenn das Konzept nicht die notwendigen wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen besitzt, um als fundierte Methodik anerkannt zu werden. Bei der Auseinandersetzung mit der Forschungsfrage „Wie werden Empowermentprozesse in der Wohngemeinschaft gefördert und welche Schwierigkeiten können sich daraus ergeben?“ werden verschiedene Methoden und Maßnahmen vorgestellt, mit denen die Mitarbeiter arbeiten, um den Bewohnern der Wohngemeinschaft ein höheres Maß an Selbstständigkeit und Verantwortung zu übertagen. Um die Forschungsfrage zu bearbeiten, werden Fachliteratur und ausgewählte Zielvereinbarungen in den IBRPs der Bewohner verwendet. Ziel der Arbeit ist es, anhand der Zielvereinbarung aus dem IBRPS und der Berufspraxis eine Verbindung zu dem theoretischen Fachwissen herzustellen. Hierbei wird der Fokus auf die Netzwerkarbeit, die Biografiearbeit, die Ressourcendiagnostik, dem Unterstützungsmanagement und der motivierenden Gesprächsführung gelegt. Es wird beschrieben, wie in der Wohngemeinschaft das Empowerment-Konzept durch die Mitarbeiter umgesetzt wird und wie die Arbeitsansätze verwendet werden, um Empowermentprozesse bei den Bewohnern zu aktivieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die empowermentorientierte Arbeitshaltung der Mitarbeiter eine große Bedeutung für die Entwicklung der Bewohner hat. Indem die Mitarbeiter dem Klienten Vertrauen in ihre Entscheidungen und Handlungskompetenzen entgegenbringen und ihm mehr Verantwortung übertragen, erlangen die Bewohner ein hohes Maß an Selbstständigkeit und besonders an Selbstvertrauen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. EMPOWERMENT
- 2.1. GESCHICHTLICHER HINTERGRUND
- 2.2. DEFINITION EMPOWERMENT
- 2.3. PHASENMODELL VON KIEFFER
- 2.4. EBENEN
- 2.5. ZUGÄNGE
- 2.6. EMPOWERMENT IN DER PSYCHOSOZIALEN PRAXIS
- 3. SOZIALPSYCHOLOGISCHE GRUNDLAGEN
- 3.1. ERLERNTE HILFLOSIGKEIT
- 3.2. SALUTOGENESE
- 3.3. RESSOURCENORIENTIERUNG
- 4. INSTITUTIONELLE FAKTOREN
- 4.1. DER SOZIALPSYCHIATRISCHE VEREIN
- 4.2. DEFINITION UND ZIEL DES BETREUTEN WOHNENS
- 4.3. ADRESSATEN
- 4.4. KRANKHEITSBILDER
- 4.5. WOHNFORMEN
- 4.6 ARBEITSWEISE DER BETREUER
- 5. FALLBEISPIEL „WOHNGEMEINSCHAFT ***“
- 5.1. ALLGEMEINE DATEN
- 5.1.1. DIE WOHNGEMEINSCHAFT
- 5.1.2. DIE BEWOHNER
- 5.2. FORSCHUNGSFRAGE
- 5.2.1. FÖRDERUNG VON EMPOWERMENTPROZESSEN IN DER WOHNGEMEINSCHAFT
- 5.2.2. MÖGLICHE SCHWIERIGKEITEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelor-Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der empowermentorientierten sozialen Arbeit im Arbeitsfeld „Betreutes Wohnen" am Beispiel der Wohngemeinschaft des sozialpsychiatrischen Vereins ***.
- Das Empowerment-Konzept in der psychosozialen Praxis
- Förderung von Empowermentprozessen in der Wohngemeinschaft
- Methoden und Maßnahmen der Mitarbeiter zur Steigerung der Selbstständigkeit und Verantwortung der Bewohner
- Verbindung von Theorie und Praxis anhand von Zielvereinbarungen im IBRPS
- Die Bedeutung der empowermentorientierten Arbeitshaltung der Mitarbeiter für die Entwicklung der Bewohner
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik der empowermentorientierten sozialen Arbeit im Arbeitsfeld „Betreutes Wohnen" einführt. Es wird auf das Empowerment-Konzept im Kontext der psychosozialen Praxis eingegangen und dessen Bedeutung für die Bewohner der Wohngemeinschaft hervorgehoben.
Im zweiten Kapitel wird das Empowerment-Konzept im Detail beleuchtet. Dazu werden die historische Entwicklung, Definition und Phasen des Konzepts erläutert. Zudem werden die verschiedenen Ebenen und Zugänge zum Empowerment dargestellt.
Kapitel 3 befasst sich mit den sozialpsychologischen Grundlagen des Empowerment-Konzepts. Hier werden die Konzepte der erlernten Hilflosigkeit, Salutogenese und Ressourcenorientierung vorgestellt und ihre Relevanz für die empowermentorientierte Arbeit im „Betreuten Wohnen" beleuchtet.
Das vierte Kapitel behandelt die institutionellen Faktoren im Kontext des Betreuten Wohnens. Es werden der sozialpsychiatrische Verein, die Definition und Zielsetzung des Betreuten Wohnens sowie die Zielgruppe, Krankheitsbilder, Wohnformen und Arbeitsweise der Betreuer beschrieben.
Kapitel 5 präsentiert das Fallbeispiel der Wohngemeinschaft ***. Die allgemeinen Daten der Wohngemeinschaft und der Bewohner werden vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Forschungsfrage, wie Empowermentprozesse in der Wohngemeinschaft gefördert werden und welche Schwierigkeiten sich dabei ergeben können.
Schlüsselwörter
Empowerment, Betreutes Wohnen, sozialpsychiatrischer Verein, Wohngemeinschaft, Empowermentprozesse, Selbstständigkeit, Verantwortung, Ressourcendiagnostik, Netzwerkarbeit, Biografiearbeit, Unterstützungsmanagement, motivierende Gesprächsführung.
- Quote paper
- Stefanie Schulz (Author), 2012, Die Bedeutung der empowermentorientierten Sozialen Arbeit im Arbeitsfeld „Betreutes Wohnen“ am Fallbeispiel der Wohngemeinschaft des sozialpsychiatrischen Vereines ***, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188142