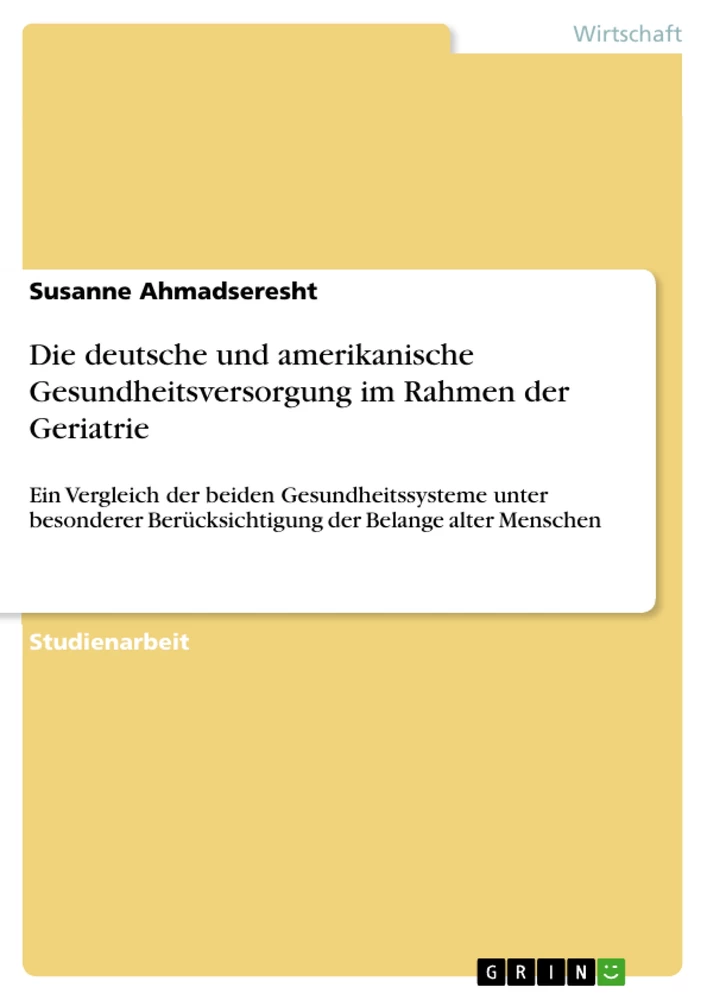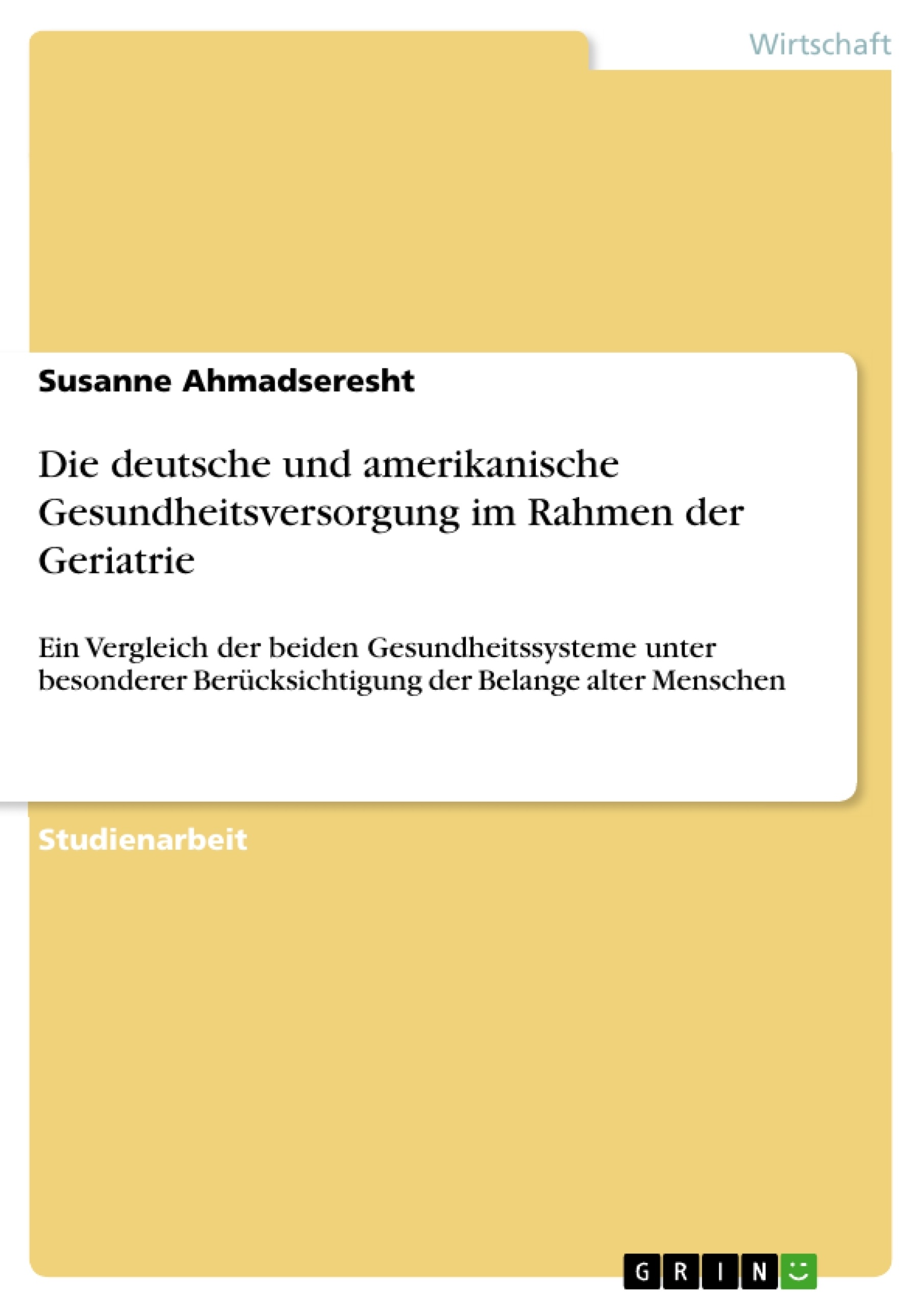In Deutschland, wie auch in allen übrigen OECD-Staaten ändert sich zunehmend die Alterstruktur der Bevölkerung. Die Geburtenraten sinken zum Teil dramatisch, während die allgemeine Lebenserwartung steigt. Dies stellt unser Gesundheitswesen vor eien große Herausforderung, denn ältere Menschen nehmen vermehrt Gesund-heitsleistungen in Anspruch und erzeugen höhere Kosten.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich zunächst zentralen Begriffe des Themas definieren und auf den demographischen Wandel und die gesellschaftlichen Ent-wicklungen in Deutschland eingehen. Daneben möchte ich die Problematik der Versorgung pflegebedürftiger Menschen darstellen. Im darauf folgenden Hauptteil werde ich sowohl das deutsche als auch das amerikanische Gesundheitssystem kurz skizzieren und diese miteinander vergleichen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Gesundheit und Krankheit
- Krankheitspanorama des geriatrischen Patienten
- Demographischer und sozialer Einfluss
- Gesundheitspolitik zwischen Ethik und Ökonomie
- Gesundheitsausgaben in Abhängigkeit vom Alter
- Entwicklung der Gesundheitsausgaben vor dem Tod
- SKIZZIERUNG UND VERGLEICH DES DEUTSCHEN UND AMERIKANISCHEN GESUNDHEITSSYSTEMS
- Das deutsche Gesundheitssystem
- Prinzipien des solidarischen Gesundheitswesens
- Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
- Entwicklung der Pro-Kopf-Ausgaben von 1995 – 2004
- Die Private Krankenversicherung (PKV)
- Die gesetzliche Pflegeversicherung
- Aktuelle Entwicklungen und Präventionen
- Das amerikanische Gesundheitssystem
- Prinzipien des amerikanischen Gesundheitswesens
- Die Gesetzliche und die Private Krankenversicherung
- Die Pflegeversicherung
- Aktuelle Entwicklungen und Präventionen
- Das deutsche und das amerikanische Gesundheitssystem im Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der deutschen und amerikanischen Gesundheitsversorgung im Kontext der Geriatrie. Das Ziel ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Systeme zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf die Bedürfnisse älterer Menschen. Dabei wird die Problematik des demographischen Wandels und seiner Auswirkungen auf die Gesundheitsausgaben beleuchtet.
- Demographischer Wandel und Alterung der Gesellschaft
- Gesundheitsversorgung älterer Menschen
- Vergleich des deutschen und amerikanischen Gesundheitssystems
- Soziale und ethische Aspekte der Gesundheitspolitik
- Finanzierung und Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt zunächst grundlegende Begriffe wie Gesundheit und Krankheit vor und erläutert den demographischen Wandel in Deutschland. Sie verdeutlicht die Herausforderungen, die die alternde Gesellschaft für das Gesundheitssystem darstellt. Im zweiten Kapitel werden das deutsche und das amerikanische Gesundheitssystem vorgestellt. Dabei werden die jeweiligen Prinzipien, Finanzierungssysteme und die Entwicklung der Gesundheitsausgaben betrachtet.
Schlüsselwörter
Geriatrie, Gesundheitssystem, Demographischer Wandel, Lebenserwartung, Gesundheitsausgaben, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Solidarprinzip, USA, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst der demographische Wandel das Gesundheitswesen?
Sinkende Geburtenraten und eine steigende Lebenserwartung führen dazu, dass immer mehr ältere Menschen Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen, was die Kosten für das System erhöht.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen dem deutschen und dem US-Gesundheitssystem?
Das deutsche System basiert auf dem Solidarprinzip und einer Versicherungspflicht (GKV/PKV), während das US-System stärker privatwirtschaftlich organisiert ist und staatliche Programme wie Medicare primär für Ältere vorsieht.
Was versteht man unter dem „Krankheitspanorama“ geriatrischer Patienten?
Es beschreibt die typischen, oft chronischen und multiplen Erkrankungen im Alter, die eine spezialisierte medizinische und pflegerische Versorgung erfordern.
Wie funktioniert die Pflegeversicherung in Deutschland?
Sie ist eine gesetzliche Pflichtversicherung, die dazu dient, das Risiko der Pflegebedürftigkeit finanziell abzusichern, wobei die Leistungen je nach Pflegegrad variieren.
Welche Rolle spielt die Prävention in der Geriatrie?
Prävention soll die Selbstständigkeit im Alter möglichst lange erhalten und den Eintritt schwerer Pflegebedürftigkeit verzögern, was sowohl ethisch als auch ökonomisch sinnvoll ist.
Wie haben sich die Gesundheitsausgaben pro Kopf entwickelt?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Ausgaben in Deutschland zwischen 1995 und 2004 und zeigt eine deutliche Steigerung, insbesondere in den höheren Altersgruppen.
- Quote paper
- Susanne Ahmadseresht (Author), 2008, Die deutsche und amerikanische Gesundheitsversorgung im Rahmen der Geriatrie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188158