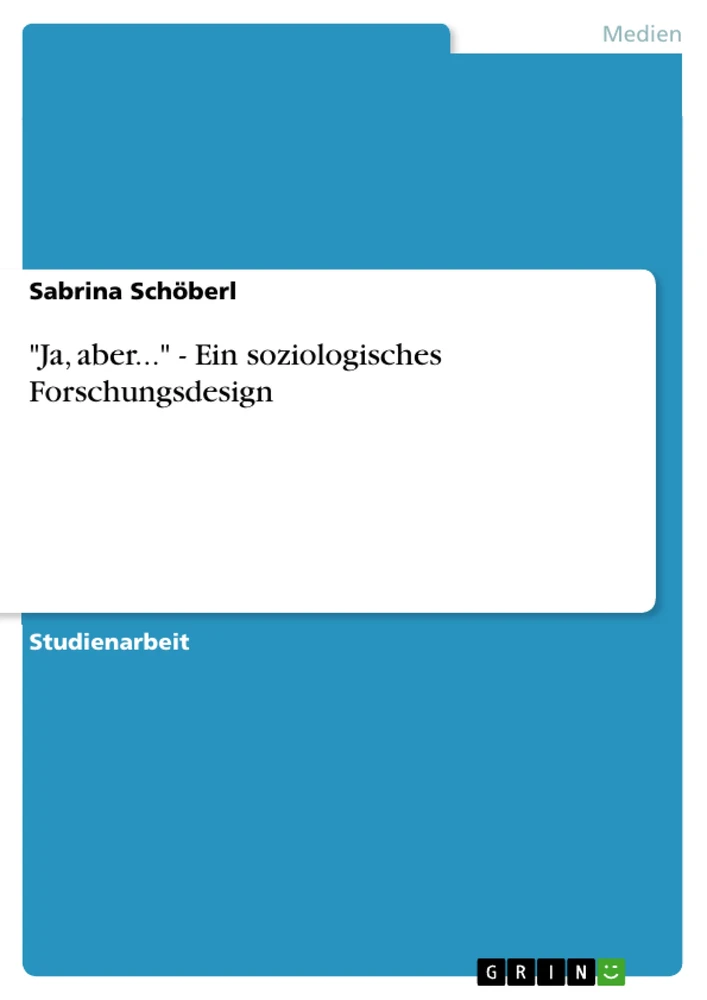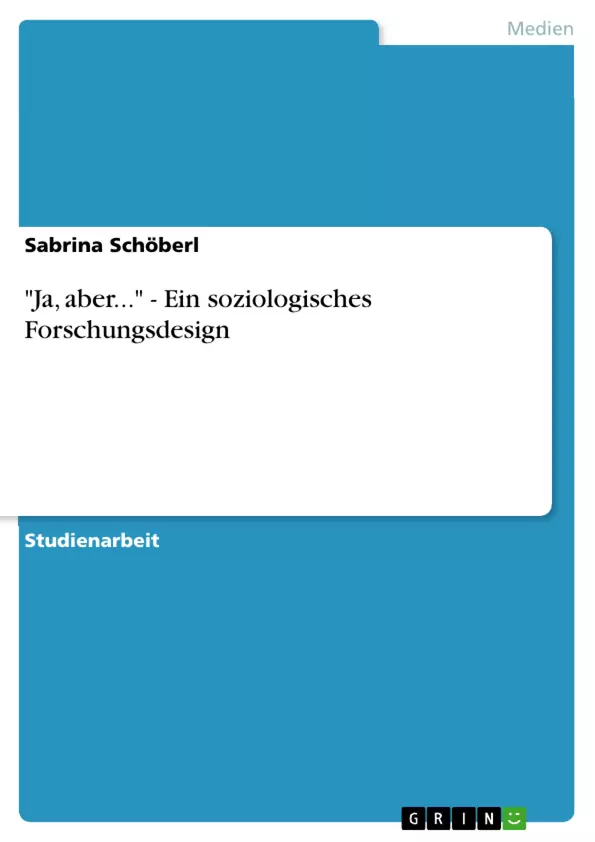Implizite Regeln sind solche, die in unserer Gesellschaft unbewusst als selbstverständlich angenommen werden und deshalb auch nur peripher wahrgenommen werden. Sie werden ebenso unbemerkt befolgt wie auch verletzt, was den Grund dafür darstellt, dass es oft schwierig ist, eine implizite Regel als solche zu erkennen. Implizite Normen werden erst dann sichtbar, wenn sie verletzt werden; solange ihnen gefolgt wird, bleiben sie unerkannt. Beispiel: Solange sich zwei Menschen begegnen und einander mit „Hallo“, „Grüß Gott“, „Servus“, etc. begrüßen, ist nichts Auffälliges dabei und man weiß: Diese Grußart ist selbstverständlich und „normal“ (sofern es diesen Begriff überhaupt in dieser Form gibt). Erst, wenn eine der beiden Personen auf ein „Hallo“ beispielsweise mit „Tschüss“ antwortet, bemerkt man: Irgendwas stimmt hier nicht. Diese Norm ist implizit, weil nicht bewusst wahrgenommen wird, dass die andere Person eine vermeintlich „richtige“ Grußformel verwendet hat, und weil sie erst dann klar wird, wenn eine der beiden Personen mit einer völlig unpassenden Begrüßung reagiert.
Inhaltsverzeichnis
- Beobachtung
- Implizite Regeln
- Explorandum
- Problemstellung
- Hypothesen
- Ergebnisszenario
- Erhebungsmethode
- Szenario
- Verwertbarkeit der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse einer impliziten Regel in Form der Floskel „Ja, aber...“ und untersucht deren Funktion im Kontext von Diskussionen. Ziel ist es, die implizite Norm zu identifizieren und zu analysieren, die durch die Verwendung dieser Floskel verletzt wird. Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der impliziten Regeln und ihrer Relevanz für die soziale Interaktion.
- Implizite Regeln in der Kommunikation
- Die Funktion der Floskel „Ja, aber...“
- Verletzung von impliziten Normen durch „Ja, aber...“
- Akzeptanz und Inakzeptanz von Meinungen
- Die Bedeutung der freien Meinungsäußerung
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Kapitel „Beobachtung“ definiert den Begriff der impliziten Regeln und verdeutlicht deren Bedeutung für das soziale Miteinander anhand eines Beispiels.
- Im Kapitel „Explorandum“ wird die Beobachtung der Floskel „Ja, aber...“ in einer Gruppenarbeit beschrieben. Die Autorin analysiert die implizite Regel, die durch die Verwendung dieser Floskel verletzt wird.
- Die Kapitel „Problemstellung“, „Hypothesen“, „Ergebnisszenario“ und „Verwertbarkeit der Ergebnisse“ beschreiben die methodischen und inhaltlichen Aspekte der Forschungsarbeit. Diese Kapitel werden jedoch in der Zusammenfassung nicht weiter ausgeführt, um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Implizite Regeln, Kommunikation, Interaktion, Floskel „Ja, aber...“, Verletzung von Normen, Akzeptanz, Inakzeptanz, freie Meinungsäußerung, Beobachtung, Forschungsdesign.
Häufig gestellte Fragen
Was sind implizite Regeln in der Kommunikation?
Implizite Regeln sind unbewusste soziale Normen, die als selbstverständlich angenommen werden. Sie fallen meist erst auf, wenn sie verletzt werden.
Welche Funktion hat die Floskel „Ja, aber...“ laut der Arbeit?
Die Floskel signalisiert scheinbare Zustimmung, leitet aber tatsächlich eine Ablehnung oder Einschränkung ein, was eine implizite Norm der echten Akzeptanz verletzen kann.
Wie werden implizite Normen sichtbar?
Sie werden durch ihre Verletzung sichtbar. Wenn jemand zum Beispiel auf ein „Hallo“ mit „Tschüss“ antwortet, wird die implizite Regel der korrekten Grußformel deutlich.
Was untersucht das Forschungsdesign dieser Arbeit?
Das Design untersucht die Akzeptanz und Inakzeptanz von Meinungen in Gruppendiskussionen und wie sprachliche Muster die soziale Interaktion beeinflussen.
Warum ist die freie Meinungsäußerung in diesem Kontext relevant?
Die Arbeit analysiert, wie sprachliche Barrieren wie „Ja, aber...“ die Dynamik der freien Meinungsäußerung in einer Gruppe stören oder lenken können.
- Citation du texte
- Mag. Sabrina Schöberl (Auteur), 2005, "Ja, aber..." - Ein soziologisches Forschungsdesign, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188163