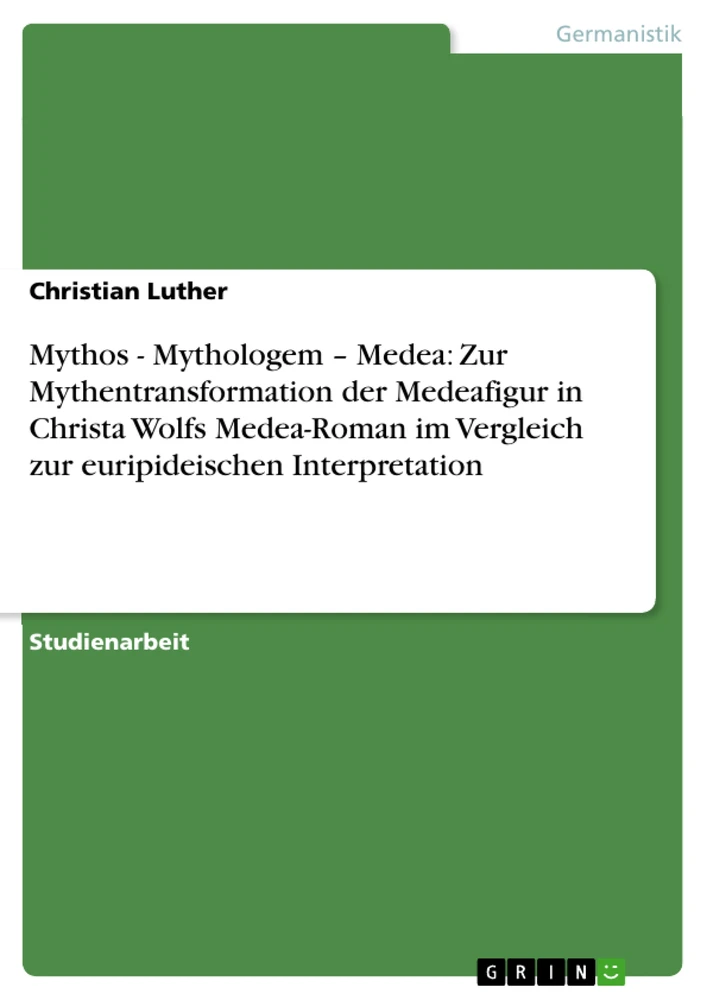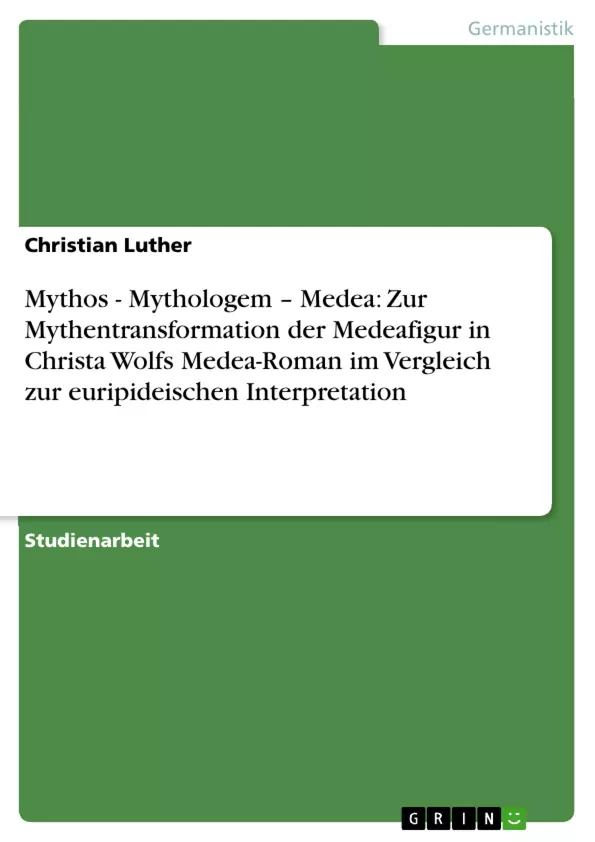Die folgende Arbeit mit dem Thema „ Mythos - Mythologem – Medea: Zur Mythentransformation der Medeafigur in Christa Wolfs Medea-Roman im Vergleich zur euripideischen Interpretation“ stellt sich der Frage, inwiefern eine Transformation einer mythischen Figur, wie auch Medea eine ist, zulässig oder sogar gewollt ist.
Dabei sind zwei Texte von elementarer Bedeutung für die Interpretation des Medeacharakters. Zum einen der „Urtext“ in Form der euripideischen Medea und zum anderen der aktuelle Text Christa Wolfs aus dem 20. Jh., welcher als Angelpunkt für die Analyse dienen soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mythos - Mythologem - Mythentransformation
- Die eine Medea? Der Mythos durch die Zeiten
- Euripides vs. Wolf: Heimat - Hexe - Heilige vs. herzlose Hure?
- Heimat im Vergleich und warum überhaupt?
- Hexe, herzlose Hure oder Hetze gegen eine Unschuldige?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, wie die mythologische Figur der Medea in Christa Wolfs Roman im Vergleich zu Euripides' Interpretation transformiert wird. Sie analysiert, inwiefern eine Transformation einer mythischen Figur zulässig oder gewollt ist und die unterschiedlichen Interpretationen des Medea-Mythos in verschiedenen Epochen beleuchtet.
- Mythentransformation und die Interpretation des Mythos in verschiedenen Epochen
- Vergleichende Analyse der Medea-Figur in Euripides und Christa Wolfs Roman
- Die Rolle von Heimat, Hexe und der moralischen Bewertung der Medea-Figur
- Die Relevanz des Mythos und dessen Konstruktion durch die Zeiten
- Die Bedeutung von literarischen und narrativen Begriffen im Kontext des Mythos
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den theoretischen Rahmen, der sich mit den Begriffen Mythos, Mythentransformation und Mythologem auseinandersetzt.
Kapitel 2 definiert den Mythos und seine verschiedenen Bedeutungen, wobei besonders der historisch-kritische, der narrative und der literarische Begriff im Fokus stehen. Die Transformation des Mythos wird als ein Prozess der stetigen Neuinterpretation und Veränderung durch die Zeiten betrachtet.
Kapitel 3 befasst sich mit der Geschichte des Medea-Mythos und seinen unterschiedlichen Interpretationen durch die Jahrhunderte.
Kapitel 4 vergleicht die Darstellung der Medea-Figur bei Euripides und Christa Wolf, insbesondere im Hinblick auf die Themen Heimat, Hexe und ihre moralische Bewertung.
Schlüsselwörter
Mythos, Mythologem, Mythentransformation, Medea, Euripides, Christa Wolf, Heimat, Hexe, literarische Interpretation, narrative Struktur, Transformationsprozess, zeitlose Wahrheit, Neudeutung.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich Christa Wolfs Medea von der des Euripides?
Während Euripides Medea oft als rachsüchtige Kindsmörderin darstellt, deutet Christa Wolf die Figur als Opfer von Hetze und patriarchalen Machtstrukturen um.
Was bedeutet Mythentransformation?
Es ist der Prozess der stetigen Neuinterpretation und Veränderung mythischer Stoffe durch verschiedene Epochen und Autoren.
Welche Rolle spielt das Thema "Heimat" im Medea-Mythos?
Die Arbeit vergleicht, wie Medeas Fremdheit und der Verlust ihrer Heimat Kolchis in den beiden Texten zur Begründung ihres Schicksals beitragen.
Ist Medea eine Hexe oder ein Opfer?
Die Untersuchung beleuchtet die moralische Bewertung: von der antiken "Hexe" zur modernen "Heiligen" oder unschuldig Verfolgten bei Wolf.
Warum ist der Mythos Medea zeitlos?
Weil er fundamentale menschliche Konflikte wie Verrat, Ausgrenzung und Identität behandelt, die immer wieder neu gedeutet werden können.
- Citation du texte
- Christian Luther (Auteur), 2011, Mythos - Mythologem – Medea: Zur Mythentransformation der Medeafigur in Christa Wolfs Medea-Roman im Vergleich zur euripideischen Interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188261