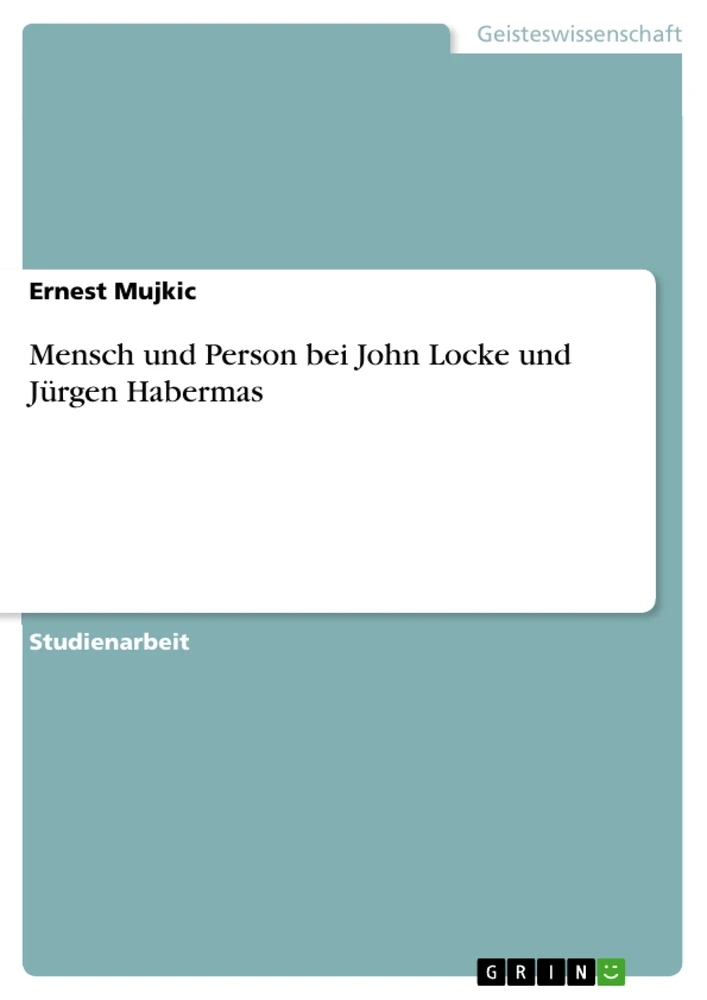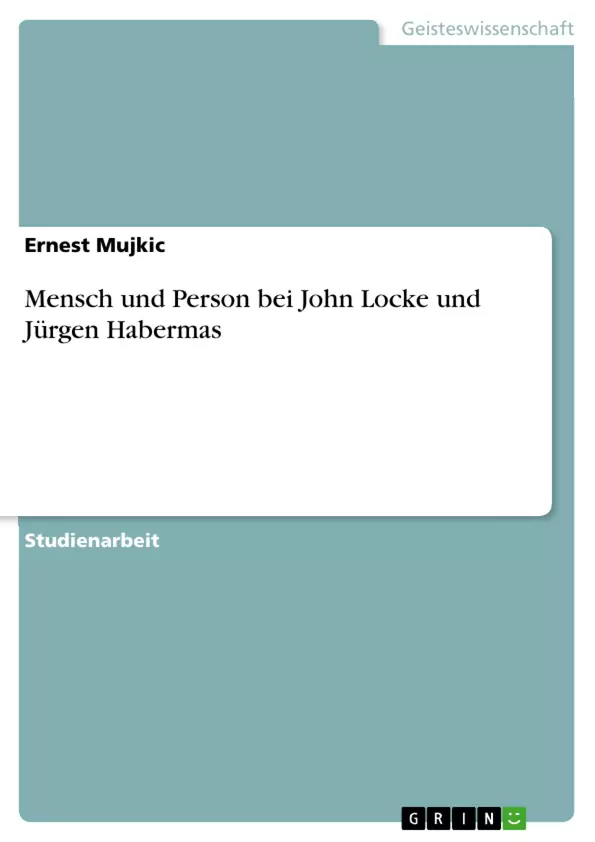„Wo menschliches Leben existiert, kommt ihm Menschenwürde zu; es ist nicht entscheidend, ob der Träger sich dieser Würde bewusst ist und sie selbst zu wahren weiß. Die von Anfang an im menschlichen Sein angelegten potenziellen Fähigkeiten genügen, um die Menschenwürde zu begründen.“
Mensch und Person sind dieser Entscheidung des Verfassungsgerichts zufolge unzertrennlich; sogar auch dann, wenn der ‚Träger’ der Menschenwürde sich seiner eigenen Trägerschaft nicht einmal bewusst ist. Die unerschütterliche Beziehung des Menschen und der Person liegt in diesem Fall in der Erhebung ‚potenzieller Fähigkeiten’ zum einzigen Bestimmungskriterium der Identität des Menschen, die zugleich auch eine Identität der Person begründet.
Diese Einheit der Begriffe Mensch und Person war und ist jedoch keineswegs unumstritten, wie die Diskussion um die Embryonenforschung in der Bundesrepublik zeigt. Wer darüber bestimmt, wann ein Mensch eine Person ist und welche Voraus-setzungen für das Personsein erfüllt werden müssen, sind die zentralen Fragen, die in dieser Diskussion erläutert werden.
In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, zwei Positionen, die das Vorhanden des Personseins von bestimmten inneren und äußeren Bedingungen des Menschseins abhängig machen, d.h. die das Personsein des Menschen als etwas künstliches betrachten, zu vergleichen und kritisch zu beurteilen. Auf der einen Seite steht John Lockes Konzept einer Trennung der Identität des Menschen und der Identität der Person, in dessen Zentrum das räumlich-zeitliche Kriterium der Identitätsbestimmung steht. Da neben diesem „Lokalisierungsprinzip“ auch die Art der Organisationsstruktur von Dingen und Lebewesen eine wichtige Rolle in Lockes Untersuchung der Grundlagen des Mensch- und Personseins einnimmt, gehört diese ebenso zum Gegenstand dieser Arbeit. Den Ausführungen zu John Locke folgt eine Darstellung und kritische Erläuterung der Position von Jürgen Habermas, die er in "Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?" (2001) entwickelt. Die durchaus vorhandene Ähnlichkeit in der Argumentation von Locke und Habermas bildet den Anlass für die vergleichenden Aspekte folgender Untersuchung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konstituierung der Identität bei John Locke
- Das Lokalisierungsprinzip
- Die Bedeutung der Organisationsstruktur
- Die Verschiedenheit von Mensch und Person
- Identität des Menschen
- Identität der Person und ihr Verhältnis zur Identität des Menschen
- Die Quellen der Identität bei Jürgen Habermas
- Die raum-zeitliche Dimension des Personseins bei Habermas
- Habermas' 'Schiefes' Argument gegen das Dammbruchargument
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht und bewertet kritisch zwei Positionen, die das Personsein von inneren und äußeren Bedingungen des Menschseins abhängig machen. Im Fokus stehen John Lockes Konzept der Trennung von menschlicher und personaler Identität und Jürgen Habermas' Position, wie sie in "Die Zukunft der menschlichen Natur" dargestellt wird. Die Ähnlichkeiten in der Argumentation beider Denker bilden den Ausgangspunkt des Vergleichs.
- Identität des Menschen und der Person nach Locke
- Das Lokalisierungsprinzip bei Locke
- Die Bedeutung der Organisationsstruktur nach Locke
- Habermas' Konzept der Identität
- Vergleich der Positionen von Locke und Habermas
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Person in den Mittelpunkt, ausgehend von einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Sie thematisiert die kontroverse Diskussion um die Embryonenforschung und kündigt den Vergleich und die kritische Beurteilung der Positionen von John Locke und Jürgen Habermas an, die das Personsein von bestimmten Bedingungen abhängig machen.
Konstituierung der Identität bei John Locke: Dieses Kapitel analysiert Lockes Verständnis von Identität im 27. Kapitel seines Werkes "Über den menschlichen Verstand". Locke betont die räumlich-zeitliche Einbettung der Existenz als zentrales Bestimmungsmerkmal der Identität, neben der Organisationsstruktur von Dingen und Lebewesen. Das "Lokalisierungsprinzip" besagt, dass ein Ding zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort existiert und nicht gleichzeitig an verschiedenen Orten sein kann. Die Verschiedenheit ergibt sich aus unterschiedlichen räumlich-zeitlichen Anfängen. Lockes Individualitätsprinzip wird mit der wechselseitigen Interdependenz zwischen Existenz, Zeit und Raum erklärt, wobei die Zielstrebigkeit durch Kausalität ersetzt wird.
Schlüsselwörter
John Locke, Jürgen Habermas, Identität, Person, Mensch, Lokalisierungsprinzip, Organisationsstruktur, Raum, Zeit, Menschenwürde, Embryonenforschung, Identitätsbestimmung.
Häufig gestellte Fragen zu: Vergleich der Konzepte von Locke und Habermas zur Identität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht und bewertet kritisch die Konzepte von John Locke und Jürgen Habermas bezüglich des Personseins und seiner Abhängigkeit von inneren und äußeren Bedingungen des Menschseins. Der Fokus liegt auf Lockes Trennung von menschlicher und personaler Identität und Habermas' Position, wie sie in "Die Zukunft der menschlichen Natur" dargestellt wird. Die Ähnlichkeiten in der Argumentation beider Denker bilden den Ausgangspunkt des Vergleichs.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Identität des Menschen und der Person nach Locke, das Lokalisierungsprinzip bei Locke, die Bedeutung der Organisationsstruktur nach Locke, Habermas' Konzept der Identität, und einen Vergleich der Positionen von Locke und Habermas. Die Einleitung bezieht sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Embryonenforschung und die damit verbundene kontroverse Diskussion.
Wie wird Lockes Konzept der Identität dargestellt?
Lockes Verständnis von Identität wird anhand des 27. Kapitels seines Werkes "Über den menschlichen Verstand" analysiert. Zentrale Aspekte sind die räumlich-zeitliche Einbettung der Existenz, das Lokalisierungsprinzip (ein Ding existiert zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort), und die Bedeutung der Organisationsstruktur von Dingen und Lebewesen. Lockes Individualitätsprinzip wird mit der wechselseitigen Interdependenz zwischen Existenz, Zeit und Raum erklärt.
Wie wird Habermas' Konzept der Identität dargestellt?
Die Arbeit beschreibt Habermas' Konzept der Identität, wie es sich in "Die Zukunft der menschlichen Natur" zeigt. Ein wichtiger Aspekt ist die raum-zeitliche Dimension des Personseins bei Habermas. Es wird auch auf Habermas' Argument gegen das Dammbruchargument eingegangen.
Welcher Vergleich wird zwischen Locke und Habermas angestellt?
Die Arbeit vergleicht die Positionen von Locke und Habermas hinsichtlich ihrer Konzepte von Identität, Person und Mensch. Sie analysiert Ähnlichkeiten und Unterschiede in ihren Argumentationen und bietet eine kritische Bewertung beider Ansätze.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: John Locke, Jürgen Habermas, Identität, Person, Mensch, Lokalisierungsprinzip, Organisationsstruktur, Raum, Zeit, Menschenwürde, Embryonenforschung, und Identitätsbestimmung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, der Konstituierung der Identität bei John Locke (einschließlich Lokalisierungsprinzip und Organisationsstruktur), der Verschiedenheit von Mensch und Person, den Quellen der Identität bei Jürgen Habermas (einschließlich der raum-zeitlichen Dimension und Habermas' Argument gegen das Dammbruchargument), und einer Zusammenfassung.
- Quote paper
- Ernest Mujkic (Author), 2007, Mensch und Person bei John Locke und Jürgen Habermas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188275