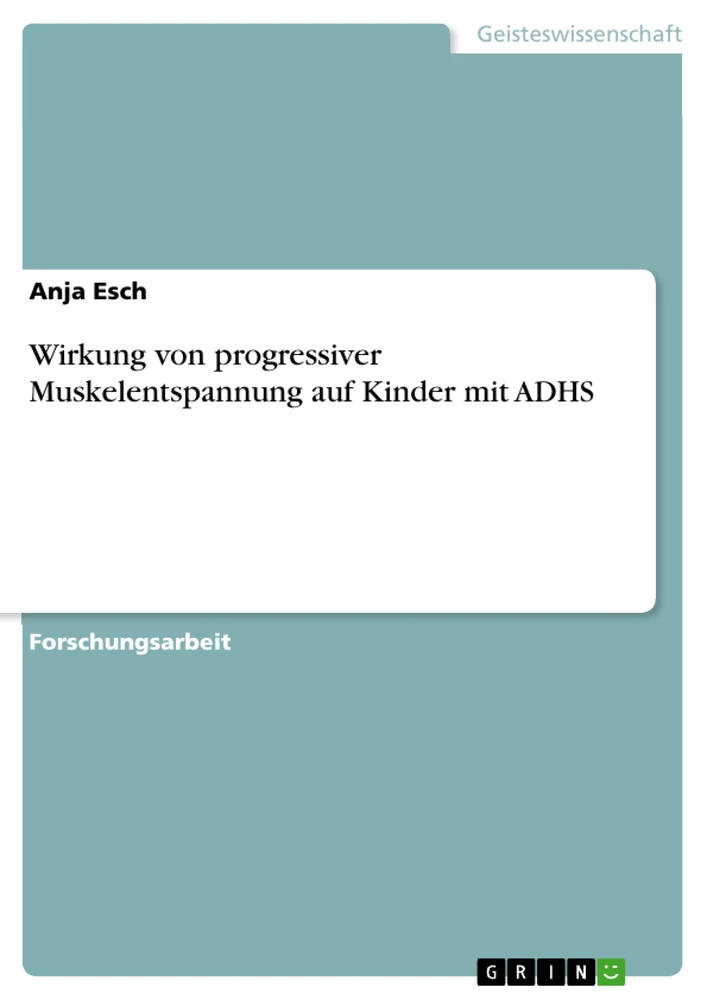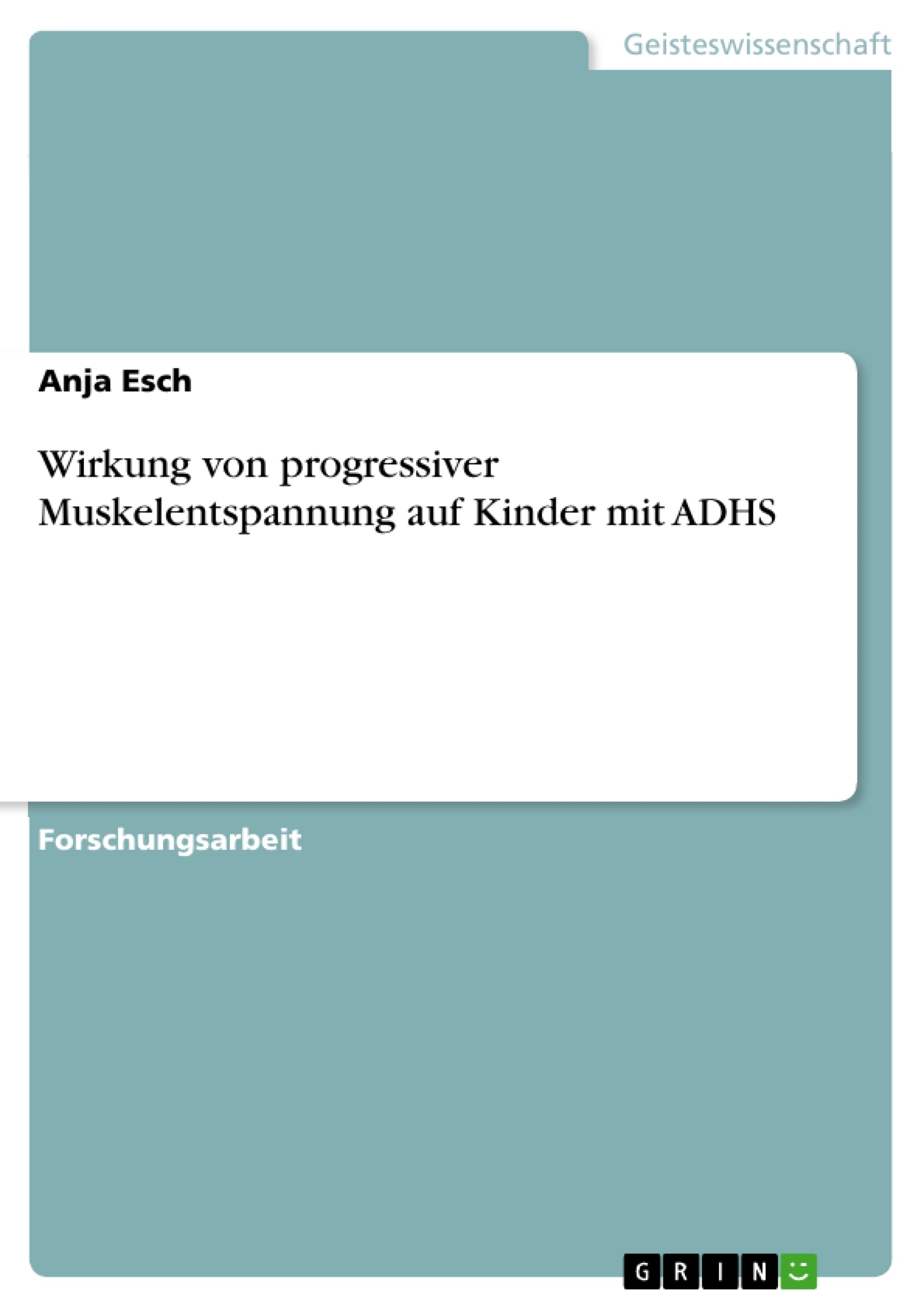Dieser Forschungsbericht im Rahmen des geleisteten Praxissemesters (Winter 2009/2010) befasst sich mit der Wirkung der progressiven Muskelentspannung auf Kinder mit ADHS. Das Praxissemester wurde in der Tagesklinik der Elisabethklinik (Name geändert) absolviert.
Die dort übernommenen Aufgaben umfassten neben der Betreuung von psychisch erkrankten Kindern auch die Betreuung einzelner Therapiegruppen, insbesondere Gruppen zur progressiven Muskelentspannung für Kinder.
Die Elisabethklinik ist ein staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut für Psychologische Psychotherapie und Kinder- und Jugendpsychotherapie mit dem Vertiefungsfach „Verhaltenstherapie“. Die Klinik bietet eine dreijährige Vollzeitausbildung zur/zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin/en an. Diese ist als Vollzeitausbildung konzipiert, das heißt, die AusbildungsteilnehmerInnen werden als Bezugstherapeuten in der Klinik eingesetzt und absolvieren parallel dazu „unter einem Dach“ die gemäß der staatlichen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung erforderlichen Ausbildungsin-halte.
Daher besteht für interessierte Praktikanten die Möglichkeit einige Studienkurse zu belegen. Dabei kann auch ein Schulungsseminar zur Durchführung von progressiver Muskelentspannung belegt werden.
Viele der zu betreuenden Kinder in der Tagesklinik haben Schwierigkeiten, während des Schulunterrichts lange Phasen still zu sitzen und aufzupassen. Daher stellte sich die Frage, was getan werden kann, um diese Kinder etwas zur Ruhe zu bringen, nicht nur um den Stationsalltag zu erleichtern, sondern auch um ihnen etwas an die Hand zu geben, das sie Zuhause alleine oder mit ihren Eltern weiterführen könnten. Die Idee eines Kurses zur progressiven Muskelentspannung mit imaginativen Geschichten für Kinder kam auf. Nach 14-tägiger zweimal wöchentlicher Durchführung des Kurses stellte sich dann zudem die Frage, ob dieser Kurs bei den beteiligten Kindern eine Wirkung erzielt. Daraus entstand die zu beantwortende Forschungsfrage dieses Berichtes:
Erzielt die progressive Muskelentspannung die beabsichtigte Wirkung auf Kinder mit einem diagnostizierten Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS)?
Zunächst wird die Praktikumseinrichtung vorgestellt. Des Weiteren werden zum einheitlichen Verständnis, die einzelnen, für das Thema zentralen Begrifflichkeiten(ADHS und progressive Muskelentspannung) definiert.
Die Namen der Kinder, sowie die Namen der Praktikumseinrichtung wurden in diesem Bericht geändert.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Praktikumseinrichtung
- Aufgaben- und Tätigkeitsbereich der Institution
- Theoretische Konzeption und therapeutische Orientierung
- Das Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS)
- Symptome bei ADHS
- Ursachen von ADHS
- Diagnose von ADHS
- Therapie von Kindern mit ADHS
- Elterntraining
- Selbstinstruktionstraining
- Intervention in der Schule
- Training zur Verbesserung von sozialen Fähigkeiten
- Entspannungsverfahren
- Ergo-/Sporttherapie
- Medikamentöse Therapie
- Die progressive Muskelentspannung
- Wirkung von progressiver Muskelentspannung
- Forschung
- Das Vorhaben
- Mögliche Probleme und Grenzen der Methode
- Hypothesen
- Durchführung
- Auswertung
- Ergebnisse in Bezug auf die Hypothesen
- Das Vorhaben
- Abschließendes Fazit
- Literatur
- Erklärung
- Anhang
- Kurzform der progressiven Muskelentspannung nach Jacobson
- Kapitän Nemo-Geschichte „Die Schatzsuche“ von Ulrike Petermann
- Beispiel einer verwendeten Connor Skala
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit untersucht die Wirksamkeit progressiver Muskelentspannung bei Kindern mit ADHS. Ziel ist es, die Auswirkungen dieser Entspannungstechnik auf die Symptomatik von ADHS zu evaluieren und deren Eignung als Therapiemethode zu beurteilen. Die Arbeit basiert auf praktischen Erfahrungen in einer Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
- Wirksamkeit der progressiven Muskelentspannung bei ADHS
- Beschreibung der Symptomatik und Therapie von ADHS
- Anwendung der progressiven Muskelentspannung in der Praxis
- Evaluation der Methode und deren Grenzen
- Integration der Methode in den klinischen Alltag
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Arbeit beschreibt die Untersuchung der Wirkung progressiver Muskelentspannung auf Kinder mit ADHS im Rahmen eines Praxissemesters in einer Tagesklinik. Die Forschungsfrage konzentriert sich auf die Wirksamkeit dieser Methode und leitet die weiteren Kapitel ein, indem sie den Kontext der Studie im klinischen Umfeld beschreibt und die Notwendigkeit der Untersuchung begründet. Die Arbeit entstand aus der praktischen Erfahrung mit Kindern, die im Schulalltag Schwierigkeiten mit Konzentration und Ruhe hatten. Der Wunsch, ihnen eine praktikable und zu Hause anwendbare Methode zur Entspannung zu vermitteln, motivierte die Forschungsarbeit. Die Einleitung dient also als Begründung und Einführung in die Forschungsfrage.
Einführung in die Praktikumseinrichtung: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die Elisabethklinik, den Fokus auf die Tagesklinik legend. Es beschreibt die Aufgaben und den Tätigkeitsbereich der Institution, inklusive der verschiedenen Abteilungen und des Behandlungsansatzes. Der Schwerpunkt liegt auf der Funktionsweise der Tagesklinik, ihren Therapieangeboten (Einzel- und Gruppentherapie, Physiotherapie, etc.) und der Bedeutung der familiären Zusammenarbeit. Die Beschreibung dient als Kontext für die spätere Präsentation der Forschungsarbeit und verdeutlicht das Umfeld, in dem die Studie durchgeführt wurde. Die detaillierte Darstellung der Klinik hebt die Professionalität und den ganzheitlichen Ansatz der Behandlung hervor.
Das Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS): Dieses Kapitel definiert das Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS), beleuchtet seine Symptome, Ursachen, Diagnosemethoden und Therapieansätze für Kinder. Es bietet eine umfassende Übersicht über verschiedene Therapieformen, darunter Elterntraining, Selbstinstruktionstraining, Interventionen in der Schule, soziale Kompetenztrainings, Entspannungsverfahren, Ergo-/Sporttherapie und medikamentöse Behandlungen. Die Darstellung verschiedener Therapiemethoden unterstreicht die Komplexität der Erkrankung und die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes.
Die progressive Muskelentspannung: Dieses Kapitel widmet sich der progressiven Muskelentspannung (PME) und beschreibt insbesondere ihre Wirkung. Es analysiert die Methode im Detail und stellt ihre Anwendung und die erwartete Wirkung dar. Dieser Teil liefert das notwendige Hintergrundwissen über die in der Studie verwendete Intervention, um den Leser auf die Forschungsfrage vorzubereiten.
Forschung: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Forschungsansatz, die Hypothesen, die Durchführung der Studie und die Auswertungsmethode. Es legt dar, wie die Studie konzipiert wurde, welche Methoden zur Datenerhebung und -auswertung eingesetzt wurden, und welche Probleme oder Grenzen die Methode möglicherweise aufweist. Das Kapitel dient als methodischer Kern der Arbeit, der die wissenschaftliche Validität der Studie sicherstellt.
Schlüsselwörter
ADHS, progressive Muskelentspannung, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Tagesklinik, Entspannungsverfahren, Therapie, Wirksamkeit, Forschung, Intervention, Elterntraining.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Forschungsarbeit: Wirksamkeit Progressiver Muskelentspannung bei Kindern mit ADHS
Was ist der Gegenstand dieser Forschungsarbeit?
Die Forschungsarbeit untersucht die Wirksamkeit der progressiven Muskelentspannung (PME) bei Kindern mit ADHS. Sie basiert auf praktischen Erfahrungen in einer Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und evaluiert die Auswirkungen der PME auf die ADHS-Symptomatik.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine Einführung in die Praktikumseinrichtung (Elisabethklinik), eine detaillierte Beschreibung des Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndroms (ADHS) inklusive seiner Symptome, Ursachen, Diagnose und verschiedener Therapieansätze. Ein eigenes Kapitel widmet sich der progressiven Muskelentspannung, gefolgt von einem ausführlichen Forschungsabschnitt (Hypothesen, Methoden, Durchführung, Auswertung, Ergebnisse). Abschließend findet sich ein Fazit, Literaturverzeichnis, Erklärung und Anhang mit zusätzlichen Materialien (z.B. Kurzform der PME, Beispiel einer Connor Skala).
Welche Ziele verfolgt die Forschungsarbeit?
Das Hauptziel ist die Evaluation der Wirksamkeit der progressiven Muskelentspannung als Therapiemethode bei Kindern mit ADHS. Es soll untersucht werden, ob und inwieweit die PME die ADHS-Symptome beeinflusst und ob sie sich als geeignete Ergänzung bestehender Therapien eignet.
Welche Methoden wurden in der Studie eingesetzt?
Die Arbeit beschreibt detailliert den Forschungsansatz, die Hypothesen, die Durchführung der Studie und die Auswertungsmethode. Es wird dargelegt, wie die Studie konzipiert wurde, welche Methoden zur Datenerhebung und -auswertung eingesetzt wurden, und welche Probleme oder Grenzen die Methode möglicherweise aufweist. Konkrete Methoden werden im Kapitel "Forschung" erläutert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der Studie, insbesondere in Bezug auf die aufgestellten Hypothesen, werden im Kapitel "Forschung" präsentiert. Die Arbeit bewertet die Wirksamkeit der progressiven Muskelentspannung bei der Behandlung von ADHS-Symptomen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das abschließende Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet die Wirksamkeit der progressiven Muskelentspannung bei Kindern mit ADHS. Es diskutiert die Bedeutung der Ergebnisse für die Praxis und benennt mögliche Limitationen der Studie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
ADHS, progressive Muskelentspannung, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Tagesklinik, Entspannungsverfahren, Therapie, Wirksamkeit, Forschung, Intervention, Elterntraining.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen finden sich im vollständigen Text der Forschungsarbeit, inklusive des ausführlichen Inhaltsverzeichnisses und der Kapitelzusammenfassungen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Fachkräfte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Therapeuten, Pädagogen und alle, die sich mit der Behandlung von Kindern mit ADHS auseinandersetzen. Sie bietet praktische Einblicke und wissenschaftliche Erkenntnisse zur Wirksamkeit der progressiven Muskelentspannung.
- Quote paper
- Diplom Anja Esch (Author), 2011, Wirkung von progressiver Muskelentspannung auf Kinder mit ADHS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188299