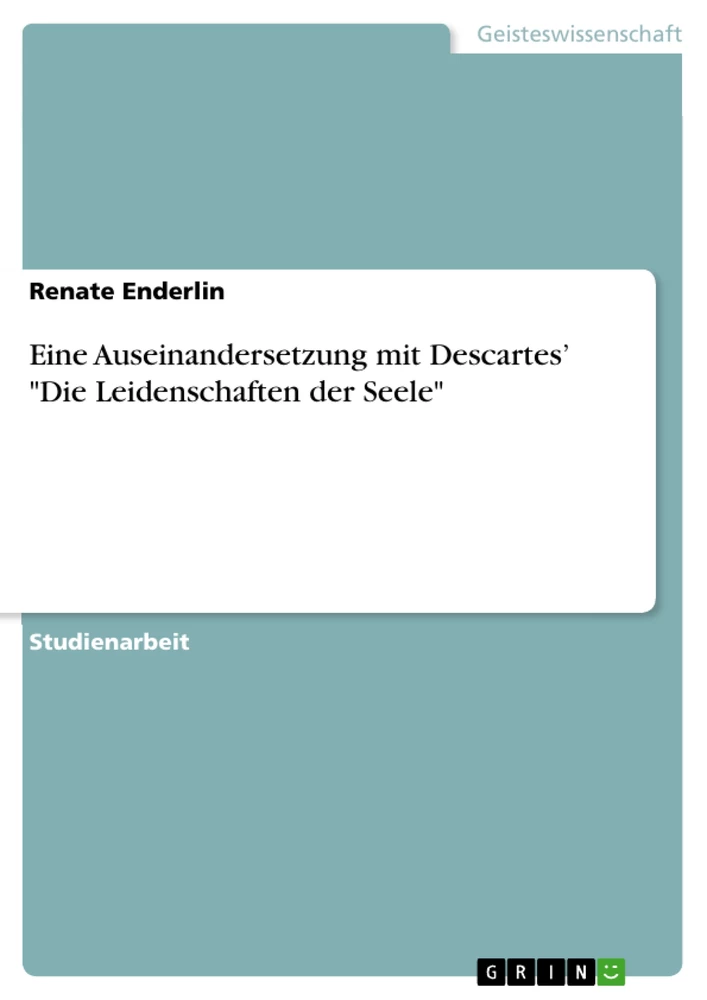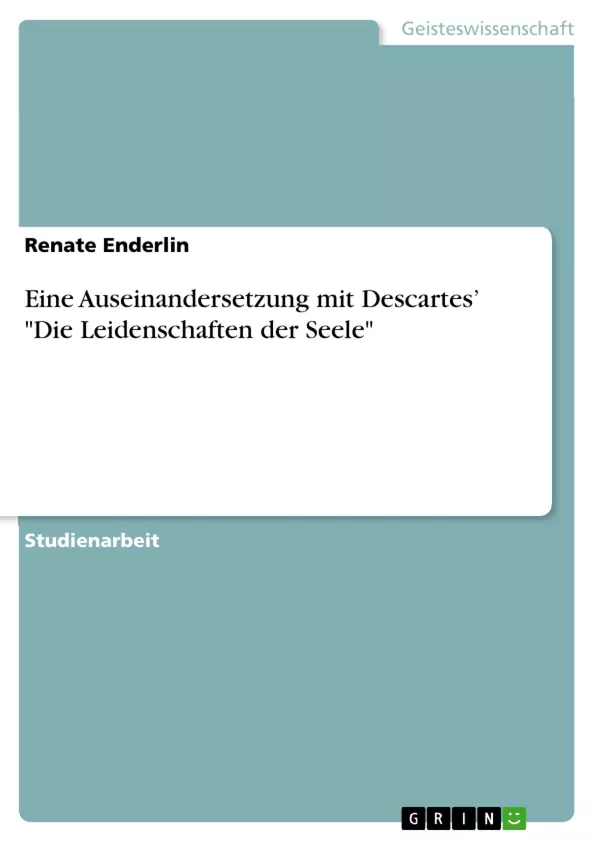Es ging nicht darum, zu fragen: Was war zuerst? Geist oder Materie? Oder wie entsteht Geist aus Materie? Oder wie entsteht Materie aus Geist? Lebendiges und Nicht-Lebendiges habe ich der Einfachheit wegen als zwei Substanzen angenommen, auf das Phänomen der Emergenz bin ich hier nicht eingegangen und wollte auch nicht die Frage stellen, die Descartes mit seiner These Zirbeldrüse zu beantworten versucht, nämlich: Wie wirken Leib und Seele aufeinander? Nicht weil die Wechselwirkungen im Psychophysicum geklärt sind, sondern weil es mir um ein anderes Dualismus-Problem ging, zu dem mich Descartes’ Leib-Seele-Problem hingeführt hat.
Doch davor kurz eine unwissenschaftliche Momentaufnahme:
Die Seele begegnet uns in der Naturwissenschaft nicht mehr, und in der Humanwissenschaft nur noch da, wo es sich um ethische Frage handelt und auch dort, wird der Begriff Seele vermieden.
In der Kunst und auch in den Medien, die nicht wissenschaftlich auftreten, begegnen uns dagegen der Begriff und das, was jeweils darunter verstanden wird, sehr oft. Der Begriff ist also keineswegs auf die Religionen beschränkt.
Für diese Arbeit wollte ich den Begriff Seele (anima) bei Aristoteles und (l’ame) bei Descartes analysieren. Dann Merleau-Ponty und Frankl und Popper referieren. Doch das führte mich alles zu weit.
Ausgangsfragen waren:
Was versteht Descartes unter Seele? Inwiefern unterscheidet sich sein Verständnis von Seele von dem des Aristoteles? Gibt es eine vom Körper unterschiedene res/Substanz (=unabhängig und unvergänglich)? Gibt es etwas, das nicht materiell/nicht ausgedehnt ist? Wie wirkt die Seele auf den Körper und im Körper, wenn sie selbst ganz und gar unkörperlich ist? Welche Ethik leitet Descartes daraus ab?
Doch anstatt diese Fragen einfach zu beantworten, habe mich zu immer neuen Fragen weitergearbeitet. Und jetzt bleibt alles Fragment.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Der Begriff Seele im Wandel
- 1.1 De anima von Aristoteles
- 1.2 Les passions de l'ame bei Descartes
- 2. Bleibendes Dualismus-Problem dank Ethik
- 3. Zusammenfassung
- 4. Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Wandel des Begriffs "Seele" und dem Dualismus-Problem, das sich aus der Unterscheidung zwischen Leib und Seele ergibt. Sie analysiert die Konzepte von Aristoteles und Descartes, beleuchtet die Problematik des Leib-Seele-Problems und skizziert Lösungsansätze aus dem 20. Jahrhundert.
- Der Wandel des Begriffs "Seele" von Aristoteles bis Descartes
- Das Leib-Seele-Problem und seine philosophische Relevanz
- Die Frage nach der Verbindung zwischen Leib und Seele und deren Auswirkungen auf ethische Fragestellungen
- Die Bedeutung von Dualismus und die Prämisse zweier Perspektiven auf die Welt
- Die Grenzen wissenschaftlicher Methoden und die Verantwortungsbereiche von Philosophie, Medizin und Psychologie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Definition des Begriffs "Seele" bei Aristoteles in "De anima" und bei Descartes in "Die Leidenschaften der Seele". Es zeigt auf, dass bei Aristoteles das Leib-Seele-Problem nicht als solches auftritt, während Descartes die Zirbeldrüse als Lösungsansatz präsentiert.
Das zweite Kapitel beleuchtet das bleibende Dualismus-Problem und untersucht, inwiefern philosophische Fragestellungen relevant sind. Es greift Ideen von Merleau-Ponty und Frankl auf, um die Komplexität des Themas zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die zentralen Begriffe "Seele", "Leib", "Dualismus", "Ethik", "Wissenschaft", "Philosophie", "Medizin", "Psychologie" und "Perspektive". Es werden die Konzepte von Aristoteles, Descartes, Merleau-Ponty und Frankl analysiert und die Grenzen wissenschaftlicher Methoden in Bezug auf philosophische Fragestellungen beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Descartes unter der Seele?
Descartes definiert die Seele als "res cogitans" (denkende Substanz), die völlig unabhängig vom Körper ("res extensa") existiert und unvergänglich ist.
Wie unterscheidet sich Descartes' Seelenbegriff von dem des Aristoteles?
Bei Aristoteles (De anima) ist die Seele die Form des Körpers und untrennbar mit ihm verbunden. Descartes hingegen etabliert einen strikten Dualismus zwischen Geist und Materie.
Welche Rolle spielt die Zirbeldrüse in Descartes' Theorie?
Descartes vermutete in der Zirbeldrüse den Ort, an dem die unkörperliche Seele und der körperliche Leib aufeinander einwirken, um das Problem der Wechselwirkung zu lösen.
Welche ethischen Konsequenzen zieht Descartes aus seinem Dualismus?
Aus der Beherrschung der "Leidenschaften der Seele" durch die Vernunft leitet Descartes eine Ethik ab, die auf Selbstkontrolle und der Souveränität des Geistes basiert.
Wird der Begriff "Seele" heute noch wissenschaftlich verwendet?
In den Naturwissenschaften spielt der Begriff kaum noch eine Rolle; in den Humanwissenschaften taucht er meist nur in ethischen Kontexten auf, während er in Kunst und Medien weiterhin sehr präsent ist.
- Quote paper
- Renate Enderlin (Author), 2011, Eine Auseinandersetzung mit Descartes’ "Die Leidenschaften der Seele", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188336