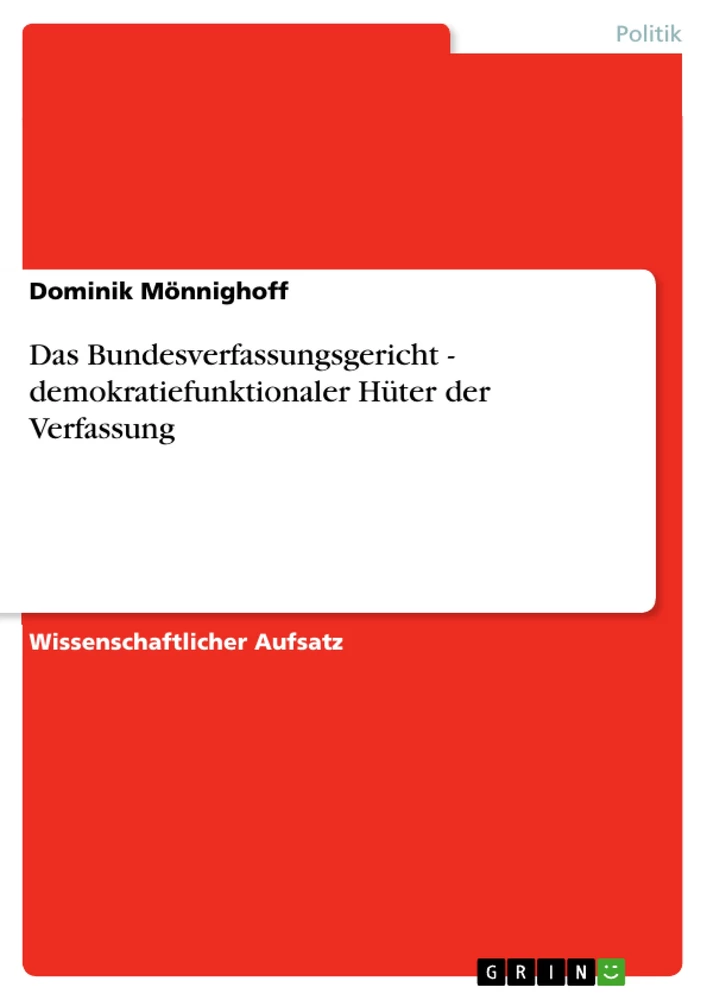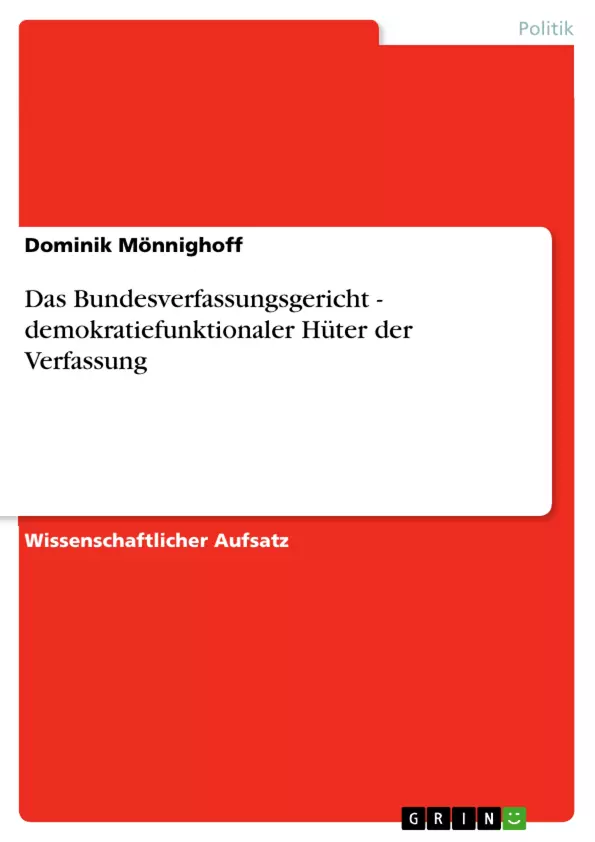These: „Das Bundesverfassungsgericht übersteigt in seinem Urteil zur Fünf-Prozent-Sperrklausel im Europawahlrecht seine Kompetenzen.“
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat am 9. November 2011 in seinem Urteil die bei der Europawahl 2009 geltende Fünf-Prozent-Hürde für nichtig erklärt, da sie unter den gegebenen Verhältnissen gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit für Parteien verstößt. Die Wahl wird jedoch nicht wiederholt werden müssen. Im Folgenden soll zunächst auf die Urteilsbegründung eingegangen werden, um anschließend die Argumente des Gesetzgebers und der zwei Sondervotums zu erörtern. Die vom Bundesverfassungsgericht höher gestellte allgemeine Chancengleichheit der Wählerstimmen wird in diesem Zusammenhang auf das Argument der Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments treffen. Abschließend werden die beiden Argumente der Chancengleichheit und des Risiko der Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments gegenübergestellt werden, um so zu einem abschließenden Urteil zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Begründung des Bundesverfassungsgerichts
- Die Einschätzung des Gesetzgebers
- Die Sondervotums der Richter Di Fabio und Mellinghoff
- Die Abwägung zwischen Chancengleichheit für Parteien sowie der Stimmrechtsgleichheit und Zersplitterungsgefahr
- Die Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Thesenpapier analysiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Fünf-Prozent-Sperrklausel im Europawahlrecht und hinterfragt dessen rechtliche Grundlage sowie die potenziellen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments.
- Rechtliche Grundlage der Fünf-Prozent-Sperrklausel im Europawahlrecht
- Einschätzung der Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments nach Abschaffung der Sperrklausel
- Abwägung zwischen Chancengleichheit und Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments
- Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts im Kontext des Europawahlrechts
- Potenzielle Auswirkungen der Sperrklausel-Abschaffung auf die Parteienlandschaft im Europäischen Parlament
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Bundesverfassungsgericht argumentiert, dass die Fünf-Prozent-Sperrklausel gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit verstößt, da sie zu einer Ungleichgewichtung der Wählerstimmen führt.
- Der Gesetzgeber sieht hingegen potenzielle Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments durch eine steigende Zahl kleiner Parteien, die mit nur einem oder zwei Abgeordneten vertreten wären.
- Die beiden Sondervotums argumentieren, dass die Senatsmehrheit den Eingriff in die Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit nicht überzeugend gewichtet und den Gestaltungsspielraum des Wahlgesetzgebers zu eng sieht.
- Das Bundesverfassungsgericht argumentiert, dass die Fünf-Prozent-Sperrklausel die Handlungsfähigkeit des Europäischen Parlaments sicherstellt, da sie die Parteiensplitterung im Parlament verhindert.
- Das Papier kritisiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und argumentiert, dass es mit seiner Entscheidung bewusst das Risiko eingeht, die Effizienz des Europäischen Parlaments zu mindern.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieses Thesenpapiers sind die Fünf-Prozent-Sperrklausel, Wahlrechtsgleichheit, Chancengleichheit, Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments, Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts, Parteiensplitterung, Fraktionsbildung und europäisches Wahlrecht. Die Analyse betrachtet die rechtliche Grundlage der Sperrklausel, ihre Auswirkungen auf die Parteienlandschaft und die Funktionsfähigkeit des Parlaments sowie die Rolle des Bundesverfassungsgerichts bei der Kontrolle des europäischen Wahlrechts.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde die Fünf-Prozent-Hürde im Europawahlrecht gekippt?
Das Bundesverfassungsgericht erklärte sie für nichtig, weil sie gegen die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien verstieß.
Was war das Hauptargument des Gesetzgebers für die Sperrklausel?
Der Gesetzgeber argumentierte mit der Sicherung der Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments und der Vermeidung einer Zersplitterung der Parteienlandschaft.
Was kritisierten die Richter Di Fabio und Mellinghoff in ihren Sondervoten?
Sie sahen den Gestaltungsspielraum des Wahlgesetzgebers durch die Senatsmehrheit zu stark eingeschränkt und warnten vor den Folgen der Zersplitterung.
Musste die Europawahl 2009 nach dem Urteil wiederholt werden?
Nein, das Gericht entschied, dass die Wahl trotz der Nichtigkeit der Klausel nicht wiederholt werden muss.
Welches Risiko birgt die Abschaffung der Sperrklausel für das Parlament?
Es besteht das Risiko einer erschwerten Fraktionsbildung und einer geminderten Effizienz bei Abstimmungen, wenn viele Kleinstparteien vertreten sind.
- Quote paper
- Dominik Mönnighoff (Author), 2011, Das Bundesverfassungsgericht - demokratiefunktionaler Hüter der Verfassung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188427