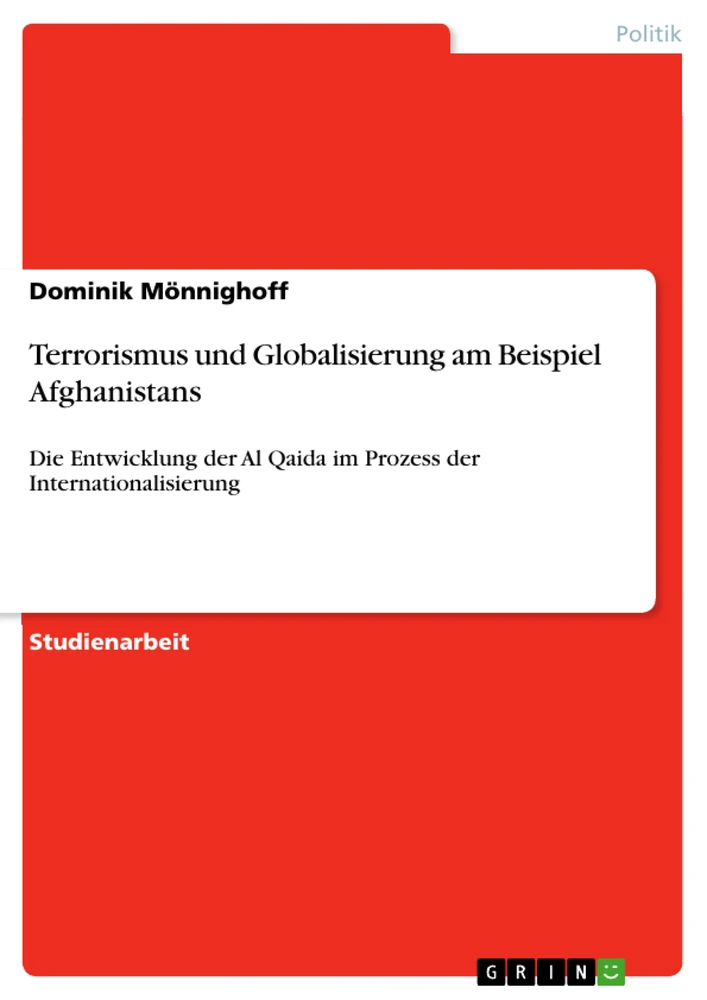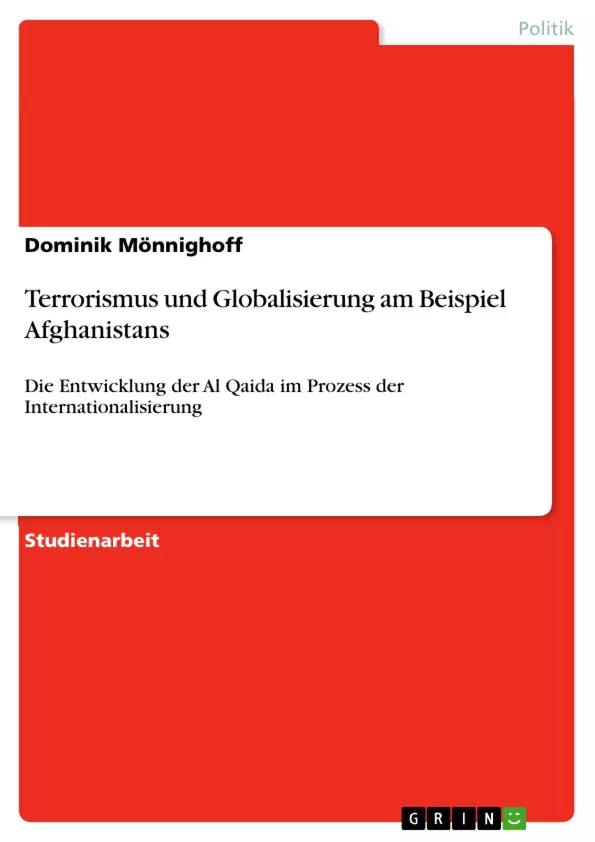Der 11. September 2001 stellt eine historische Wende dar. Nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York wurde deutlich, wie verwundbar die weltpolitische Supermacht trotz modernster Sicherheitsvorkehrungen ist. Die Folgen und Veränderungen, die dieses Datum auf weltpolitischer Ebene hervorruft, sind von nie da gewesener Dimension.
Die Anschläge auf das World Trade Center veränderten das Denken in der westlichen Welt dramatisch. Eine Stimmung der Angst verbreitete sich in den USA und bei ihren Verbündeten. Seither hat sich nicht nur das Warten bei der Personenkontrolle am Flughafen verändert. Vermehrte Präsenz von Polizisten an öffentlichen Plätzen, Hauptverkehrsknotenpunkten und Großveranstaltungen ist seither an der Tagesordnung, exportierende Unternehmen klagen über eine vermehrte Bürokratie und Handelshindernisse durch sicherheitspolitische Maßnahmen. Doch besonders ist es wohl das Denken der Bevölkerung, das sich verändert hat. Eine Stimmung der permanenten Angst und Bedrohung hat sich festgesetzt in den Köpfen der Menschen. Und genau das ist das Ziel des „neuen“ Terrorismus. Ganz nach dem Motto: „Der Guerillero will den Raum, der Terrorist will dagegen das Denken besetzen.“
Doch ist diese Angst berechtigt oder selbstgemacht? Stimmt der Glaube an eine permanente Bedrohung? Fest steht: kein terroristischer Akt hatte jemals eine so große Wirkung auf die Weltpolitik. Und das bedrohliche hieran ist der religiöse Hintergrund. Politisch motivierte Terroristen waren „durchschaubar“, ihre terroristischen Akte hatten einen politischen Zweck zu erfüllen, der nicht durch das Töten möglichst vieler unschuldiger Zivilisten erfüllt werden konnte. Ganz anders ist die Situation beim religiös motivierten Terrorismus. Niemand kann sich in Sicherheit wähnen, zumindest soll dieses Gefühl geschaffen werden – solange er durch die islamistischen Extremisten als Ungläubiger angesehen wird. Doch was sind die Motive der Fundamentalisten? Haben sie konkrete Ziele und wenn ja, wie wollen sie diese durchsetzen? Wie veränderte sich das Vorgehen der Al Qaida bis heute und welchen Ursprung hat die Terrorgruppe?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vom Widerstandskampf der Mujahidin zur terroristisch-dschihadistischen Gruppierung
- Die Internationalisierung des islamistischen Terrorismus
- Die Charakteristika des neuen Terrorismus
- Ziele, Strategie und Selbstverständnis der Al Qaida
- Die Finanzierung des islamistischen Terrorismus
- Die militärischen Interventionen im Nahen und Mittleren Osten
- Der Einfluss der Medien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Al Qaida im Kontext der Internationalisierung und Globalisierung. Sie beleuchtet die Entstehung der Terrorgruppe im Kontext des sowjetischen Eingriffs in Afghanistan und analysiert die Transformation von einer Widerstandsgruppe zu einer transnationalen Terrororganisation.
- Die Transformation der Al Qaida von einer Widerstandsgruppe zu einer transnationalen Terrororganisation
- Die Rolle der Globalisierung und Internationalisierung in der Entwicklung des islamistischen Terrorismus
- Die Charakteristika des neuen Terrorismus, insbesondere die Ziele, Strategien und die Ideologie der Al Qaida
- Die Finanzierung des islamistischen Terrorismus
- Der Einfluss der Medien auf die Islamische Welt und die Propaganda der Al Qaida
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse der Auswirkungen der Terroranschläge vom 11. September 2001 auf die Weltpolitik. Es werden die Folgen für die westliche Welt und die Entstehung einer neuen Angstkultur beleuchtet. Die Arbeit stellt die Frage nach den Motiven islamistischer Extremisten und deren Zielen und Strategien. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle der Globalisierung und dem Einfluss auf die Al Qaida im Kontext Afghanistans.
Vom Widerstandskampf der Mujahidin zur terroristisch-dschihadistischen Gruppierung
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der Al Qaida im Kontext des sowjetischen Eingriffs in Afghanistan. Es wird die Entwicklung der Mujahidin als Widerstandsgruppe gegen die sowjetische Intervention und die Rolle der USA als Unterstützer beleuchtet. Anschließend wird die Entstehung islamistischer Strömungen nach dem Rückzug der Sowjetunion und der USA in Afghanistan, sowie die Al Qaida als eine dieser Strömungen analysiert.
Häufig gestellte Fragen
Wie entstand Al Qaida ursprünglich?
Al Qaida entwickelte sich aus dem Widerstandskampf der Mujahidin gegen die sowjetische Invasion in Afghanistan in den 1980er Jahren.
Was unterscheidet den "neuen" religiösen Terrorismus vom alten?
Im Gegensatz zu politisch motivierten Terroristen zielt der religiöse Terrorismus oft auf eine maximale Anzahl ziviler Opfer ab und verfolgt transnationale, ideologische Ziele statt lokaler politischer Kompromisse.
Welche Rolle spielt die Globalisierung für den Terrorismus?
Die Globalisierung ermöglicht Terrorgruppen eine weltweite Vernetzung, einfache Finanzströme und die Nutzung moderner Medien zur Verbreitung von Propaganda.
Wie finanzieren sich islamistische Terrorgruppen?
Die Finanzierung erfolgt über ein komplexes Netzwerk aus privaten Spendern, illegalem Handel (z.B. Drogen) und zum Teil durch die Kontrolle von Ressourcen in Krisengebieten.
Was war die historische Bedeutung des 11. September 2001?
Das Datum markiert eine Wende in der Weltpolitik, die zu massiven militärischen Interventionen im Nahen Osten und einer dauerhaften Veränderung der globalen Sicherheitspolitik führte.
- Arbeit zitieren
- Dominik Mönnighoff (Autor:in), 2011, Terrorismus und Globalisierung am Beispiel Afghanistans, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188433