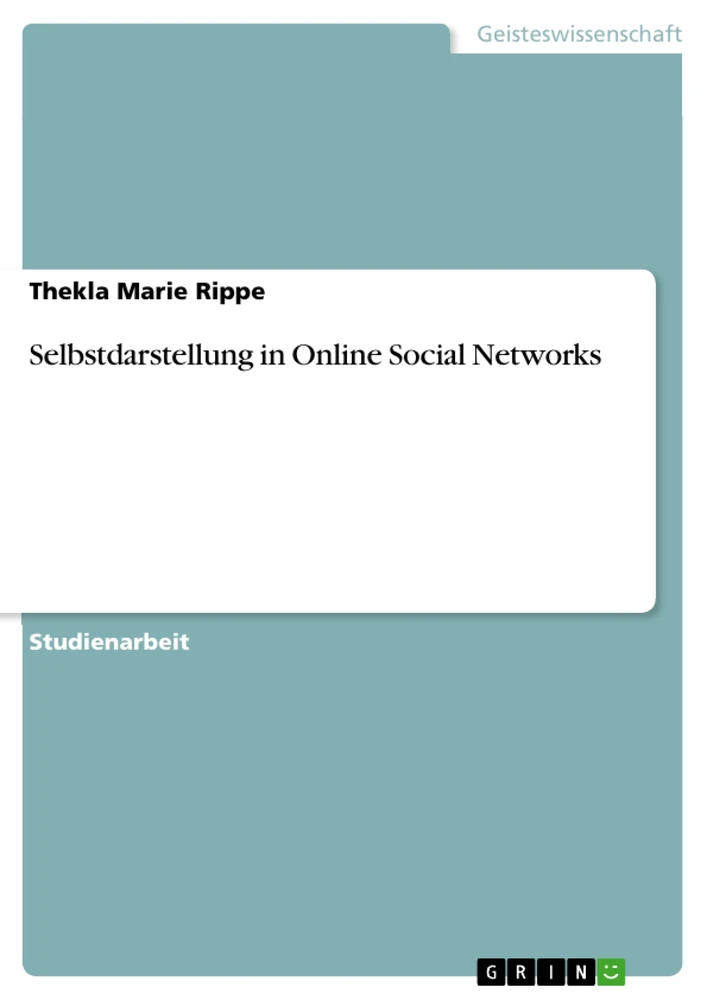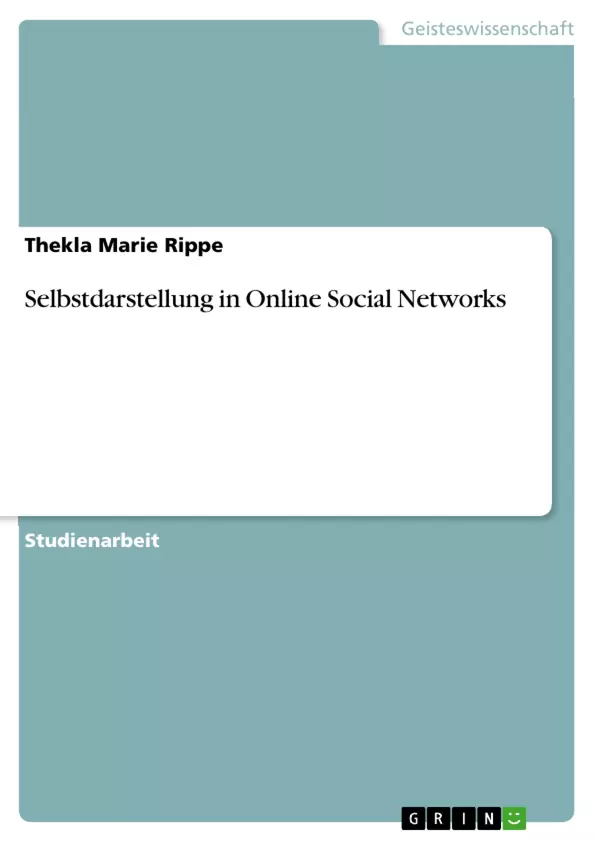Vor einiger Zeit durfte ich bei der Planung und Mitgestaltung einer Vertonung von Psalmen und dazu passenden Prosatexten sowie einzelnen Psalmausschnitten mitwirken. Die Vorbereitung war langwierig aber letztendlich fruchtbar. Zum zentralen Thema der Gesamtaufnahme wählten wir die Psalmen. Nach Fertigstellung des Programms wurde das Cover unserer CD mit dem Zitat: „Psalmen sind wie der Sternenhimmel: Je länger man hinsieht, desto mehr entdeckt man“, versehen. Dabei interessierte ich mich schon vor diesem Projekt für das biblische Buch der Psalmen. Nun war mein Interesse mehr denn je für diese geweckt worden. Da allein das Lesen der Psalmen nicht genügt, entschloss ich mich im Rahmen meiner Seminararbeit für eine ausführlichere Befassung mit der Kunst dieser Dichtung. Ich habe mich für den Seminarkurs: Mathematik zum Anfassen mit dem Schwerpunkt Astronomie bzw. „Augen im All“ entschieden. Dabei sind die Psalmen auf den ersten Blick nicht wirklich in diese Thematik einzuordnen. Dennoch haben beide Themenbereiche etwas gemeinsam, nämlich die Herangehensweise an die Materie. Um Nutzen aus der Astronomie ziehen zu können, bedurfte es hunderte von Jahren der Erforschung des Weltalls. Heute bestaunen wir all jene Menschen, die sich trotz persönlicher Gefahrenlage motiviert durch ihr großes Interesse, dieser naturwissenschaftlichen Forschungen in Geduld und Kampf gegen die Kirche hingaben. Und das mit Erfolg für die gesamte Naturwissenschaft und dem Auftrag zum „Weiterforschen“ für die Menschheit!
Ebenso wie die Geschichte der Astronomie fasziniert mich die Dichtkunst der Psalmen, denn auch diese konnten im Laufe der Jahrhunderte mehr und mehr in ihrer Bedeutung erfasst werden. Heute kann sie als vollständiges Buch gelesen, gedeutet, bewertet ja vor allem auch persönlich als Trost und Ermutigung angewendet werden. Der Titel soll hiermit das Wunderwerk der Natur, insbesondere das Weltall, welches auch oft von den Psalmisten bewundert wurde und zur Inspiration des Gebets anregte, mit dem Thema der religiösen Dichtung vereinen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Grundlagen
- Selbstdarstellung, Impression Management und Identität
- Online Social Networks
- Selbstdarstellung in Online-Social-Networks
- Online-Selbstdarstellung
- Funktionen von Online Social Networks zur Selbstdarstellung
- Ausgewählte Studien zur Selbstdarstellung in Online Social Networks
- Diskussion
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Selbstdarstellung in Online Social Networks. Das Ziel ist es, die Auswirkungen dieser Form der Selbstdarstellung auf das Selbstbild und die Interaktion zwischen Nutzern zu untersuchen.
- Begriffliche Grundlagen der Selbstdarstellung, Impression Management und Identität
- Die Rolle von Online Social Networks im Kontext der Selbstdarstellung
- Funktionen von Online Social Networks, die die Selbstdarstellung beeinflussen
- Aktuelle Forschungsbefunde zu Selbstdarstellungsstrategien in Online Social Networks
- Diskussion der potenziellen Auswirkungen von Online-Selbstdarstellung auf das Selbstbild und die soziale Interaktion
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz der Selbstdarstellung in Online Social Networks in Bezug auf die alltägliche Interaktion dar und definiert die Forschungsfrage: Inwiefern beeinflusst die Selbstdarstellung durch Online Social Networks das Selbstbild und die Wahrheitsgetreue der Darstellung?
- Begriffliche Grundlagen: Das Kapitel beleuchtet die theoretischen Konzepte der Selbstdarstellung, des Impression Managements und der Identität. Es werden die Faktoren Extraversion, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen als wichtige Einflussgrößen auf die Selbstdarstellung erläutert.
- Selbstdarstellung in Online-Social-Networks: Dieses Kapitel betrachtet die Online-Selbstdarstellung und ihre Funktionen innerhalb von Online Social Networks. Es werden verschiedene Strategien und Techniken der Selbstdarstellung in Online Social Networks vorgestellt.
- Ausgewählte Studien zur Selbstdarstellung in Online Social Networks: Dieser Abschnitt präsentiert Ergebnisse aus einschlägigen Studien, die sich mit der Selbstdarstellung in Online Social Networks auseinandersetzen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte der Arbeit sind: Selbstdarstellung, Impression Management, Identität, Online Social Networks, Social Media, Online-Selbstdarstellung, Selbstbild, soziale Interaktion, Wahrheitsgetreue, Forschungsbefunde.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Impression Management in sozialen Netzwerken?
Impression Management bezieht sich auf die bewusste Steuerung des Eindrucks, den andere von einem haben. In Online Social Networks nutzen User verschiedene Strategien, um ihr Selbstbild gezielt zu präsentieren.
Wie beeinflusst die Selbstdarstellung online das Selbstbild?
Die Arbeit untersucht, inwiefern die (oft idealisierte) Darstellung in sozialen Medien auf das tatsächliche Selbstbild zurückwirkt und welche Rolle Faktoren wie Selbstwertgefühl und Extraversion dabei spielen.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Astronomie und Psalmen in dieser Arbeit?
Im Abstract beschreibt der Autor eine persönliche Motivation: Beide Bereiche erfordern Geduld und eine tiefe Auseinandersetzung mit der Materie, um "mehr zu entdecken". Die eigentliche Hausarbeit konzentriert sich jedoch auf die Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken.
Welche Funktionen von Social Networks fördern die Selbstdarstellung?
Funktionen wie Profilseiten, das Teilen von Fotos, Status-Updates und Interaktionsmöglichkeiten (Likes, Kommentare) bieten Nutzern Werkzeuge, um ihre Identität digital zu konstruieren.
Wie wahrheitsgetreu ist die Selbstdarstellung in Online Social Networks?
Die Forschungsfrage der Arbeit lautet unter anderem, inwiefern die Selbstdarstellung die Wahrheitsgetreue der Darstellung beeinflusst, da Nutzer oft versuchen, ein optimiertes Bild ihrer selbst zu vermitteln.
- Quote paper
- Thekla Marie Rippe (Author), 2011, Selbstdarstellung in Online Social Networks, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188497