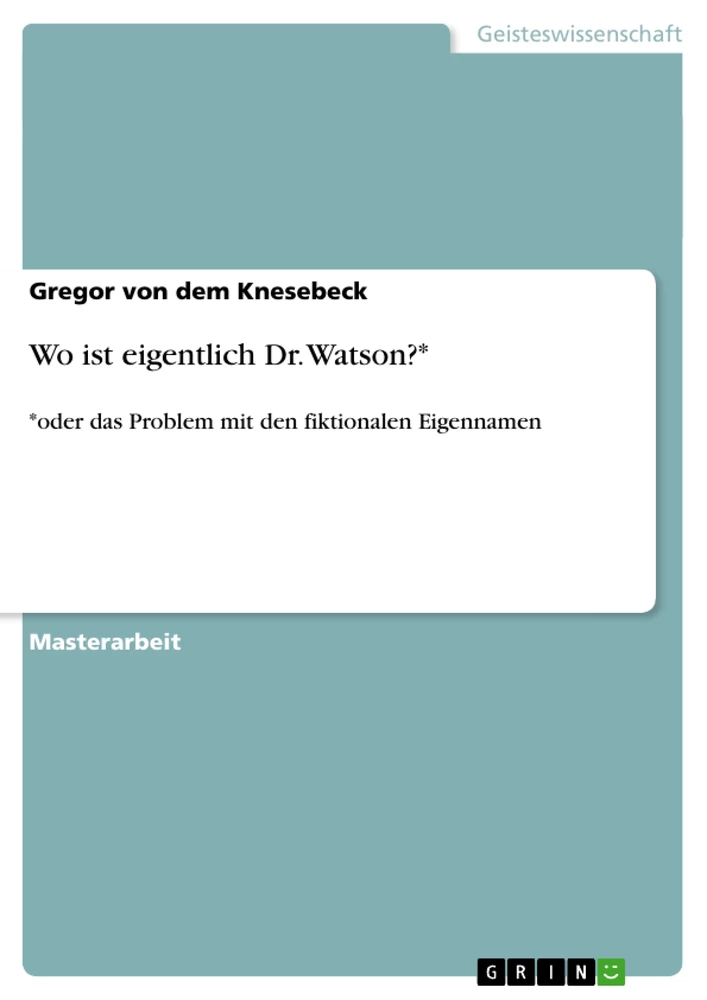«It is simple enough as you explain it,»
I said, smiling.
«You remind me of Edgar Allan Poe’s Dupin.
I had no idea that such individuals
did exist outside of stories.»
Dr. Watson zu Sherlock Holmes
in A study in scarlet
von Sir Arthur Conan Doyle
[...]
Eigennamen stellen ein notorisches Problem in der analytischen Philosophie dar. Auf welcher Grundlage, so fragt man sich, kann man über Wahrheit oder Falschheit von Sätzen entscheiden, die Eigennamen enthalten. Auch wenn wir im Alltag zunächst kein Problem damit haben, uns mit Eigennamen über Einzeldinge zu verständigen, so stellt für viele Philosophen das Verstehen dieser Bezugnahmen eine Schwierigkeit dar.3 Eine Schwierigkeit besteht zunächst darin, anzugeben, wie ein Eigenname überhaupt ein Objekt herausgreifen kann.4 Eine andere besteht in der Frage, was es eigentlich ist, das Eigennamen herausgreifen. Es besteht Uneinigkeit darüber, welcher Art das Herausgegriffene sein muss, damit es als Bezugsobjekt für einen Eigennamen in Frage kommt. Um die Ausgangsfrage aus §1.1 beantworten zu können, wie wir mit Sätzen wie S2 Wissen vermitteln können, werde ich mich mit der Frage befassen, wie Eigennamen und Referenzprinzip (RP) zusammenhängen. Wie so oft in philosophischen Debatten bietet es sich an, das Problem anhand von Beispielsätzen zu motivieren.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1 Das Dilemma mit den fiktionalen Eigennamen
- § 1.1 Sätze & Kommunikation I
- § 1.2 Eigennamen & Wahrheit
- § 1.3 Existenzbegriff
- § 1.4 Handwerkszeug
- § 1.5 Sätze & Bedeutung
- § 1.6 Sind fiktionale Eigennamen pseudo-Eigennamen?
- § 1.7 Dilemma & Lösungsstrategien
- Kapitel 2 Semantische Ansätze I
- § 2.1 Objekttheorien (Motivation & Ziel)
- § 2.2 Arten von Beispielsätzen
- § 2.3 Nicht-existierende Objekte (à la Parsons)
- § 2.4 Dilemma & nicht-existierende Objekte
- § 2.5 Einwände zu Parsons
- § 2.6 Existierende abstrakte Objekte (à la van Inwagen)
- § 2.7 Dilemma & abstrakte Objekte
- § 2.8 Einwände zu van Inwagen
- Kapitel 3 Semantische Ansätze II
- § 3.1 Paraphrasestrategie (Motivation & Voraussetzung)
- § 3.2 Intensionale & extensionale Kontexte
- § 3.3 Werkskonstitutive Sätze & Verwendung
- § 3.4 Interne fiktionale Sätze
- § 3.5 Externe fiktionale Sätze
- § 3.6 Intensionale Kontexte & fiktionale Eigennamen
- § 3.7 Dilemma & Paraphrase-Strategie
- Kapitel 4 Pragmatische Ansätze
- § 4.1 Was ist ein fiktionaler Text?
- § 4.2 Fiktionale Texte & Wahrheit
- § 4.3 Intention & fiktionale Texte I
- § 4.4 Dilemma & pretense
- § 4.5 Intention & fiktionale Texte II
- § 4.6 Sätze & Kommunikation II
- § 4.7 Was sind fiktionale Eigennamen?
- Kapitel 5 Begriffswortthese
- § 5.1 Kriterien für Theorien fiktionaler Eigennamen
- § 5.2 Begriffswörter
- § 5.3 Begriffswortthese
- § 5.4 Begriffswortthese & Beispielsätze
- § 5.5 Begriffswortthese & Kriterien
- § 5.6 Vorteile der Begriffswortthese
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Dilemma fiktionaler Eigennamen und untersucht verschiedene theoretische Ansätze zur Klärung der semantischen und pragmatischen Aspekte dieser sprachlichen Phänomene. Ziel ist es, die Problematik der Referenz von fiktionalen Eigennamen im Kontext von Wahrheit und Bedeutung zu beleuchten.
- Das Referenzproblem fiktionaler Eigennamen
- Semantische Ansätze zur Erklärung der Referenz
- Pragmatische Ansätze zur Erklärung der Referenz
- Die Rolle der Intention und des Pretense
- Die Bedeutung der Begriffswortthese
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Das Dilemma mit den fiktionalen Eigennamen
Dieses Kapitel führt das Problem der Referenz fiktionaler Eigennamen ein und stellt das zentrale Dilemma dar: Wie können wir über fiktive Figuren sprechen, die in der realen Welt nicht existieren? Das Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte des Problems, wie die Rolle von Sätzen in der Kommunikation und den Unterschied zwischen realen und fiktionalen Eigennamen.
Kapitel 2: Semantische Ansätze I
Dieses Kapitel behandelt verschiedene semantische Ansätze zur Klärung des Dilemmas. Es werden Objekttheorien von Parsons und van Inwagen vorgestellt und deren Stärken und Schwächen diskutiert. Die Kapitel beleuchten die Frage, ob fiktive Figuren als nicht-existierende oder als abstrakte Objekte verstanden werden können.
Kapitel 3: Semantische Ansätze II
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Paraphrasestrategie als einen weiteren semantischen Ansatz zur Lösung des Dilemmas. Es wird untersucht, wie fiktionale Sätze durch paraphrasierte Aussagen über reale Sachverhalte interpretiert werden können. Die Kapitel beleuchtet die Rolle von intensionalen und extensionalen Kontexten und die Unterscheidung zwischen internen und externen fiktionalen Sätzen.
Kapitel 4: Pragmatische Ansätze
Dieses Kapitel widmet sich pragmatischen Ansätzen zur Erklärung der Referenz von fiktionalen Eigennamen. Es werden die Rolle der Intention und des Pretense in der Konstruktion fiktionaler Welten untersucht. Die Kapitel diskutiert, wie fiktionale Texte den Leser zum „Make-believe" anregen und welche Auswirkungen dies auf die Interpretation von Sätzen hat.
Kapitel 5: Begriffswortthese
Dieses Kapitel stellt die Begriffswortthese als eine mögliche Lösung des Dilemmas vor. Die These argumentiert, dass fiktive Eigennamen nicht als Referenz auf reale Objekte verstanden werden sollten, sondern als Begriffswörter, die bestimmte fiktionale Konzepte repräsentieren. Das Kapitel diskutiert die Vorteile der Begriffswortthese im Vergleich zu anderen Ansätzen.
Schlüsselwörter
Fiktionaler Eigenname, Referenz, Bedeutung, Wahrheit, Objekttheorie, Paraphrasestrategie, Pragmatik, Intention, Pretense, Make-believe, Begriffswortthese, fiktionale Welt.
- Quote paper
- Gregor von dem Knesebeck (Author), 2006, Wo ist eigentlich Dr. Watson?*, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188503