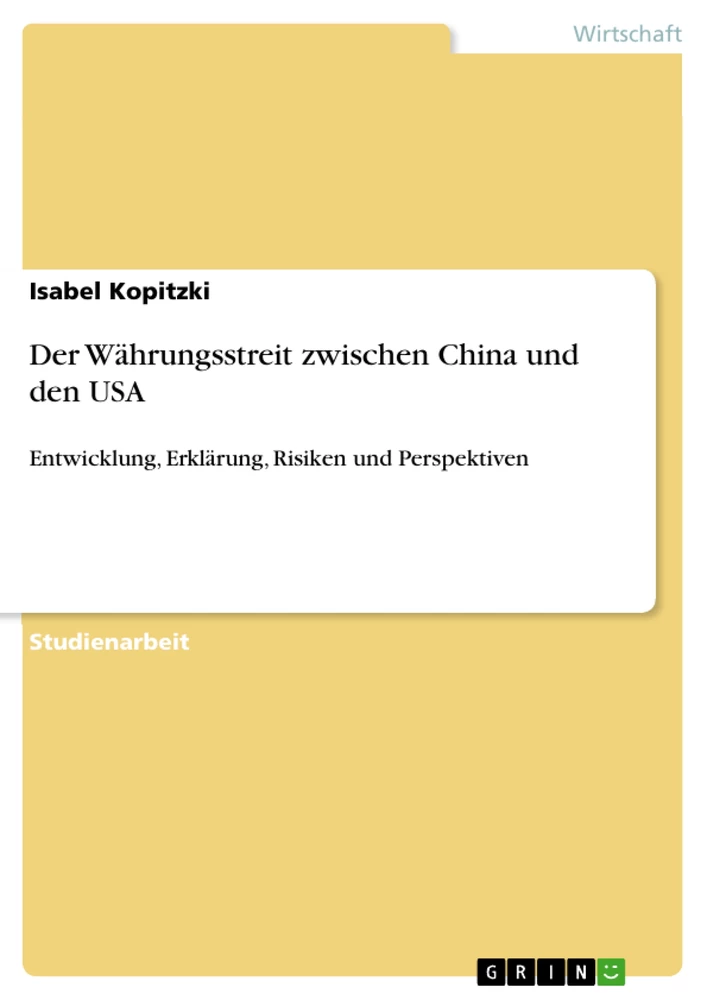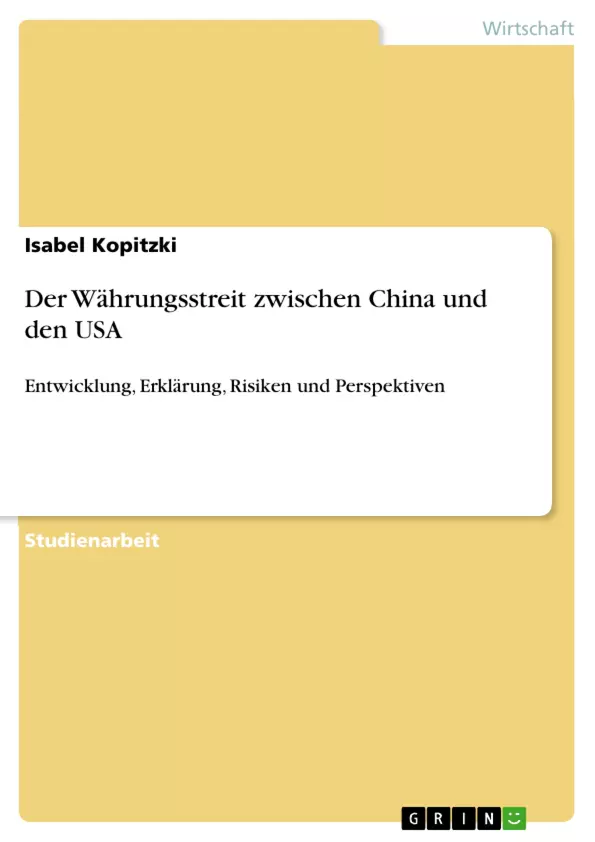Die Währung eines Landes ist stets ein sehr sensibles wirtschaftliches und politisches Thema, da die Chancen der Exportindustrie sowie die Inflationsrate maßgeblich von der Festigkeit dieser abhängen. Für Politiker haben Währungen nicht nur die Funktion eines bloßen Zahlungsmittels, sondern sie werden gezielt als Angriffs- oder Verteidigungswaffe eingesetzt.“
Bei einem ideologisch geprägtem Staat, wie China ist dabei die Devisensensibilität besonders stark ausgebildet. Für China hat der Yuan übergeordnete und strategische Priorität. Dies ist schon allein daran erkennbar, dass nicht die Notenbank die Verantwortung für den Außenwert des Yuans trägt, sondern die Regierung selbst. Der Wert der chinesischen Währung ist nicht frei, sondern wird bewusst von Chinas Zentralbank gesteuert. So sind auch unangemeldete Ein- und Ausfuhren des Yuan, ebenso wie der freie Tausch gegen andere Valuten verboten.
Das Wachstum des Bruttoinlandproduktes weltweit lag in den letzten Jahren bei durchschnittlich etwa 4%, allein ein Drittel davon entfallen auf China. So wird China neben den Ausgaben der amerikanischen Privathaushalte zu einem treibenden Motor der Weltwirtschaft und rückt immer mehr in das Zentrum wirtschaftlichter Betrachtungen und Diskussionen. Anhand der Kaufkraftparität, welche die Wechselkurse zwischen zwei Ländern aus dem Vergleich der Lebensstandards beider errechnet, können das chinesische und das amerikanische BIP miteinander verglichen werden. Demnach betrug die chinesische Wirtschaftstätigkeit bereits im Jahre 2005 zwei drittel der amerikanischen und laut einer Studie von Goldman Sachs werden sich die Entwicklungslinien beider Länder in 2040 überschneiden.
Die Volkswirtschaften Asiens sind dem Import fast völlig verschlossen und verfolgen hauptsächlich das Ziel des Exports, wobei sie durch ihre unterbewertete Währung Wettbewerbsvorteile erlangen wollen, die ihnen bei der aggressiven Eroberung neuer Märkte helfen sollen.
Diese Manipulation des Wechselkurses missfällt den anderen Handelsnationen und dabei vor allem Amerika sehr, da ihnen dadurch enorme Nachteile entstehen. Die Aufforderungen den Yuan aufzuwerten, werden daher immer vehementer. „Der Wechselkurs zwischen der chinesischen und der amerikanischen Währung (...) ist die vielleicht wichtigste und umkäpfteste Grenze des 21. Jahrhunderts.“
So hat Amerika bereits die Einführung von Strafzöllen auf chinesische Waren eingeleitet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die chinesische Währungspolitik
- Die Entwicklung des Yuan
- Die Flexibilisierung des chinesischen Wechselkurses
- Der Disput um den Wechselkurses des Yuan
- Der Standpunkt Amerikas - Argumente für eine Flexibilisierung des Wechselkurses des Yuan
- Der Standpunkt Chinas - Argumente für einen festen Wechselkurs des Yuan
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Währungsstreit zwischen China und den USA und beleuchtet dessen Entwicklung, Ursachen, Risiken und Perspektiven.
- Entwicklung des chinesischen Yuan
- Flexibilisierung des chinesischen Wechselkurses
- Argumente für und gegen eine feste und flexible Währungspolitik
- Risiken und Auswirkungen des Währungsstreits
- Zukünftige Perspektiven des Währungsstreits
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einleitung zum Thema und skizziert den Rahmen der Arbeit. Das zweite Kapitel befasst sich mit der chinesischen Währungspolitik und beleuchtet die Entwicklung des Yuan und die Flexibilisierung des Wechselkurses. Das dritte Kapitel analysiert den Disput um den Wechselkurs des Yuan aus der Perspektive der USA und Chinas, wobei die jeweiligen Argumente für eine Flexibilisierung bzw. einen festen Wechselkurs dargelegt werden.
Schlüsselwörter
Chinesische Währungspolitik, Yuan, Wechselkurs, Währungsstreit, USA, China, Flexibilisierung, feste Währungspolitik, Kaufkraftparität, Big Mac Index.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Wechselkurs des Yuan politisch so brisant?
Der Yuan wird gezielt von der chinesischen Regierung gesteuert, um Exportvorteile zu erlangen, was zu Spannungen mit Handelsnationen wie den USA führt.
Welchen Standpunkt vertreten die USA im Währungsstreit?
Die USA fordern eine Flexibilisierung und Aufwertung des Yuan, da sie durch die künstliche Unterbewertung wirtschaftliche Nachteile und Wettbewerbsverzerrungen sehen.
Was sind Chinas Argumente für einen festen Wechselkurs?
China betont die Notwendigkeit von Stabilität für das eigene Wirtschaftswachstum und lehnt eine schnelle Flexibilisierung aus strategischen Prioritäten ab.
Was ist die Bedeutung der Kaufkraftparität in diesem Kontext?
Sie dient als Vergleichsmaßstab für die Lebensstandards und zeigt, dass Chinas Wirtschaftstätigkeit real oft höher eingeschätzt wird als durch reine Wechselkurse.
Welche Maßnahmen haben die USA gegen die chinesische Währungspolitik eingeleitet?
Amerika hat unter anderem die Einführung von Strafzöllen auf chinesische Waren als Reaktion auf die vermeintliche Wechselkursmanipulation eingeleitet.
- Quote paper
- Master of Arts in International Insurance Isabel Kopitzki (Author), 2010, Der Währungsstreit zwischen China und den USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188550