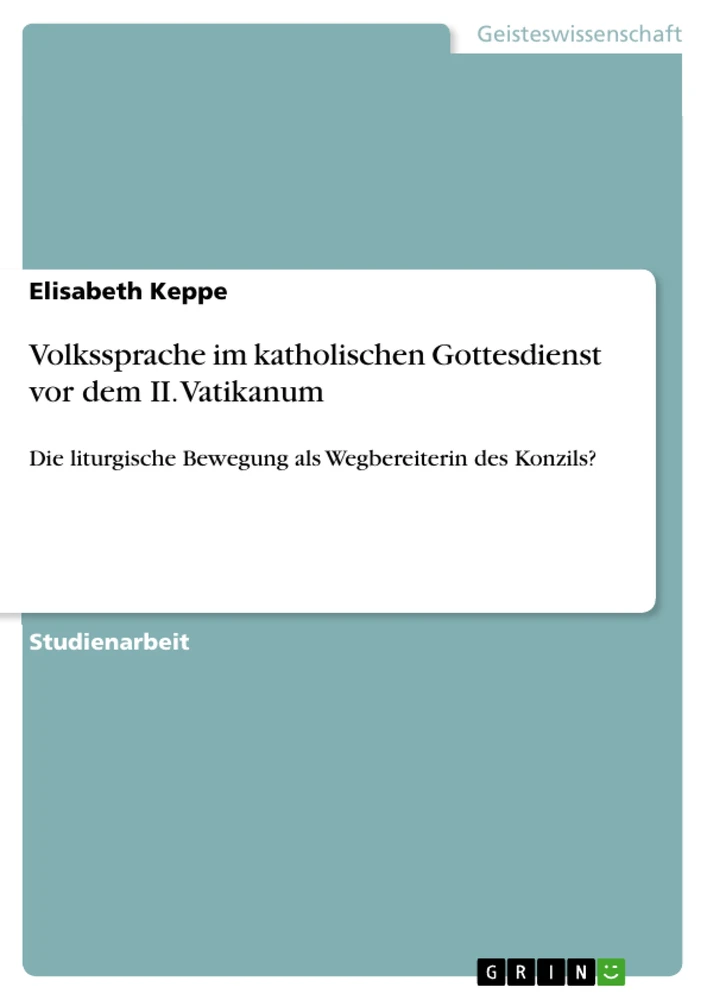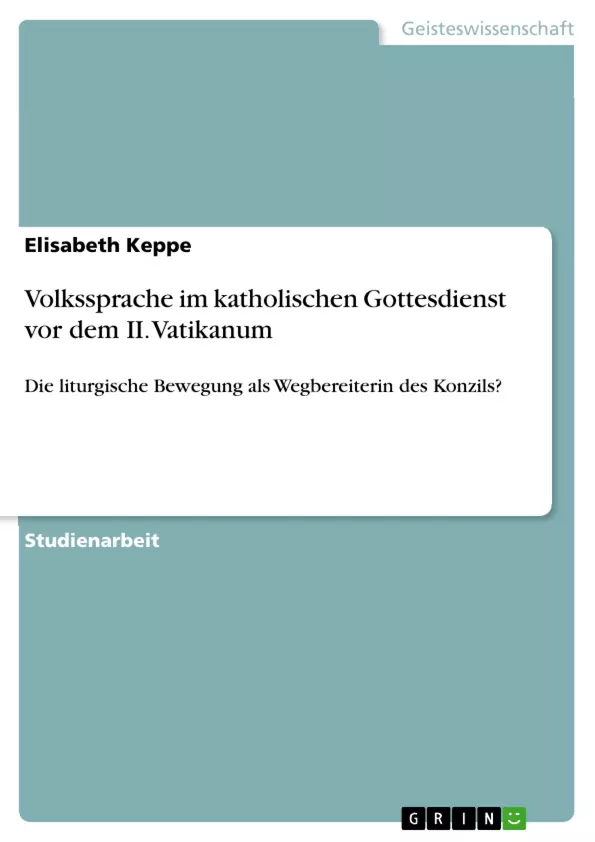Wer heutzutage den Gottesdienst in einer katholischen Kirche besucht, wird in der Regel keine Sprachbarriere zu überwinden haben – die Feier wird fast immer in der Volkssprache abgehalten. Dies ist aber erst seit ungefähr vierzig Jahren der Fall. Bereits lange Zeit vorher gab es Bestrebungen dazu, die Volkssprache in den Gottesdienst einzuführen. Eine hierzu maßgebende theologische Strömung des 20. Jahrhunderts wird „Liturgische Bewegung“ genannt.
Um die Rolle der Liturgischen Bewegung bei der Einführung der Volkssprache in den Gottesdienst angemessen beurteilen zu können, ist es notwendig, sich einen Überblick über die historischen Begebenheiten zu verschaffen.
Seit 1570 lag ein durch Papst Pius V. reformiertes Missale vor, das zugleich mit der Bestimmung verbunden war, „daß in Zukunft an der Messe nichts mehr geändert werden dürfe“ .
Dieses Missale hatte die lateinische Sprache als Liturgiesprache vorgesehen, weil es die Konzilsväter nicht für richtig hielten, die Liturgie, wenn auch nur in seltenen Fällen, in der Volkssprache zu feiern, obwohl die Messe inhaltliche Anregungen für das Volk enthält.
Bis zur Liturgiereform im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) war damit die lateinische „missa recitata“ vorherrschend, die „streng und ohne jedes Zugeständnis an Volkstümlichkeit gehalten“ wurde.
Befürworter der lateinischen Sprache als diejenige, die für die Liturgie vorgeschrieben war, begründeten dies zum Einen mit der „Majestät“ der lateinischen Sprache, weil sie eine feierliche Atmosphäre schafft, zum Anderen mit der Fähigkeit des Lateinischen die Völker zu einen, indem in allen katholischen Gottesdiensten auf jedem Erdteil die gleiche Sprache gesprochen werde, oder aber mit einer „Untauglichkeit“ der Volkssprachen für das Anstimmen des Lobes Gottes, weil ihnen auch zu Jesu Zeiten noch nicht die Ehre zuteil geworden war, bei Jesus gesprochen worden zu sein.
Die Liturgische Bewegung jedoch wollte den Versuch wagen, diese Fixierung auf die lateinische Sprache im katholischen Gottesdienst zu hinterfragen und zu verändern. Ihre Rolle für die Einführung der Volkssprache soll im Folgenden untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Ausgangssituation
- 1.2 Die Liturgische Bewegung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Versuche zur Einführung der Volkssprache in den katholischen Gottesdienst
- 2.2 Das Streben der Liturgischen Bewegung nach Volkssprache im Gottesdienst
- 2.2.1 Übersetzungen zur Mitfeier der Messe
- 2.2.2 Volkssprache im Gottesdienst
- 2.2.3 Die Krise der Liturgischen Bewegung und ihre Folgen bis zum II. Vatikanum
- 2.3 Das Zweite Vatikanische Konzil und seine Beschlüsse zur Liturgiesprache
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Rolle der Liturgischen Bewegung bei der Einführung der Volkssprache im katholischen Gottesdienst vor dem II. Vatikanischen Konzil. Sie beleuchtet die historischen Entwicklungen und die Argumente der Liturgischen Bewegung, die für eine lebendigere und verständlichere Liturgie eintraten.
- Die historische Entwicklung der Liturgie und die Dominanz des Lateinischen
- Die Anfänge der Liturgischen Bewegung und ihre Forderung nach aktiver Teilnahme
- Die Versuche zur Einführung der Volkssprache im Gottesdienst vor dem II. Vatikanum
- Die Argumente und Forderungen der Liturgischen Bewegung für den Gebrauch der Volkssprache
- Die Auswirkungen der Liturgischen Bewegung auf die Liturgiesprache des katholischen Gottesdienstes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Das erste Kapitel beleuchtet die Ausgangssituation vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung der Liturgie und die Dominanz des Lateinischen als Liturgiesprache. Es stellt die Liturgische Bewegung als maßgebliche Strömung des 20. Jahrhunderts vor, die sich für eine lebendigere und verständlichere Liturgie einsetzte.
2. Hauptteil
Der Hauptteil befasst sich mit den Versuchen zur Einführung der Volkssprache im katholischen Gottesdienst. Er betrachtet das Streben der Liturgischen Bewegung nach Volkssprache in der Liturgie und analysiert die verschiedenen Argumente, die für und gegen die Volkssprache im Gottesdienst vorgebracht wurden. Es werden auch die Herausforderungen und die Folgen für die Liturgische Bewegung bis zum II. Vatikanum beleuchtet.
Schlüsselwörter
Liturgische Bewegung, Volkssprache, Gottesdienst, lateinische Sprache, römisches Missale, Aktive Teilnahme, Liturgiereform, Zweites Vatikanisches Konzil.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die Volkssprache im katholischen Gottesdienst offiziell eingeführt?
Die umfassende Einführung der Volkssprache erfolgte im Zuge der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962–1965).
Was war die „Liturgische Bewegung“?
Eine theologische Strömung des 20. Jahrhunderts, die sich für eine aktivere Teilnahme der Gläubigen am Gottesdienst und eine verständlichere Liturgie einsetzte.
Warum wurde so lange an der lateinischen Sprache festgehalten?
Befürworter sahen im Lateinischen eine einigende Weltsprache der Kirche und betonten die feierliche „Majestät“ des Lateins, die eine sakrale Atmosphäre schafft.
Was bedeutet der Begriff „missa recitata“?
Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmesse, bei der die Gläubigen die lateinischen Gebete gemeinsam mit dem Priester sprechen, statt nur still beizuwohnen.
Welchen Einfluss hatte das Konzil von Trient auf die Liturgiesprache?
Das Konzil von Trient legte im 16. Jahrhundert fest, dass die Messe grundsätzlich in Latein zu feiern sei, was bis zum II. Vatikanum die verbindliche Norm blieb.
- Citar trabajo
- Elisabeth Keppe (Autor), 2008, Volkssprache im katholischen Gottesdienst vor dem II. Vatikanum, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188631