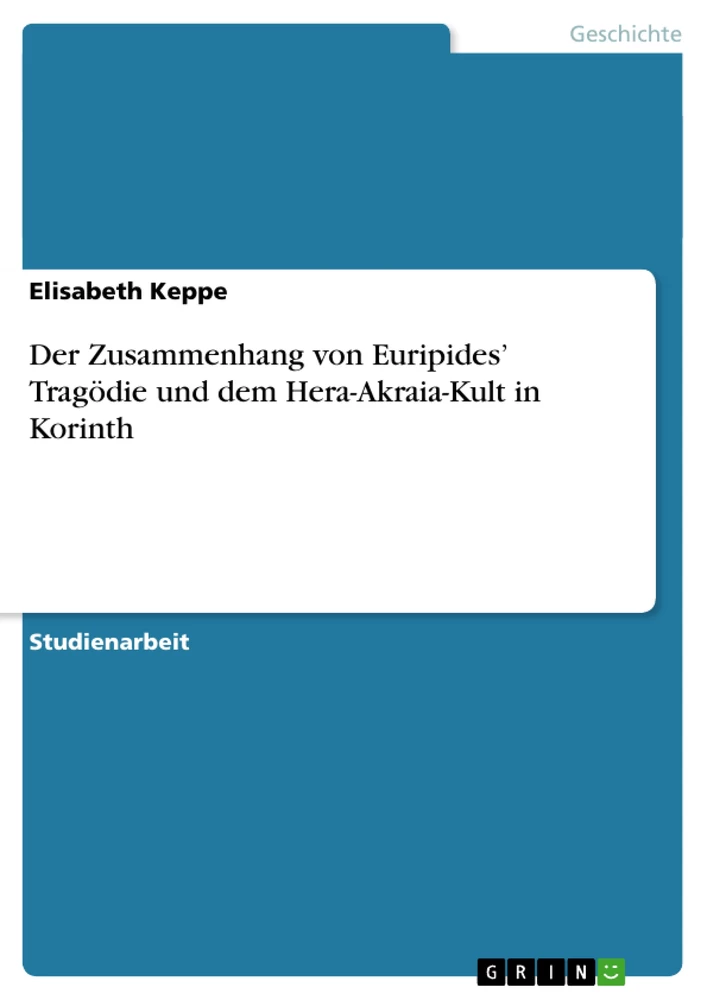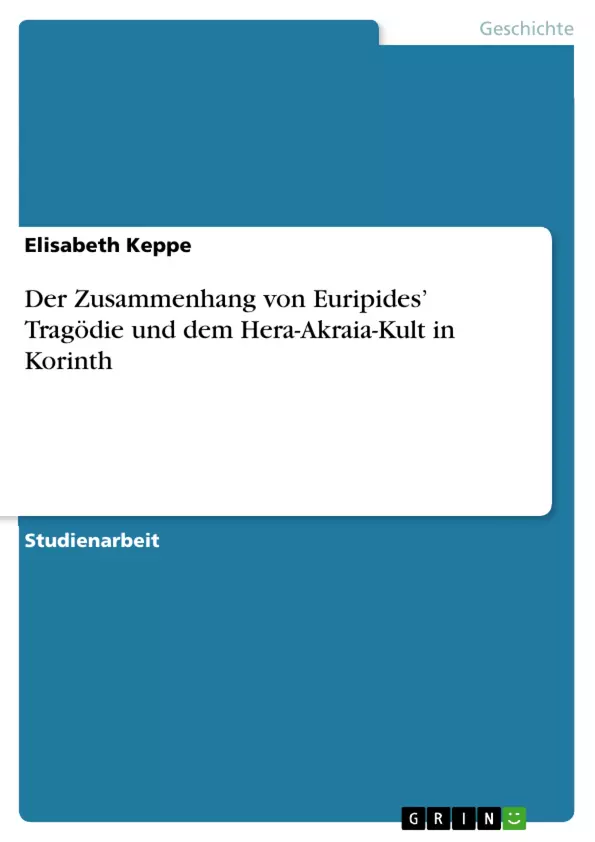Bis heute gilt Euripides wohl als einer der beliebtesten antiken Tragiker. Das Stück „Medea“ zählt zu seinen größten Werken, das auch heute noch eine besondere Faszination auf den Zuschauer ausübt.
In dieser großen psychologischen Charakterstudie einer in ihrer Seele zutiefst getroffen Frau verhallen beim Zuschauer die Worte Medeas, die sie fast am Ende des Stückes zu Jason spricht, während sie die von ihr getöteten Kinder in den Armen hält und auf einem mit Drachen bespannten Wagen steht:
„Ich möchte sie mit meiner Hand begraben, sie tragen in das Heiligtum der Göttin Hera Akraia, daß kein Feind sie schände und ihr Grab aufwühle. Und dem Land des Sisyphos will ich ein Götterfest und Opfer stiften für die Zukunft, diesem frevelhaften Mord zur Sühne.“ (V. 1378-1383)
Für den Zuschauer klingt das ziemlich abstrakt: Er weiß nicht viel mit dem genannten Heiligtum anzufangen, weil er es nicht kennt, und auch unter den angekündigten Götterfesten und Kulten kann er sich in den meisten Fällen wahrscheinlich nichts Konkretes vorstellen.
In der Antike war das anders. Hier schilderten die Worte die Umgebung der Zuschauer, vertraute Riten, wohlbekannte Schicksale. Was sie tatsächlich über die Riten gewusst haben, kann heute natürlich nicht mehr zweifelsfrei geklärt werden. Man kann jedoch mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass die Besucher des Stückes mit Geschichten, die etwas mit Medea zu tun hatten, nicht nur vertraut waren, sondern wohl auch die Riten kannten, die im Tempel von Hera Akraia zu Ehren der Kinder vollzogen wurden.
Folgend soll in diesen Ausführungen das oben genannte verständlich gemacht und untersucht werden, inwiefern ein schon bestehender Kult Euripides beeinflusst hat.
Versuchte Euripides, einen bestehenden Kult durch seine Erzählung zu erklären? Gibt es verschiedene Erklärungsmöglichkeiten für die Riten der Hera Akraia? Warum erwähnte Euripides überhaupt die Hera Akraia? Was brachte Euripides Neues für den Kult?
Diesen und anderen Fragen soll nun im Folgenden nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Mögliche Ursprünge und Gründe der Ätiologie
- 2.2 Die unterschiedlichen Versionen des Kindstodes
- 2.3 Die Bedeutung der Hera Akraia
- 2.4 Das Begräbnis der Kinder
- 2.5 Theorie von den zwei verbundenen Medea-Bildern
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Euripides' Tragödie "Medea" und dem Hera-Akraia-Kult in Korinth. Ziel ist es, zu ergründen, inwieweit der bereits existierende Kult Euripides beeinflusst hat und wie die Darstellung in der Tragödie mit den bestehenden Überlieferungen und Ritualen des Kults in Beziehung steht.
- Der Hera-Akraia-Kult in Korinth und seine Rituale
- Die verschiedenen Versionen der Medea-Erzählung und ihre Verbindung zum Kult
- Die Rolle Medeas und ihrer Kinder im Kult
- Die Ätiologie in Euripides' "Medea" als Erklärung für den Kult
- Der Einfluss des Kults auf die Gestaltung von Euripides' Tragödie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Einfluss des Hera-Akraia-Kults auf Euripides' Tragödie "Medea". Sie verweist auf die Schlussrede Medeas, in der sie die Bestattung ihrer Kinder im Heiligtum der Hera Akraia ankündigt, und betont die Bedeutung des Kontextes für das Verständnis des antiken Publikums. Die Einleitung skizziert das Forschungsvorhaben, welches die Beziehung zwischen dem bereits bestehenden Kult und Euripides' Werk untersuchen soll, und hebt die Bedeutung des korinthischen Hera-Akraia-Tempels hervor, der angeblich von Medea selbst gegründet wurde und dessen Rituale ein Jahr dauernden Tempeldienst sieben Mädchen und sieben Jungen umfasste, die in schwarzer Kleidung die Totenklage für Medeas Kinder wiederholten.
2. Hauptteil: Der Hauptteil befasst sich eingehend mit den möglichen Ursprüngen und Gründen der Ätiologie des Hera-Akraia-Kults. Er analysiert verschiedene Versionen der Erzählung um Medeas Kindstod und deren Bedeutung im Kontext des Kults. Der Abschnitt untersucht die Rolle der Hera Akraia und das Begräbnis der Kinder, wobei verschiedene Theorien und Interpretationen der Quellen berücksichtigt werden. Es wird die These diskutiert, dass Medea ursprünglich eine Göttin gewesen sein könnte, die später durch Hera ersetzt wurde, und dass der Kindesmord ursprünglich ein Kinderopfer dargestellt haben könnte. Weiterhin wird die Zahl der Kinder (14) im Tempeldienst hinterfragt und verschiedene Erklärungsansätze, unter anderem ein apollinischer Einfluss und die Interpretation als Einführungskult ins Erwachsenenalter, diskutiert. Die These, dass Euripides' Tragödie einen Versuch darstellt, einen unverstandenen Brauch mit einer Ätiologie neu zu erklären, wird ausführlich erörtert. Der Abschnitt endet mit der Feststellung, dass Euripides' Werk mit einer Ätiologie abschließt, um eine direkte Verbindung zur Lebenswelt der Zuschauer herzustellen und dem Stück Glaubwürdigkeit zu verleihen.
Schlüsselwörter
Euripides, Medea, Hera Akraia, Korinth, Kult, Ätiologie, Kindesmord, Kinderopfer, antike Tragödie, griechische Mythologie, Religion, Rituale, Tempeldienst, Überlieferungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Euripides' Medea und der Hera Akraia Kult in Korinth
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Euripides' Tragödie "Medea" und dem Hera-Akraia-Kult in Korinth. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit der bereits existierende Kult Euripides beeinflusst hat und wie die Darstellung in der Tragödie mit den bestehenden Überlieferungen und Ritualen des Kults in Beziehung steht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Hera-Akraia-Kult in Korinth und seine Rituale, die verschiedenen Versionen der Medea-Erzählung und ihre Verbindung zum Kult, die Rolle Medeas und ihrer Kinder im Kult, die Ätiologie in Euripides' "Medea" als Erklärung für den Kult und den Einfluss des Kults auf die Gestaltung von Euripides' Tragödie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und das Forschungsvorhaben vor. Der Hauptteil analysiert mögliche Ursprünge und Gründe der Ätiologie des Hera-Akraia-Kults, verschiedene Versionen der Erzählung um Medeas Kindstod und deren Bedeutung im Kontext des Kults, die Rolle der Hera Akraia und das Begräbnis der Kinder. Der Hauptteil diskutiert verschiedene Theorien und Interpretationen, inklusive der These, dass Euripides' Tragödie einen Versuch darstellt, einen unverstandenen Brauch mit einer Ätiologie neu zu erklären. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Euripides, Medea, Hera Akraia, Korinth, Kult, Ätiologie, Kindesmord, Kinderopfer, antike Tragödie, griechische Mythologie, Religion, Rituale, Tempeldienst, Überlieferungen.
Welche zentrale These wird in der Arbeit vertreten?
Die Arbeit untersucht die These, dass Euripides' Tragödie "Medea" in engem Zusammenhang mit dem Hera-Akraia-Kult in Korinth steht und dass der Kult Euripides' Darstellung der Medea-Geschichte beeinflusst hat. Es wird diskutiert, ob Euripides mit seiner Tragödie versucht, einen bestehenden, möglicherweise unverstandenen Kultbrauch, mit einer neuen Ätiologie zu erklären und somit für das Publikum verständlicher zu machen.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse von antiken Quellen und berücksichtigt verschiedene Theorien und Interpretationen zu Euripides' "Medea" und dem Hera-Akraia-Kult. Konkrete Quellenangaben sind nicht im vorliegenden Text enthalten, aber werden vermutlich in der vollständigen Arbeit aufgeführt.
Welche Bedeutung hat die Zahl der Kinder (14) im Tempeldienst?
Die Arbeit hinterfragt die Bedeutung der Zahl 14 (sieben Mädchen und sieben Jungen) im Tempeldienst und diskutiert verschiedene Erklärungsansätze, darunter ein apollinischer Einfluss und die Interpretation als Einführungskult ins Erwachsenenalter.
Welche Rolle spielt die Ätiologie in der Arbeit?
Die Ätiologie, also die Erklärung der Ursprünge und Gründe des Kults, ist ein zentrales Thema der Arbeit. Es wird untersucht, wie Euripides' Darstellung der Ereignisse eine Ätiologie für den Kult bereitstellt und welche Rolle diese Ätiologie für das Verständnis des Stücks spielt. Die Arbeit untersucht die These, ob Euripides eine Ätiologie schafft, um einen unverstandenen Brauch zu erklären und seinem Werk Glaubwürdigkeit zu verleihen.
- Arbeit zitieren
- Elisabeth Keppe (Autor:in), 2009, Der Zusammenhang von Euripides’ Tragödie und dem Hera-Akraia-Kult in Korinth, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188725