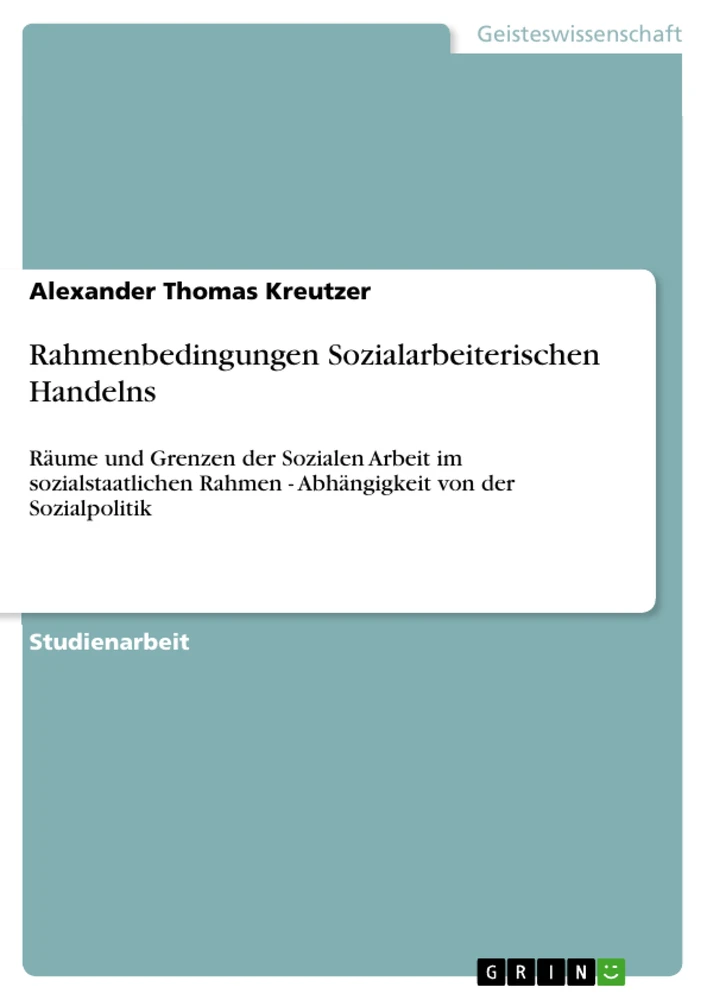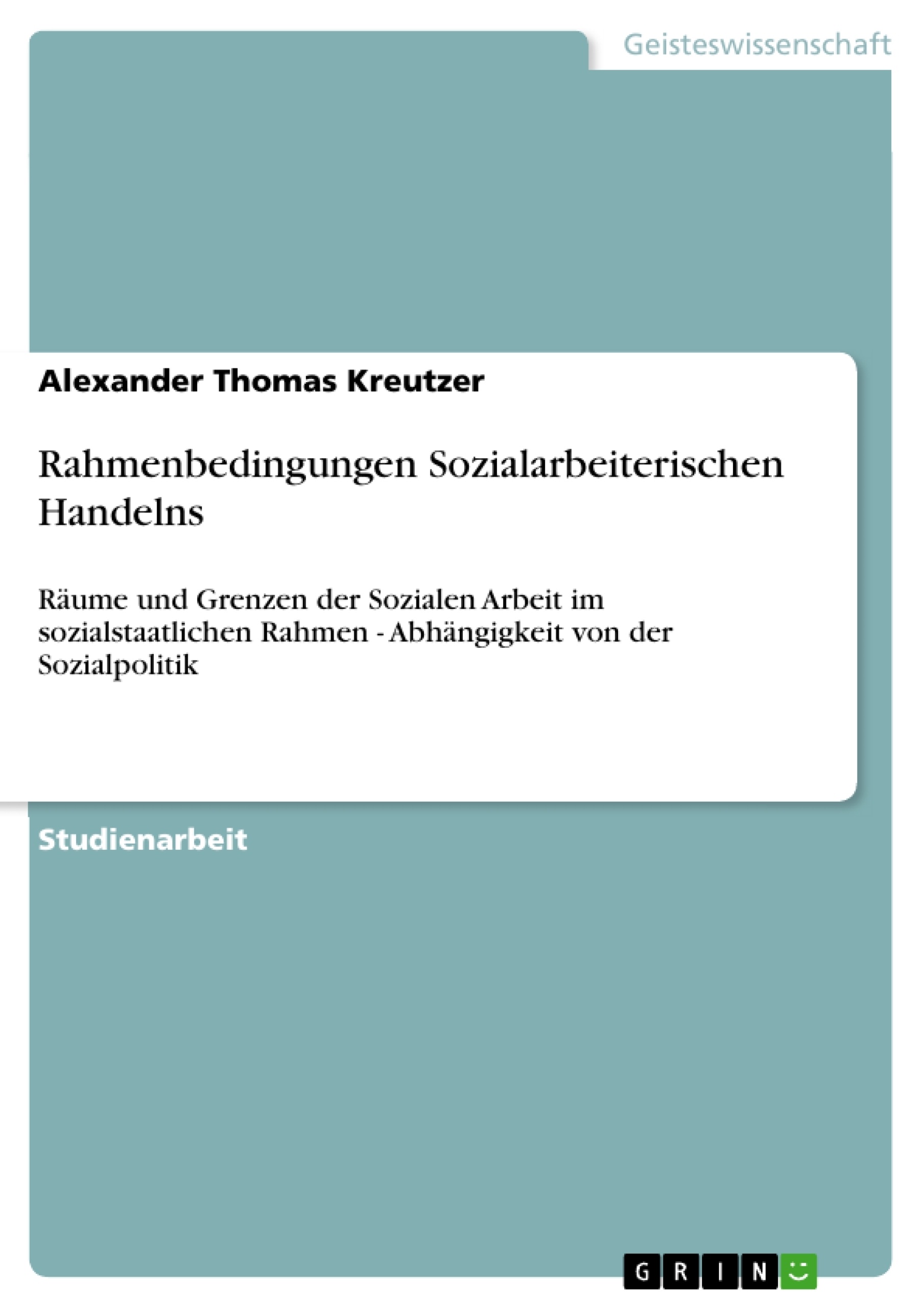Die Soziale Arbeit, als Humandienstleister, wird als Teil unseres sozialstaatlichen Dienstleistungssystems verstanden. Diese Leistung erfolgt im Rahmen teilweise komplex sozialstaatlich- rechtlicher, berufsethischer und berufsfachlicher, sowie gesellschaftlicher Bedingungen. Die Doppelfunktion der Sozialen Arbeit, das Handeln für das Klientel einerseits und für den Staat andererseits, bildet das Grundgerüst des sozialarbeiterischen Aufgabenfeldes. Einzelne Prozesse werden im Rahmen sozialstaatlicher Vorgaben verbessert, erhalten, geschützt und kompensiert. Das breite Spektrum der Sozialen Arbeit wird explizit in verschiedene Bereiche gegliedert und durch rechtliche, ökonomische, ökologische, sowie pädagogische Formen der Intervention (= Eingriff) der Sozialpolitik beeinflusst, ebenso die Arbeit für und mit dem Klientel. (vgl. Heiner, 2010, S.53ff.)
Als Klientel können Stadtteile, Gruppen und Einzelpersonen gemeint sein. Die Arbeits-und Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit unterliegen einem ständigen gesellschaftlichen und auch sozialpolitischen Wandel, aufgrund der Abhängigkeit von institutionalisierten Hilfen und Subventionen .
In der Sozialen Arbeit ist man ständig mit gewissen Rahmenbedingungen konfrontiert, die entweder durch den Staat, die Gesellschaft, die Institution, die Fachlichkeit oder die Ethik festgelegt werden. Oftmals stehen diese einzelnen Systeme auf Kollisionskurs miteinander und sollten gezielt und methodisch erfüllt werden.
Rahmenbedingungen schaffen Raum für neue Tätigkeitsfelder, begrenzen aber auch wiederum die Soziale Arbeit. Die Rahmenbedingungen sozialarbeiterischen Handelns begleiten SozialarbeiterInnen ständig auf ihrem Weg bei der Berufsausübung und sind ein wichtiges und komplexes Thema, das man sich immer vor Augen halten sollte. Inwieweit die Sozialpolitik durch sozialstaatlich- rechtliche Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit Räume und Grenzen einräumt und unter welchen Gesichtspunkten sie entstehen, werde ich in der folgenden Studienarbeit verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Sozialpolitisch-rechtliche Rahmenbedingungen
- 1.1 Festlegung sozialpolitischer Rahmenbedingungen
- 1.1.1 Vorstrukturierung der Rahmenbedingungen
- 1.2 Produktions- und Reproduktionssicherung im Sozialstaat
- 1.3 Historische Notiz (Entstehung der Politik der sozialen Sicherung)
- 1.4 Vergabeformen der Sozialpolitik
- 1.5 Ausdifferenzierung der Grundfunktion
- 1.6 Soziale Gerechtigkeit
- 1.7 Interventionsformen der Sozialpolitik
- 1.1 Festlegung sozialpolitischer Rahmenbedingungen
- 2. Organisatorische Rahmenbedingungen
- 2.1 Einflussfaktor Institution/ Organisationsgebundene Formalisierung
- 2.2 Subsidiaritätsprinzip
- 2.3 Die sozialstaatlich festgelegte Nachrangigkeit des Einsatzes Sozialer Arbeit
- 2.4 Die Koproduktion der Leistungen durch die Produzenten und Konsumenten der Dienstleistung
- 2.5 Vor- und Nachteile von Organisationen/ Institutionen
- 2.6 Neue Organisationsformen
- 3. Auswirkungen staatlicher Rahmenbedingungen und kultureller Leitbilder auf das Geschlechterverhältnis
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit befasst sich mit den Rahmenbedingungen sozialarbeiterischen Handelns und untersucht, inwiefern die Sozialpolitik durch sozialstaatlich-rechtliche Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit Räume und Grenzen einräumt. Es wird beleuchtet, wie diese Rahmenbedingungen entstehen und welche Auswirkungen sie auf die Praxis der Sozialen Arbeit haben.
- Die Bedeutung der sozialpolitischen Rahmenbedingungen für die Soziale Arbeit
- Die Entstehung und Entwicklung der Rahmenbedingungen im historischen Kontext
- Der Einfluss von Organisationen und Institutionen auf die Soziale Arbeit
- Die Rolle der Sozialpolitik bei der Gestaltung von Arbeitsfeldern und Handlungsmöglichkeiten
- Die Auswirkungen staatlicher Rahmenbedingungen auf das Geschlechterverhältnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Rahmenbedingungen sozialarbeiterischen Handelns ein und beleuchtet die Doppelfunktion der Sozialen Arbeit im Kontext des sozialstaatlichen Dienstleistungssystems. Das erste Kapitel befasst sich mit den sozialpolitisch-rechtlichen Rahmenbedingungen, die die Soziale Arbeit prägen. Dabei werden die Festlegung sozialpolitischer Rahmenbedingungen, die Bedeutung des Sozialstaates, die historische Entwicklung der sozialen Sicherung sowie die Vergabeformen und Interventionsformen der Sozialpolitik behandelt. Der Fokus liegt auf dem Einfluss der Sozialpolitik auf die Entstehung und Begrenzung des Aufgabenfeldes der Sozialen Arbeit. Das zweite Kapitel widmet sich den organisatorischen Rahmenbedingungen und beleuchtet den Einfluss von Institutionen und Organisationen auf die Soziale Arbeit. Themen wie das Subsidiaritätsprinzip, die Nachrangigkeit des Einsatzes Sozialer Arbeit, die Koproduktion von Leistungen und neue Organisationsformen werden diskutiert. Das dritte Kapitel analysiert die Auswirkungen staatlicher Rahmenbedingungen und kultureller Leitbilder auf das Geschlechterverhältnis.
Schlüsselwörter
Sozialpolitik, Rahmenbedingungen, Soziale Arbeit, Sozialstaat, Recht, Organisation, Institution, Geschlechterverhältnis, Intervention, Subsidiaritätsprinzip, Koproduktion.
- Quote paper
- Alexander Thomas Kreutzer (Author), 2011, Rahmenbedingungen Sozialarbeiterischen Handelns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188749