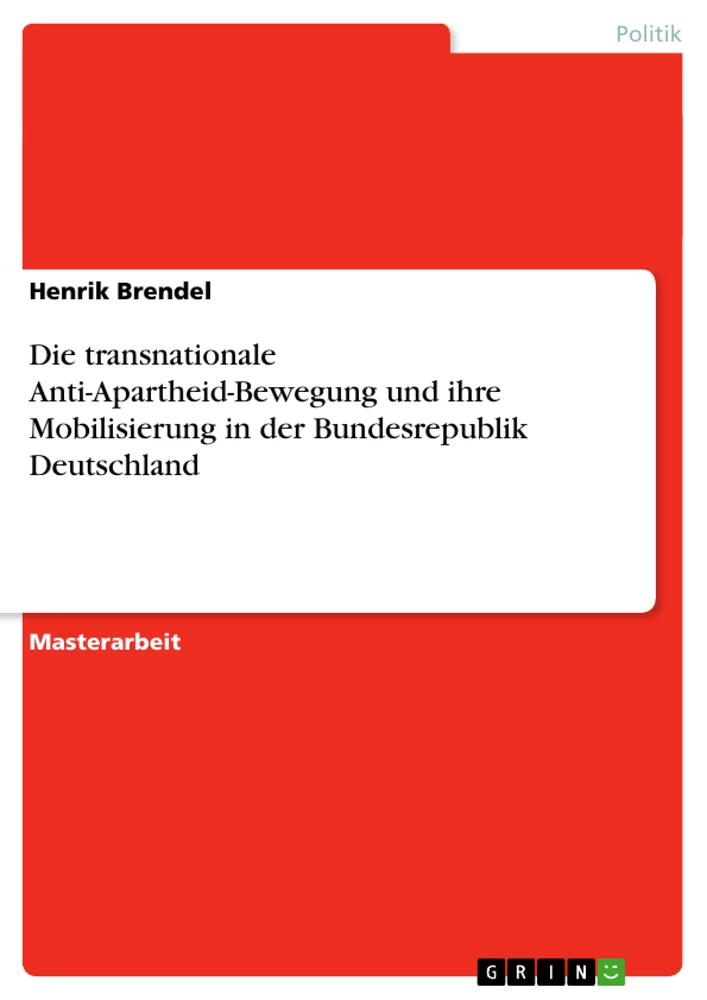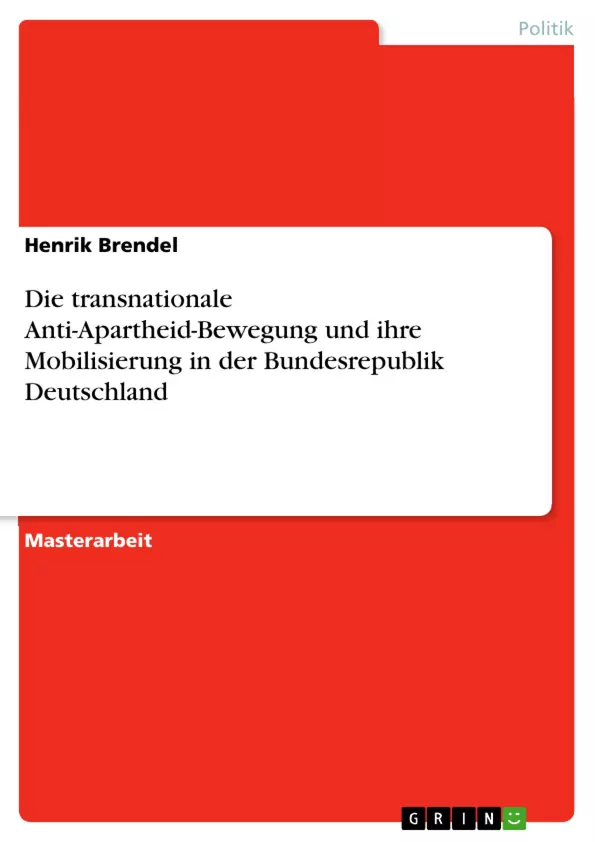Henrik Brendel geht in seiner forschungsgestützten Masterarbeit der Frage nach, wie sich die Anti-Apartheid-Bewegung in der Bundesrepublik im Kontext des inter- bzw. transnationalen Kampfes gegen das südafrikanische Apartheidsregime formierte, welche Mobilisierungsstrategien sie verfolgte und wie erfolgreich sie dabei war. In der Einleitung führt Brendel konzise in das Thema ein, entfaltet die Fragestellung, ordnet diese in Forschungskontext ein und beschreibt seine Materialbasis und sein Vorgehen. Das zweite Kapitel liefert zunächst einen knappen historischen Abriss der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika. Besonderes Interesse liegt dabei auf dem Bemühen der AAB um internationale Unterstützung. Das dritte Kapitel konzentriert sich dann auf die Entwicklung der AAB in der Bundesrepublik, bevor das vierte Kapitel die bundesdeutsche AAB Bewegung wiederum in den internationalen Kontext einordnet. Abgerundet wird die Arbeit durch ein Fazit, das die Ergebnisse schlüssig zusammenfasst.
Während die Arbeit im zweiten Kapitel sowohl die gute Literaturkenntnis als auch die Fähigkeit zur Synthese zeigt, gelingt es Brendel im dritten Kapitel auf der Basis von unveröffentlichtem Quellenmaterial einen guten Einblick in das Innenleben der Bewegung und deren Mobilisierungserfolge zu liefern. Ausgehend von zwei aus Südafrika geflohenen Pfarrern erfolgte nach und nach eine erfolgreiche Vernetzung der langsam wachsenden Bewegung auf nationaler und internationaler Ebene. Dabei arbeitet Brendel insbesondere heraus, wie es gelang, die Wirtschafts- und die Kulturbeziehungen der Bundesrepublik zu Südafrika immer mehr zu delegitimieren. Boykottaufrufe gegen südafrikanische Produkte sowie die Kündigung des Kulturabkommens mit Südafrika können in diesem Kontext als die größten Erfolge gelten. Durch die im vierten Kapitel vorgenommene Einbettung der deutschen AAB in den internationalen Kontext gelingt es Brendel schließlich auch, diese Erfolge zu relativieren und zu zeigen, in welchem Maße etwa die Bewegung in den Niederlanden noch erfolgreicher war. Wenn die Frage nach den Gründen dafür in dieser Arbeit offen bleibt, so zeigt dies nur, dass Brendel mit seiner Arbeit ein vergleichsweise neues Forschungsfeld betritt und dabei eine Reihe neuer Perspektiven eröffnet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Fragestellung, Quellenbasis und Aufbau der Untersuchung
- 1.1 Von einer „leisen und einsamen Stimme des Protests“ zur weltweiten Solidaritätsbewegung?
- 1.2 Anti-Apartheid-Protest in der Bundesrepublik – Soziale Bewegung als gesellschaftlicher Lernprozess?
- 1.3 Forschungsstand und Quellenbasis
- 1.4 Analytischer Bezugsrahmen und Aufbau der Untersuchung
- 2. Vom Protest zum Widerstand: Die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika (1886-1994)
- 2.1 Wurzeln des Widerstands: Vom Minenkapitalismus über die Entstehung eines modernen Staats zur Etablierung der Rassentrennung in Südafrika (1886-1940)
- 2.2 „Africa for the Africans“: Vom zivilen Ungehorsam über das Massaker von Sharpeville zum bewaffneten Widerstandskampf (1940-68)
- 2.3 Stille vor dem Sturm: Vom Black Consciousness über die Radikalisierung der Jugend zur United Democratic Front (1968-89)
- 3. Die Mobilisierung der Anti-Apartheid-Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland
- 3.1 „Mit Maske auf dem Seil tanzend“ - Von der Ausweisung deutscher Priester aus Südafrika zur Mobilisierung erster Protestgruppen und Aktionen in Deutschland
- 3.2 „Institutionalisierter Erfahrungsaustausch“ - Organisationsstrukturen und Kommunikationskanäle
- 3.3 „Thanks God, we still have West-Germany“ – Problemdeutungen und Vorannahmen im Protest gegen die Apartheid
- 3.4 „Das Kulturabkommen mit Südafrika muss gekündigt werden!“ – Übersetzung der Kritik in die Sprache gesellschaftlicher Teilsysteme
- 4. Die AAB in der BRD als Bestandteil einer transnationalen Anti-Apartheid-Bewegung
- 4.1 „We wield a devastating weapon“ – Anti-Apartheid als Bewegung der Bewegungen
- 4.2 „Dear Comrade Ingeborg“ – Zusammenarbeit mit den Befreiungsbewegungen
- 4.3 „Under the auspices of the UN“ - Interaktion mit dem UN-Centre against Apartheid
- 4.4 „Support the International Day of Action“ - Koordinierung zwischen den nationalen Solidaritätsbewegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die transnationale Anti-Apartheid-Bewegung und ihre Mobilisierung in der Bundesrepublik Deutschland. Ziel ist es, die Entwicklung des Widerstands gegen die Apartheid in Südafrika und dessen Einfluss auf die bundesrepublikanische Gesellschaft zu analysieren. Dabei wird der Fokus auf die Vernetzung der Akteure, die Strategien der Mobilisierung und die gesellschaftlichen Lernprozesse gelegt.
- Entwicklung des Anti-Apartheid-Widerstands in Südafrika
- Mobilisierung der Anti-Apartheid-Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland
- Transnationale Vernetzung der Bewegung
- Einfluss der Bewegung auf die bundesrepublikanische Gesellschaft
- Gesellschaftliche Lernprozesse im Kontext des Anti-Apartheid-Protests
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Fragestellung, Quellenbasis und Aufbau der Untersuchung: Dieses einführende Kapitel skizziert die Forschungsfrage, die Quellenbasis und den methodischen Aufbau der Arbeit. Es erläutert den Kontext der Untersuchung, indem es auf die internationale Solidaritätskonferenz des ANC im Jahr 1993 verweist und den Weg der Anti-Apartheid-Bewegung von einer „leisen und einsamen Stimme“ hin zu einer starken internationalen Bewegung beschreibt. Die Einleitung legt den Grundstein für die darauffolgenden Kapitel, in denen die Entwicklung des Widerstands in Südafrika und seine Auswirkung auf die bundesdeutsche Gesellschaft im Detail beleuchtet werden.
2. Vom Protest zum Widerstand: Die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika (1886-1994): Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika. Es beginnt mit den Wurzeln des Widerstands im Minenkapitalismus und der Etablierung des Apartheid-Systems, verfolgt dann den Übergang vom zivilen Ungehorsam zum bewaffneten Kampf, und beschreibt schließlich die Entwicklung von Black Consciousness und die Rolle der United Democratic Front. Es wird deutlich, wie sich der Widerstand über Jahrzehnte hinweg entwickelte und immer wieder neue Strategien und Formen annahm.
3. Die Mobilisierung der Anti-Apartheid-Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland: Dieses Kapitel analysiert die Mobilisierung der Anti-Apartheid-Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland. Es untersucht die verschiedenen Strategien, die von der Ausweisung deutscher Priester bis hin zur gezielten Einflussnahme auf gesellschaftliche Teilsysteme reichten. Der Fokus liegt auf den Organisationsstrukturen, den Kommunikationskanälen und den jeweiligen Problemdeutungen und Vorannahmen im Kontext des bundesdeutschen Protestes gegen die Apartheid. Es werden die vielschichtigen Mechanismen der Mobilisierung und deren Auswirkungen auf die öffentliche Meinung und politische Entscheidungen beleuchtet.
4. Die AAB in der BRD als Bestandteil einer transnationalen Anti-Apartheid-Bewegung: Dieses Kapitel untersucht die transnationale Vernetzung der Anti-Apartheid-Bewegung, in die die bundesdeutsche Bewegung eingebunden war. Es analysiert die Zusammenarbeit mit Befreiungsbewegungen, die Interaktion mit den Vereinten Nationen und die Koordinierung zwischen nationalen Solidaritätsbewegungen. Es wird die Bedeutung der internationalen Vernetzung für den Erfolg des Anti-Apartheid-Widerstands hervorgehoben und die verschiedenen Formen der transnationalen Zusammenarbeit beleuchtet.
Schlüsselwörter
Anti-Apartheid-Bewegung, Südafrika, Bundesrepublik Deutschland, Transnationalismus, Mobilisierung, soziale Bewegung, Widerstand, Rassentrennung, Apartheid, Boykott, Sanktionen, internationale Zusammenarbeit, Befreiungsbewegungen, gesellschaftlicher Lernprozess.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Anti-Apartheid-Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die transnationale Anti-Apartheid-Bewegung und ihre Mobilisierung in der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die Entwicklung des Widerstands gegen die Apartheid in Südafrika und dessen Einfluss auf die bundesrepublikanische Gesellschaft. Der Fokus liegt auf der Vernetzung der Akteure, den Strategien der Mobilisierung und den gesellschaftlichen Lernprozessen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Anti-Apartheid-Widerstands in Südafrika, die Mobilisierung der Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland, die transnationale Vernetzung der Bewegung, den Einfluss der Bewegung auf die bundesrepublikanische Gesellschaft und die gesellschaftlichen Lernprozesse im Kontext des Anti-Apartheid-Protests.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einleitung mit Fragestellung, Quellenbasis und methodischem Aufbau. Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika von 1886 bis 1994. Kapitel 3 analysiert die Mobilisierung der Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland. Kapitel 4 untersucht die transnationale Vernetzung der Bewegung und deren Einbindung in die bundesdeutsche Bewegung.
Wie wird die Entwicklung des Widerstands in Südafrika dargestellt?
Kapitel 2 bietet einen historischen Überblick über den Anti-Apartheid-Widerstand in Südafrika. Es zeigt die Entwicklung vom zivilen Ungehorsam zum bewaffneten Kampf und beschreibt die Rolle von Black Consciousness und der United Democratic Front. Der Fokus liegt auf den verschiedenen Strategien und Formen des Widerstands über die Jahrzehnte hinweg.
Wie wird die Mobilisierung in der Bundesrepublik Deutschland analysiert?
Kapitel 3 analysiert die Mobilisierung der Anti-Apartheid-Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland. Es untersucht die Strategien der Bewegung, die Organisationsstrukturen, die Kommunikationskanäle, die Problemdeutungen und Vorannahmen im Kontext des bundesdeutschen Protests und die Auswirkungen auf die öffentliche Meinung und politische Entscheidungen.
Welche Rolle spielte die transnationale Vernetzung?
Kapitel 4 betont die Bedeutung der transnationalen Vernetzung für den Erfolg des Anti-Apartheid-Widerstands. Es analysiert die Zusammenarbeit mit Befreiungsbewegungen, die Interaktion mit den Vereinten Nationen und die Koordinierung zwischen nationalen Solidaritätsbewegungen. Es werden verschiedene Formen der transnationalen Zusammenarbeit beleuchtet.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer detaillierten Quellenbasis, die im ersten Kapitel erläutert wird. Die genaue Zusammensetzung der Quellen wird im Haupttext der Arbeit spezifiziert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Anti-Apartheid-Bewegung, Südafrika, Bundesrepublik Deutschland, Transnationalismus, Mobilisierung, soziale Bewegung, Widerstand, Rassentrennung, Apartheid, Boykott, Sanktionen, internationale Zusammenarbeit, Befreiungsbewegungen, gesellschaftlicher Lernprozess.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage untersucht die transnationale Anti-Apartheid-Bewegung und ihre Mobilisierung in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere die Entwicklung des Widerstands, die Strategien der Mobilisierung und deren gesellschaftlichen Auswirkungen.
- Citation du texte
- Henrik Brendel (Auteur), 2011, Die transnationale Anti-Apartheid-Bewegung und ihre Mobilisierung in der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188803