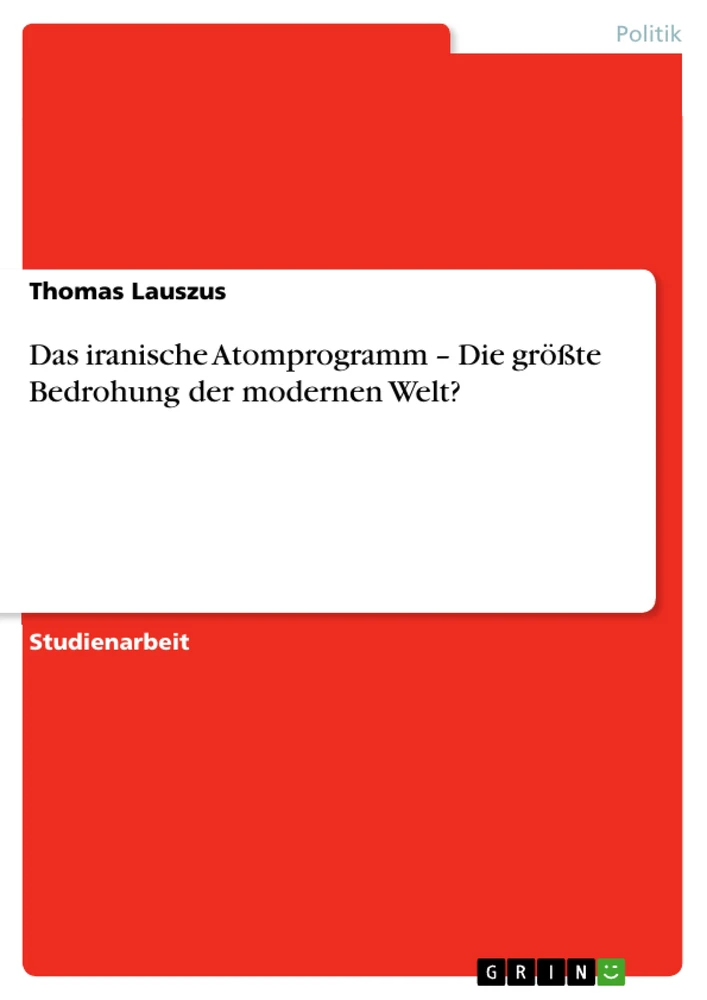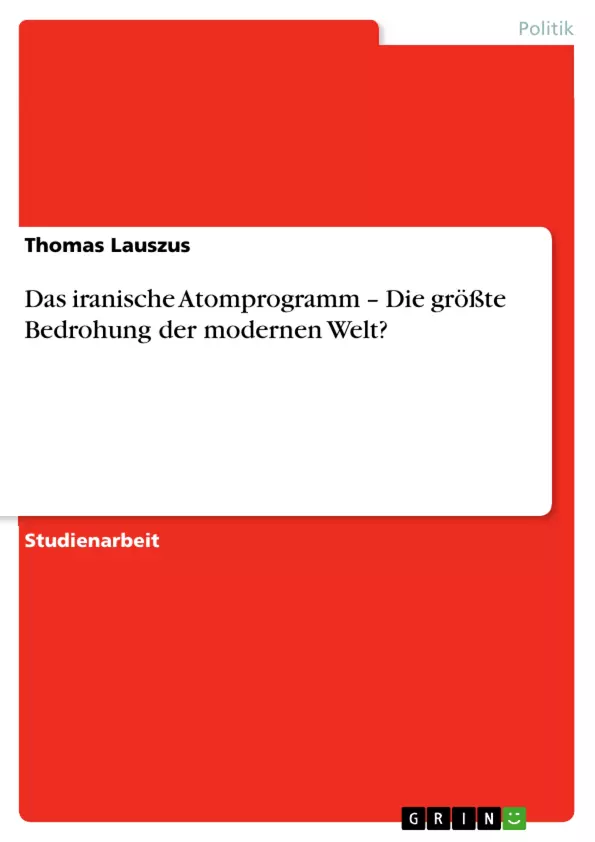Die folgende Arbeit soll einen Überblick über das Atomprogramm des Iran geben und es soll versucht werden das Bestreben des Iran anhand der Theorie des politischen Realismus zu erklären. Als erstes möchte ich einen Überblick über den politischen Realismus geben, danach die Atompolitik des Iran erläutern und zum Schluss prüfen, inwieweit die Theorie das Bestreben des Iran innerhalb des israelisch-arabischen Konflikts erklären kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theorie des Realismus
- Der politische Realismus – Begriffsklärung und Abgrenzung
- Die sechs Grundsätze des politischen Realismus
- Der Atomstreit
- Das Atomprogramm des Iran
- mögliche Auswirkungen auf den arabisch – israelischen Konflikt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem iranischen Atomprogramm und versucht, das Bestreben des Iran im Kontext des arabisch-israelischen Konflikts anhand der Theorie des politischen Realismus zu erklären.
- Die Theorie des politischen Realismus und seine Kernaussagen
- Das iranische Atomprogramm und seine mögliche Bedeutung
- Die Auswirkungen des iranischen Atomprogramms auf den arabisch-israelischen Konflikt
- Der Iran im Kontext der internationalen Machtverhältnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas vor und beleuchtet die kontroverse Diskussion um das iranische Atomprogramm. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Theorie des politischen Realismus, erklärt seine Grundprinzipien und stellt die wichtigsten Argumente des Realismus dar.
Das dritte Kapitel analysiert das iranische Atomprogramm und untersucht seine möglichen Auswirkungen auf den arabisch-israelischen Konflikt.
Schlüsselwörter
Iran, Atomprogramm, Realismus, internationale Beziehungen, Machtpolitik, arabisch-israelischer Konflikt, Sicherheitsdilemma, Atomwaffen, Machtverteilung, Status quo.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Theorie des politischen Realismus?
Der politische Realismus geht davon aus, dass Staaten im internationalen System primär nach Macht und Sicherheit streben, wobei das Eigeninteresse und die Machtverteilung im Vordergrund stehen.
Welche Rolle spielt das Sicherheitsdilemma im Iran-Konflikt?
Das Sicherheitsdilemma beschreibt eine Situation, in der Maßnahmen eines Staates zur Erhöhung seiner eigenen Sicherheit (wie ein Atomprogramm) von anderen Staaten als Bedrohung wahrgenommen werden, was zu einem Wettrüsten führen kann.
Wie beeinflusst das iranische Atomprogramm den arabisch-israelischen Konflikt?
Das Programm wird von vielen Akteuren als potenzielle Bedrohung des regionalen Status quo und der Sicherheit Israels gesehen, was die Spannungen im Nahen Osten massiv verschärft.
Warum strebt der Iran laut Realismus nach nuklearen Kapazitäten?
Aus realistischer Sicht könnte dies als Versuch gewertet werden, die eigene Machtposition zu stärken, Abschreckung gegenüber Rivalen aufzubauen und das Überleben des Regimes im internationalen System zu sichern.
Was sind die sechs Grundsätze des politischen Realismus nach Morgenthau?
Dazu gehören unter anderem die Annahme, dass Politik durch objektive Gesetze bestimmt wird, die in der menschlichen Natur wurzeln, und dass das Hauptinteresse der Begriff der Macht ist.
- Quote paper
- Thomas Lauszus (Author), 2009, Das iranische Atomprogramm – Die größte Bedrohung der modernen Welt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188919