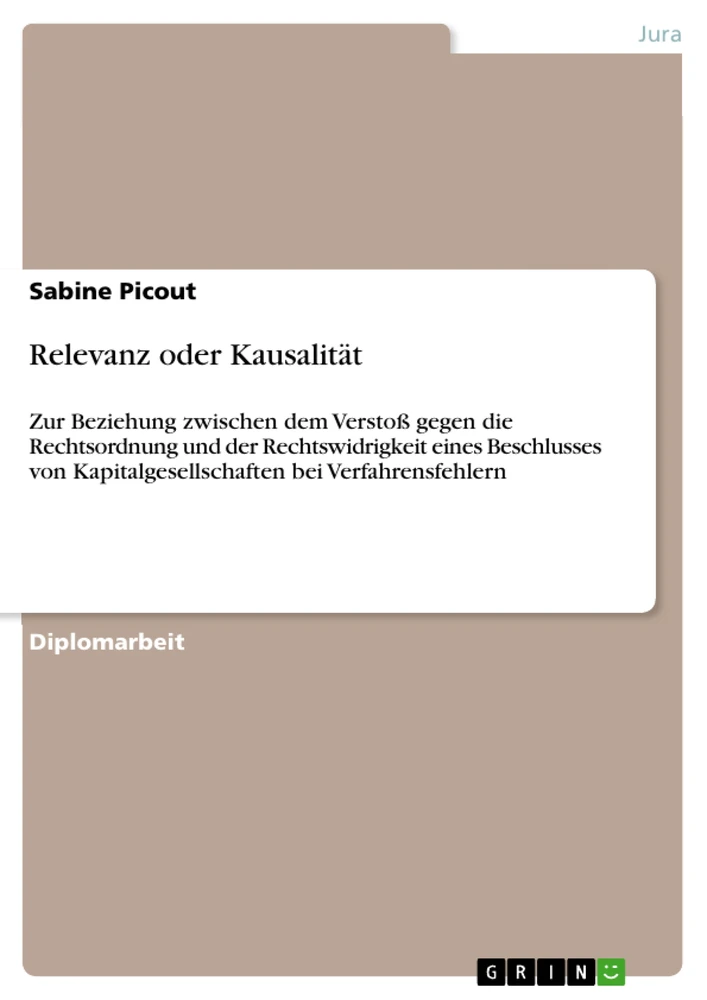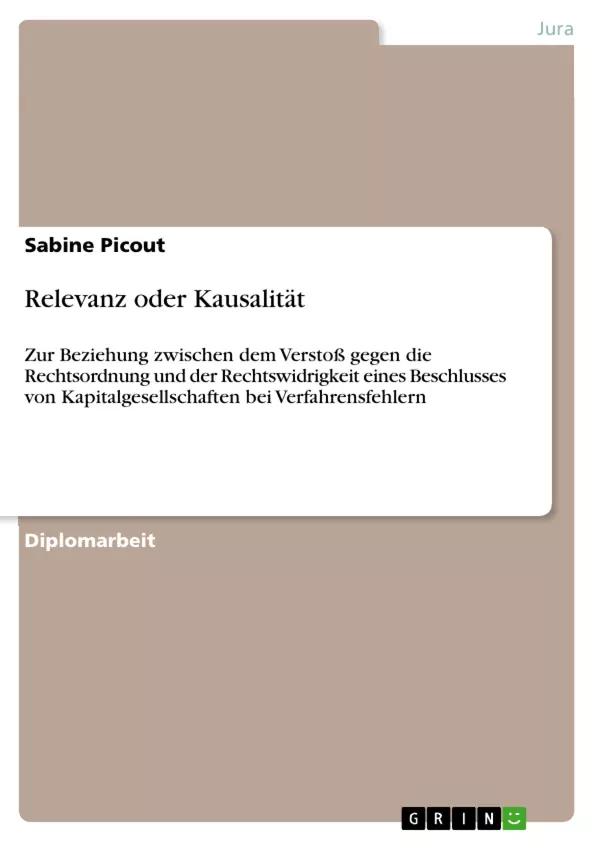Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Beschluss als rechtstechnischem Mittel der Willensbildung in Kapitalgesellschaften. Im Zentrum der Ausführungen stehen fehlerhafte Beschlüsse, deren Rechtsfolgen sowie die Auswirkungen von Rechtswidrigkeiten auf den Bestand eines Beschlusses.
Zunächst erscheint es sinnvoll, wichtige Grundbegriffe zu klären und das Wesen des Beschlusses zu beschreiben. Dann folgt ein Überblick über die verschiedenen Kategorien von Mängeln, unter denen Beschlüsse leiden können.
Im Hauptteil wird die Frage untersucht, welche Fehler Anfechtbarkeit zur Folge haben.
Bei Verfahrensfehlern, die zur Erhebung der Anfechtungsklage berechtigen, kommt es nach der älteren Meinung darauf an, ob der Beschluss auf dem gerügten Gesetzes- oder Satzungsverstoß beruht, also für ihn kausal ist. In den letzten Jahren haben sich bei verschiedensten Vertretern von Lehre und Rechtsprechung starke Tendenzen entwickelt, vom Kausalitätserfordernis Abstand zu nehmen. Dieser Denkansatz hat zur Herausbildung der sogenannten Relevanztheorie geführt. In der Folge ist deshalb zu untersuchen, unter welchen Voraussetzungen die Kausalitäts- bzw. Relevanztheorie zum Tragen kommt.
Im Rahmen der Arbeit soll der Versuch gemacht werden, den Stand der Diskussion zu diesem Bereich der fehlerhaften Beschlüsse im Kapitalgesellschaftsrecht im Überblick darzustellen. Dabei beschränken sich die Ausführungen auf die Aktiengesellschaft und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Es soll einerseits kurz auf die historische Entwicklung, andererseits auf die momentane rechtliche Praxis und verschiedene Vorschläge aus dem Schrifttum eingegangen werden. Zwar steht die österreichische Rechtslage im Vordergrund der Ausführungen, doch können bei der Darstellung der Entwicklung beider Theorien die deutsche Rechtsprechung und Lehre nicht vernachlässigt werden, da auch in Österreich auf sie zurückgegriffen wird.
Die in der Arbeit angestellten Überlegungen gelten sowohl für die Aktiengesellschaft als auch für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, weswegen Behauptungen bezüglich einer Gesellschaftsform auch auf die andere übertragbar sind, wenn auf einen Unterschied nicht ausdrücklich hingewiesen wird.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- GRUNDBEGRIFFE
- DIE KAPITALGESELLSCHAFT UND IHRE ORGANISATIONSVERFASSUNG
- Die Organisationsverfassung der Aktiengesellschaft
- Die Organisationsverfassung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- DER BESCHLUSS
- DER BESCHLUSS ALS RECHTSGESCHÄFT
- DIE RECHTSWIDRIGKEIT VON BESCHLÜSSEN
- Formelle und materielle Mängel
- Rechtsfolgen von Mängeln
- Rechtsfolgen fehlerhafter Hauptversammlungsbeschlüsse im Aktienrecht
- Die Nichtigkeit
- Die Anfechtbarkeit
- Die Unwirksamkeit
- Rechtsfolgen fehlerhafter Generalversammlungsbeschlüsse im Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Rechtsfolgen fehlerhafter Hauptversammlungsbeschlüsse im Aktienrecht
- DIE KAPITALGESELLSCHAFT UND IHRE ORGANISATIONSVERFASSUNG
- HAUPTTEIL
- DIE VORAUSSETZUNG FÜR DIE ANFECHTBARKEIT VON BESCHLÜSSEN DER KAPITALGESELLSCHAFTEN
- Gesetzliche Voraussetzungen für eine Anfechtungsbefugnis
- Von der Lehre und Rechtsprechung entwickelte Voraussetzungen
- DIE ERKLÄRUNG DER BEGRIFFE KAUSALITÄT UND RELEVANZ
- DIE ENTWICKLUNG DER KAUSALITÄTS- UND RELEVANZTHEORIE
- Die strenge Kausalitätstheorie
- Die potentielle Kausalitätstheorie
- Die Relevanztheorie
- EINE DIFFERENZIERTE BETRACHTUNGSWEISE
- Verstöße gegen das Partizipations- und Informationsinteresse
- Verstöße bei der Beschlussvorbereitung
- Vorbereitungsmängel
- Ankündigungsmängel
- Durchführungsmängel
- Verstöße gegen das Auskunftsrecht und andere Informationspflichten
- Die unberechtigte Auskunftsverweigerung
- Verletzungen von anderen Informationspflichten
- Verstöße bei der Beschlussvorbereitung
- Die fehlerhafte Feststellung des Abstimmungsergebnisses
- Die fehlerhafte faktische Zählung
- Das Mitzählen ungültiger oder das Nichtzählen gültiger Stimmen
- EIN WANDEL IN DER RECHTSPRECHUNG DES OGH
- Verstöße gegen das Partizipations- und Informationsinteresse
- DIE VORAUSSETZUNG FÜR DIE ANFECHTBARKEIT VON BESCHLÜSSEN DER KAPITALGESELLSCHAFTEN
- SCHLUSSBEMERKUNGEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Rechtsfolgen fehlerhafter Beschlüsse von Kapitalgesellschaften, insbesondere im Hinblick auf die Frage der Anfechtbarkeit. Im Fokus steht die Beziehung zwischen dem Verstoß gegen die Rechtsordnung und der Rechtswidrigkeit eines Beschlusses.
- Die verschiedenen Kategorien von Mängeln, die Beschlüsse von Kapitalgesellschaften betreffen können
- Die Voraussetzungen für die Anfechtbarkeit von Beschlüssen
- Die Entwicklung und Anwendung der Kausalitäts- und Relevanztheorie in Bezug auf fehlerhafte Beschlüsse
- Die Auswirkungen von Verfahrensfehlern auf die Gültigkeit von Beschlüssen
- Die aktuelle Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes (OGH) in Österreich
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort gibt einen Überblick über die Thematik der Diplomarbeit, die sich mit fehlerhaften Beschlüssen in Kapitalgesellschaften befasst. Es werden die zentralen Themenfelder, wie die verschiedenen Kategorien von Mängeln und die Frage der Anfechtbarkeit, vorgestellt. Im Hauptteil werden zunächst die Voraussetzungen für die Anfechtbarkeit von Beschlüssen erläutert. Anschließend werden die Begriffe Kausalität und Relevanz im Kontext der Rechtswidrigkeit von Beschlüssen definiert. Die Entwicklung der Kausalitäts- und Relevanztheorie wird im Detail dargestellt, wobei die unterschiedlichen Standpunkte von Lehre und Rechtsprechung beleuchtet werden. Die Arbeit analysiert, unter welchen Voraussetzungen die Kausalitäts- bzw. Relevanztheorie Anwendung findet und wie diese Theorien im Rahmen verschiedener Verfahrensfehler zu bewerten sind. Es werden dabei Verstöße gegen das Partizipations- und Informationsinteresse sowie die fehlerhafte Feststellung des Abstimmungsergebnisses untersucht. Abschließend wird ein Wandel in der Rechtsprechung des OGH zum Thema fehlerhafter Beschlüsse beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kapitalgesellschaften, Beschlüsse, Rechtswidrigkeit, Anfechtbarkeit, Verfahrensfehler, Kausalität, Relevanz, Partizipations- und Informationsinteresse, Rechtsprechung, OGH.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist ein Beschluss einer Kapitalgesellschaft fehlerhaft?
Ein Beschluss ist fehlerhaft, wenn er gegen gesetzliche Vorschriften oder die Satzung verstößt, wobei zwischen formellen und materiellen Mängeln unterschieden wird.
Was ist der Unterschied zwischen Nichtigkeit und Anfechtbarkeit?
Nichtige Beschlüsse sind von Anfang an rechtsunwirksam. Anfechtbare Beschlüsse sind zunächst wirksam, können aber durch eine Klage rückwirkend vernichtet werden.
Was besagt die Kausalitätstheorie bei Beschlussmängeln?
Nach dieser Theorie führt ein Fehler nur dann zur Anfechtbarkeit, wenn er für das Abstimmungsergebnis ursächlich (kausal) war.
Was versteht man unter der Relevanztheorie?
Die Relevanztheorie besagt, dass schwerwiegende Verfahrensfehler (z.B. Verletzung von Informationsrechten) unabhängig von der Kausalität zur Anfechtbarkeit führen können, wenn sie für die Willensbildung relevant sind.
Wie beurteilt der OGH in Österreich fehlerhafte Beschlüsse?
Die Arbeit zeigt einen Wandel in der Rechtsprechung des OGH auf, der sich zunehmend von der strengen Kausalität hin zu einer differenzierten Relevanzbetrachtung bewegt.
- Arbeit zitieren
- MMag. Dr. Sabine Picout (Autor:in), 2005, Relevanz oder Kausalität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188979