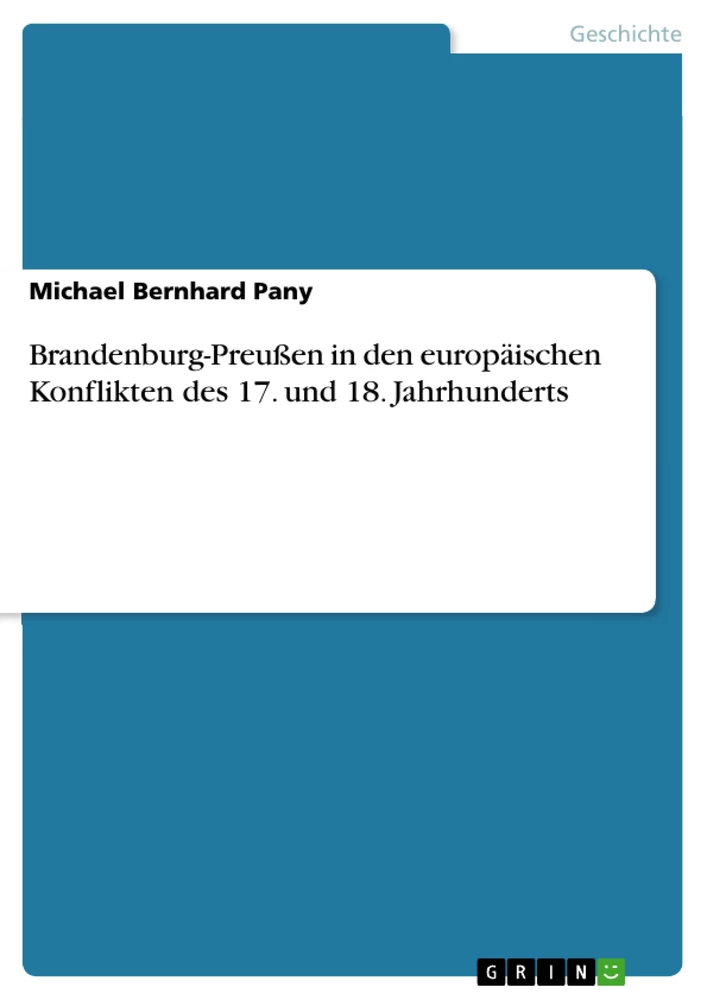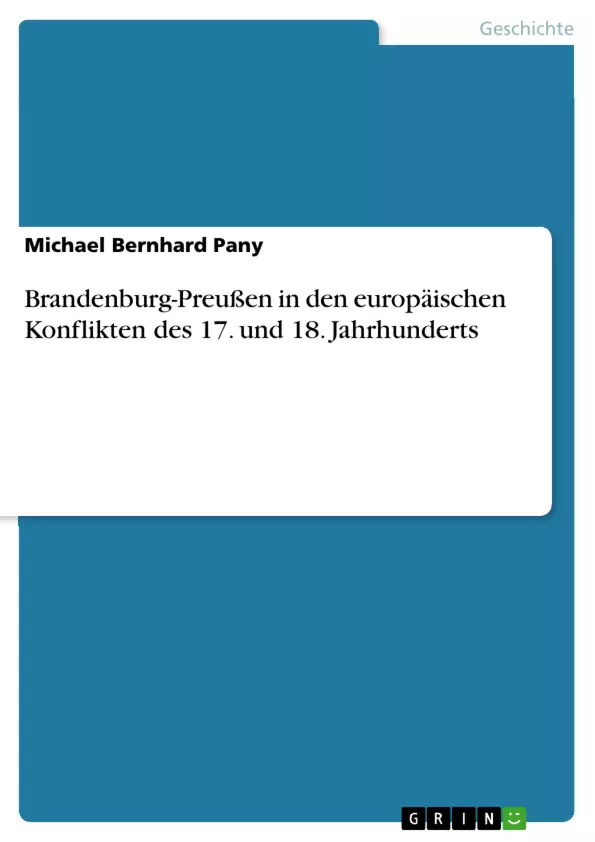Das Territorium des späteren Königreichs Preußen ging grob gesagt aus drei Ländereien hervor, deren jeweilige Geschichte deutliche Unterschiede aufweist. Diese wären zum einen die Mark Brandenburg, zum anderen Kleve, Mark und Ravensberg und zu guter letzt das Herzogtum Preußen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Arbeitsaufgaben
- 1. 1. Die Entstehung des brandenburgisch-preußischen Territorialverbandes.
- 1. 2. Ursachen, Verlauf und Ergebnisse des Dreißigjährigen Krieges. Brandenburg-Preußen im Dreißigjährigen Krieg.
- 1. 3. Entstehung und Besonderheiten des Absolutismus in Brandenburg-Preußen.
- 1. 4. Erläutern Sie das Wesen des aufgeklärten Absolutismus am Beispiel Friedrich II.
- 1. 5. Preußen im Spanischen Erbfolgekrieg und im Nordischen Krieg 1700-1721.
- 1. 6. Preußen im Österreichischen Erbfolgekrieg und im Siebenjährigen Krieg. Die Entstehung des österreichisch-preußischen Dualismus.
- 1. 7. Preußen und die polnischen Teilungen.
- 2. Anhang
- 3. Quellenangaben
- 3. 1. Literatur
- 3. 2. Internet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das vorliegende Werk befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des brandenburgisch-preußischen Territorialverbandes im Kontext der europäischen Konflikte des 17. und 18. Jahrhunderts. Es untersucht die wichtigsten Ereignisse, die zur Entstehung und Festigung der brandenburgisch-preußischen Macht führten, sowie die Rolle des Landes in den wichtigsten europäischen Konflikten dieser Zeit.
- Die Entstehung des brandenburgisch-preußischen Territorialverbandes aus der Mark Brandenburg, den niederrheinisch-westfälischen Gebieten und dem Herzogtum Preußen
- Der Dreißigjährige Krieg: Ursachen, Verlauf und Ergebnisse, sowie die Rolle Brandenburg-Preußens im Krieg
- Die Entstehung und Besonderheiten des Absolutismus in Brandenburg-Preußen
- Die Rolle Brandenburg-Preußens in den großen europäischen Konflikten des 17. und 18. Jahrhunderts, wie dem Spanischen Erbfolgekrieg, dem Nordischen Krieg, dem Österreichischen Erbfolgekrieg und dem Siebenjährigen Krieg
- Die polnischen Teilungen und ihre Auswirkungen auf Brandenburg-Preußen
Zusammenfassung der Kapitel
1. 1. Die Entstehung des brandenburgisch-preußischen Territorialverbandes
Dieses Kapitel erläutert die Entstehung des späteren Königreichs Preußen aus drei verschiedenen Gebieten: der Mark Brandenburg, den niederrheinisch-westfälischen Gebieten und dem Herzogtum Preußen. Es werden die historischen Hintergründe und Entwicklungen jedes Gebietes detailliert beschrieben, wobei der Schwerpunkt auf der Rolle der Hohenzollern in der Vereinigung dieser Territorien liegt.
1. 2. Ursachen, Verlauf und Ergebnisse des Dreißigjährigen Krieges. Brandenburg-Preußen im Dreißigjährigen Krieg
Dieser Abschnitt analysiert die Ursachen, den Verlauf und die Ergebnisse des Dreißigjährigen Krieges, wobei die Konflikte in Europa und im Heiligen Römischen Reich hervorgehoben werden. Es wird die Rolle des brandenburgischen Kurfürsten in diesem Krieg sowie die Auswirkungen des Westfälischen Friedens auf die brandenburgisch-preußischen Territorien beleuchtet.
1. 3. Entstehung und Besonderheiten des Absolutismus in Brandenburg-Preußen
Dieses Kapitel untersucht die Entstehung des Absolutismus in Brandenburg-Preußen, insbesondere während der Herrschaft des „Großen Kurfürsten“ Friedrich Wilhelm. Es werden die wichtigsten Maßnahmen zur Stärkung der Zentralmacht, die Herausbildung der Armee und die Einführung von neuen Steuer- und Verwaltungssystemen dargestellt.
1. 5. Preußen im Spanischen Erbfolgekrieg und im Nordischen Krieg 1700-1721
Dieser Abschnitt beschreibt die Rolle Preußens im Spanischen Erbfolgekrieg und im Nordischen Krieg. Die Auswirkungen dieser Kriege auf die brandenburgisch-preußische Politik und die strategischen Entscheidungen werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen des Werkes sind: Brandenburg-Preußen, Territorialverband, europäische Konflikte, Dreißigjähriger Krieg, Absolutismus, aufgeklärter Absolutismus, Friedrich II., Spanischer Erbfolgekrieg, Nordischer Krieg, Österreichischer Erbfolgekrieg, Siebenjähriger Krieg, polnische Teilungen, Machtpolitik, Militär, Steuern, Verwaltung.
Häufig gestellte Fragen
Aus welchen Gebieten entstand Brandenburg-Preußen?
Der brandenburgisch-preußische Territorialverband entstand im Wesentlichen aus drei Gebieten: der Mark Brandenburg, den rheinisch-westfälischen Gebieten (Kleve, Mark, Ravensberg) und dem Herzogtum Preußen.
Welche Rolle spielte Brandenburg im Dreißigjährigen Krieg?
Die Arbeit untersucht die Ursachen und den Verlauf des Krieges sowie die spezifische Rolle des brandenburgischen Kurfürsten und die Auswirkungen des Westfälischen Friedens auf die Territorien.
Was zeichnete den Absolutismus unter Friedrich Wilhelm aus?
Unter dem „Großen Kurfürsten“ Friedrich Wilhelm wurde die Zentralmacht gestärkt, ein stehendes Heer aufgebaut und neue Steuer- sowie Verwaltungssysteme eingeführt.
Was versteht man unter dem aufgeklärten Absolutismus bei Friedrich II.?
Friedrich II. (Friedrich der Große) gilt als Paradebeispiel für den aufgeklärten Absolutismus, bei dem der Monarch sich als „erster Diener des Staates“ verstand und Reformen im Sinne der Aufklärung durchführte.
In welchen großen europäischen Konflikten war Preußen im 18. Jahrhundert verwickelt?
Preußen war maßgeblich am Spanischen Erbfolgekrieg, dem Nordischen Krieg, dem Österreichischen Erbfolgekrieg und dem Siebenjährigen Krieg beteiligt.
- Quote paper
- Michael Bernhard Pany (Author), 2006, Brandenburg-Preußen in den europäischen Konflikten des 17. und 18. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189116