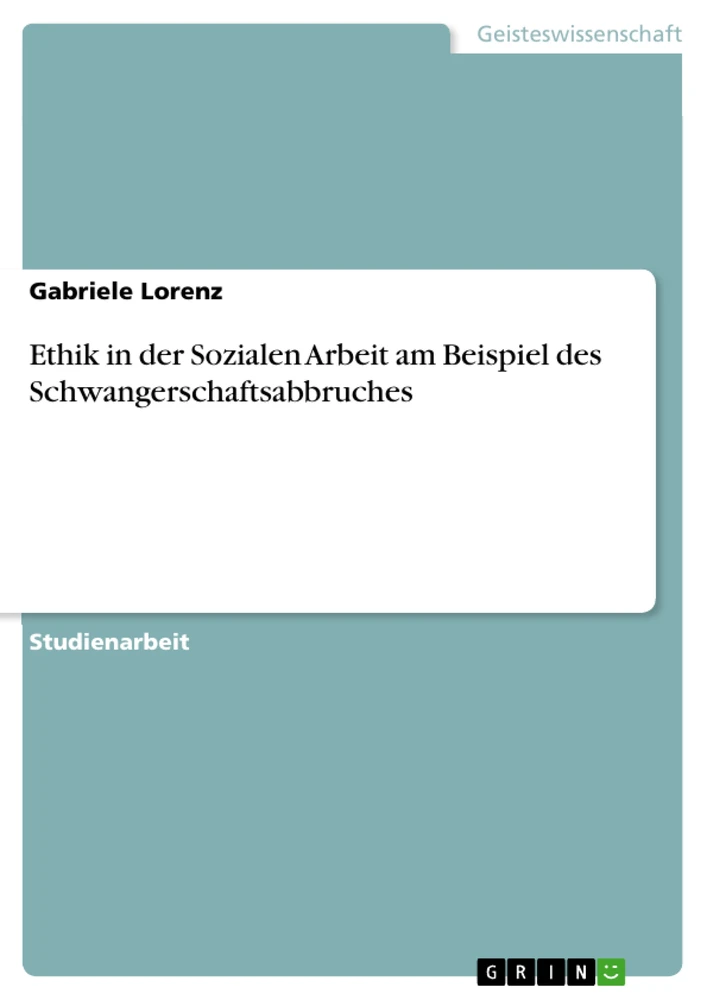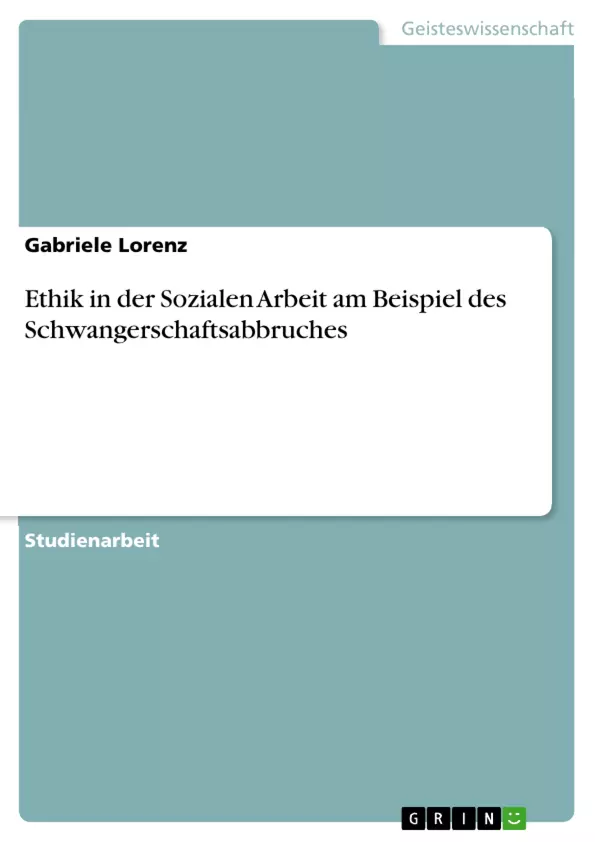Das Thema meiner Hausarbeit ist ‚Ethik in der Sozialen Arbeit am Beispiel des Schwangerschaftsabbruches‘. Da die Legalisierung des
Schwangerschaftsabbruches eine ethisch brisante und sozialwissenschaftlich relevante Frage ist, möchte ich im Folgenden einige Standpunkte und Erkundungen dazu zusammentragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemaufriss
- Zentrale Fragestellungen
- Methodische Vorgehensweise
- Definitionen
- Schwangerschaftsabbruch
- Ethik
- Schwangerschaftsabbruch
- Entwicklung und Stand der gesetzlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruches
- Zur Zahl der Schwangerschaftsabbrüche
- Ethik in der Sozialen Arbeit
- Die berufsethischen Prinzipien des DBSH
- Ethische Theorieansätze - ein Überblick
- Deontologische Ethik
- Teleologische Ethik (Utilitarismus)
- Anwendung ethischer Theorieansätze am Beispiel des Schwangerschaftsabbruchs
- Anwendung des deontologischen Theorieansatzes
- Anwendung des teleologischen Theorieansatzes
- Schlussfolgerungen für die Profession Soziale Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem ethischen Diskurs rund um den Schwangerschaftsabbruch und dessen Relevanz für die Soziale Arbeit. Ziel ist es, die ethische Dimension dieses komplexen Themas zu beleuchten und die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext zu erforschen.
- Ethische Implikationen des Schwangerschaftsabbruchs
- Relevanz ethischer Theorieansätze für die Soziale Arbeit
- Berufsethische Prinzipien des DBSH im Kontext des Schwangerschaftsabbruchs
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland
- Die Perspektive der werdenden Mutter im ethischen Diskurs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema "Ethik in der Sozialen Arbeit am Beispiel des Schwangerschaftsabbruches" ein und skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Kapitel 2 definiert die Begriffe "Schwangerschaftsabbruch" und "Ethik" und differenziert dabei zwischen den juristischen und ethischen Perspektiven. Kapitel 3 beleuchtet die Entwicklung und den Stand der gesetzlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland sowie die aktuelle Situation hinsichtlich der Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche. Kapitel 4 widmet sich den ethischen Prinzipien der Sozialen Arbeit und stellt zwei zentrale ethische Theorieansätze - die deontologische und die teleologische Ethik - vor.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen des Schwangerschaftsabbruchs, Ethik in der Sozialen Arbeit, ethischen Theorieansätzen, Selbstbestimmung, DBSH-Prinzipien, rechtliche Rahmenbedingungen, und dem Spannungsfeld zwischen individueller Entscheidung und gesellschaftlicher Moral.
- Quote paper
- Gabriele Lorenz (Author), 2011, Ethik in der Sozialen Arbeit am Beispiel des Schwangerschaftsabbruches, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189123