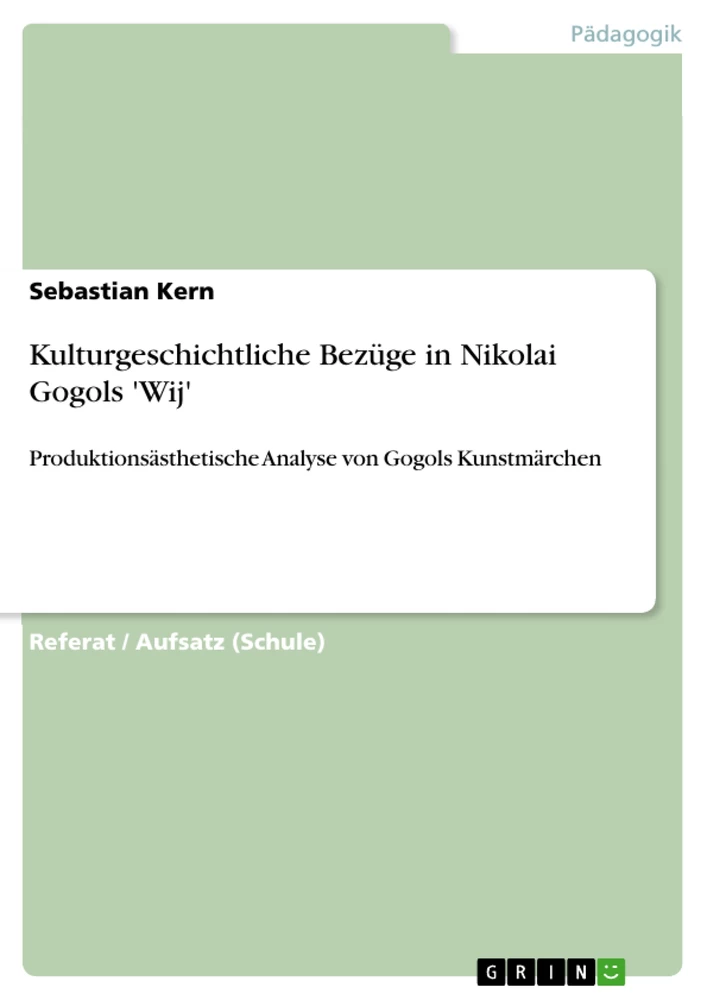Der Wij (auch Vij oder Wij) ist eine phantastische Erzählung des ukrainisch-russischen Schriftstellers Nikolai Wassiljewitsch Gogol. Sie wurde 1835 zusammen mit drei anderen Kurzerzählungen Gogols im Sammelband Mirgorod veröffentlicht. Der Text handelt von dem Philosophiestudenten Choma Brut, der gezwungen wird drei Nächte am Sarg einer Hexe zu beten. Dabei wird er von verschiedenen Dämonen heimgesucht bis er schließlich stirbt.
In einer Anmerkung verweist Gogol darauf, dass es sich bei der Geschichte um eine Volksüberlieferung handelt.1 Diese Arbeit basiert auf der Annahme, dass dies nicht wahr ist.2 Zum Einen gibt es keine Belege, die die Existenz des Wijs im slawischen Volksglauben bestätigen, zum Anderen würde eine schlicht wiedergegebene Sage keine größeren Parallelen zu Gogols anderen Werken aufweisen. Trotzdem beruht Der Wij nicht allein auf Gogols Ideen. Welche folkloristischen, mythologischen, literarischen und religiösen Bezüge weist die Erzählung auf? Diese Frage soll – dem Umfang der Arbeit entsprechend – durch einen produktionsästhetischen Ansatz geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse
- Inhaltszusammenfassung
- Produktionsästhetische Klärung der Leitfrage
- Folkloristische und mythologische Elemente
- Literarische Einflüsse
- Religiöse Motive
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Nikolai Gogols phantastische Erzählung „Der Wij“ unter einem produktionsästhetischen Ansatz. Sie untersucht die folkloristischen, mythologischen, literarischen und religiösen Bezüge der Geschichte und erforscht die Entstehung des Textes im Kontext seiner literarischen Traditionen und Einflüsse.
- Folkloristische und mythologische Elemente
- Literarische Einflüsse
- Religiöse Motive
- Gogols Schreibstil und Erzähltechniken
- Die Bedeutung der Geschichte im Kontext des 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik des „Wij“ ein und stellt die Forschungsfrage nach den Bezügen der Geschichte. Sie beleuchtet Gogols Angaben zur Volksüberlieferung und diskutiert ihre Plausibilität.
Inhaltszusammenfassung
Dieses Kapitel liefert eine kurze, prägnante Zusammenfassung der Handlung des „Wij“, inklusive der Hauptfiguren und der wichtigsten Ereignisse.
Produktionsästhetische Klärung der Leitfrage
Folkloristische und mythologische Elemente
Dieser Abschnitt untersucht die folkloristischen und mythologischen Elemente im „Wij“, insbesondere die Figur der Hexe und ihre Verwandlung als Vampir. Er analysiert die Anleihen aus der slawischen und griechischen Mythologie und die spezifischen Abweichungen Gogols.
Literarische Einflüsse
Dieses Kapitel analysiert die literarischen Einflüsse auf „Der Wij“, insbesondere Robert Southeys Ballade „The old woman of Berkeley“ und Goethes „Faust“. Es zeigt die inhaltlichen Überschneidungen und analysiert Gogols eigenständige Adaption der Quellen.
Religiöse Motive
Der Abschnitt behandelt die religiösen Motive im „Wij“ und die Rolle der Bibel als Inspirationsquelle für Gogol. Er untersucht die Verbindung des Bösen mit den Elementen der Erde und die Verwendung von Symbolen wie Skorpionen.
Schlüsselwörter
Nikolai Gogol, Der Wij, Folklore, Mythologie, Literatur, Religiöse Motive, Empuse, Vampir, Erdgeister, Gnomen, Robert Southey, Goethe, Faust, Bibel, Offenbarung des Johannes
Häufig gestellte Fragen
Worum handelt es sich bei Nikolai Gogols Erzählung 'Der Wij'?
'Der Wij' (1835) ist eine phantastische Erzählung über den Studenten Choma Brut, der drei Nächte lang am Sarg einer Hexe beten muss und dabei von Dämonen heimgesucht wird.
Ist die Figur des Wij eine echte slawische Volksüberlieferung?
Obwohl Gogol behauptete, es handele sich um eine Volksüberlieferung, gibt es keine Belege für die Existenz des Wijs im slawischen Volksglauben; die Geschichte weist starke Parallelen zu Gogols anderen Werken auf.
Welche literarischen Einflüsse lassen sich in 'Der Wij' finden?
Die Erzählung weist Einflüsse von Robert Southeys Ballade 'The old woman of Berkeley' und Goethes 'Faust' auf.
Welche religiösen Motive werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit analysiert die Rolle der Bibel, insbesondere der Offenbarung des Johannes, und die Verbindung des Bösen mit Elementen der Erde.
Was ist der methodische Ansatz der Analyse?
Die Untersuchung erfolgt durch einen produktionsästhetischen Ansatz, um folkloristische, mythologische und religiöse Bezüge zu klären.
Welche mythologischen Elemente kommen in der Geschichte vor?
Es werden die Figur der Hexe, ihre Verwandlung als Vampir sowie Anleihen aus der slawischen und griechischen Mythologie (z. B. Empuse) untersucht.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Kern (Autor:in), 2012, Kulturgeschichtliche Bezüge in Nikolai Gogols 'Wij', München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189219