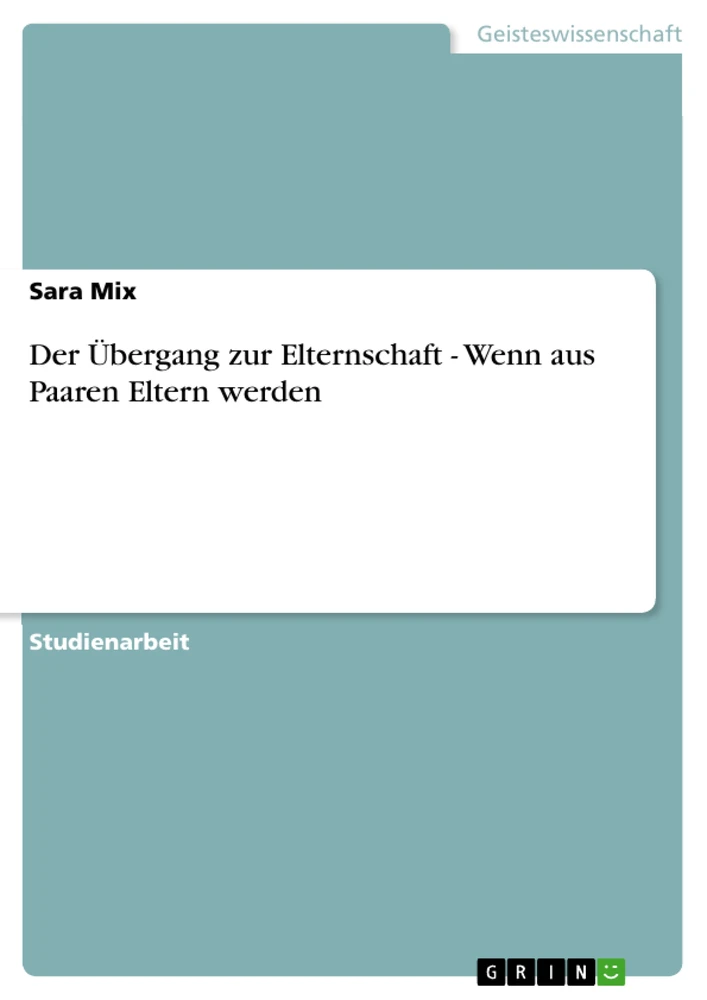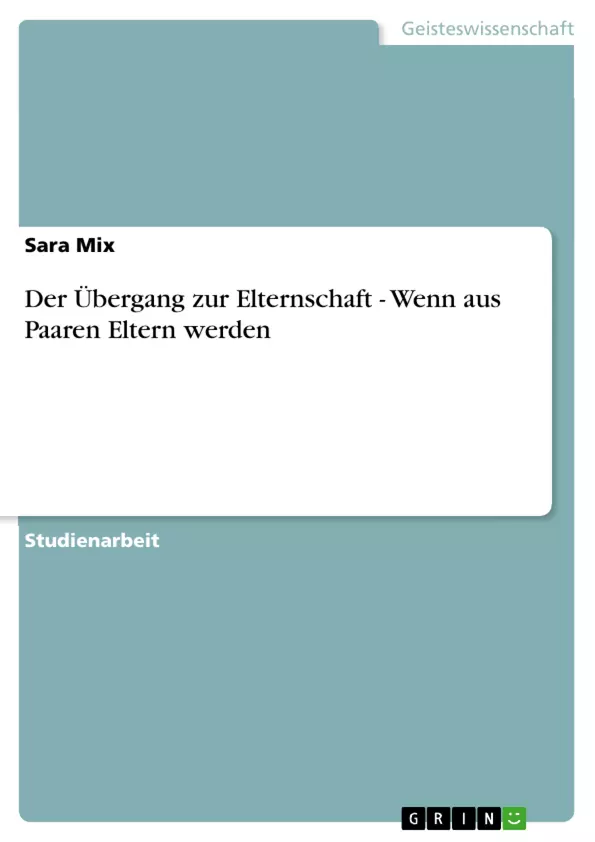„Kaum ein Ereignis verändert die Lebenssituation so grundlegend und nachhaltig wie die Geburt des ersten Kindes“ (Fthenakis et al. 2002, S. 355).
Die Geburt eines Kindes wird in der Gesellschaft meist als ein „freudiges Ereignis“ bezeichnet. Jedoch haben Eltern beim Übergang zur Elternschaft auch häufig sehr ambivalente Gefühle, denn rauschendes Glück und Gefühle von Unsicherheit und Überforderung liegen hier nah beieinander. Zwar sind sich viele Paare darüber im Klaren, dass Kinder auch Belastungen mit sich bringen, doch verbinden die meisten Menschen mit einem Kind eindeutig positive Aspekte. Viele Paare erwarten sich von der Geburt des ersten Kindes einen persönlichen Gewinn, das Erleben von Selbstverwirklichung, Freude und persönliche Weiterentwicklung (Erler et al. zit. n. El-Giamal 1999, S. 1). Empirische Befunde sprechen hingegen dafür, dass das Hinzukommen eines Kindes eine starke Umstellung im Alltag bedeutet und mit Belastungen einhergeht. Das heißt, die erste Elternschaft erfordert eine enorme Annpassungsleistung von Seiten der Eltern, da unter anderem ein neuer Gleichgewichtszustand erreicht werden muss. Aufgrund der vielen und starken Veränderungen, die der Übergang zur Elternschaft mit sich bringt, kann aus dem „freudigen Ereignis“ auch eine Krise entstehen. Wenn sich Paare aber bereits vor der Geburt ihres Kindes im Klaren darüber sind, dass und vor allem welche vielfältigen Belastungen auftreten werden, die gemeinsam gemeistert werden müssen, dann sind sie oft auch in der Lage, den Übergang zur Elternschaft gut zu bewältigen.
Der Übergang zur Elternschaft ist zentrales Thema der vorliegenden Arbeit. Sie ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil werden die theoretischen Grundlagen erörtert, wie zum Beispiel der Familien-Transitions-Ansatz und die Entwicklung von der Dyade zur Triade. Des Weiteren werden zentrale Forschungsergebnisse herangezogen. Der zweite Teil der Arbeit widmet sich den Belastungen und Triangulierungskonflikten, die beim Übergang zur Elternschaft entstehen können. Betrachtet wird die Zeit ab Geburt des Kindes. Während vielfältige Belastungserscheinungen beschrieben werden, wird gleichzeitig versucht, entsprechende Lösungsmöglichkeiten für Paare aufzuzeigen um den Belastungen gewachsen zu sein.
Im letzten Teil der Arbeit wird der Präventionsgedanke erläutert, welcher in der Beratung von Paaren, die Eltern werden bzw. sind, maßgeblich ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Übergang zur Elternschaft
- Der Familien-Transitions-Ansatz
- Phasenablauf beim Übergang zur Elternschaft
- Von der Zweier- zur Dreierbeziehung
- Belastungen und Triangulierungskonflikte im Übergang zur Elternschaft
- Beruf
- Zeit
- Finanzen
- Rollentraditionalisierung und enttäuschte Erwartungen
- Kommunikation
- Rollenmuster
- Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit
- Veränderungen in der Sexualität
- Neuinterpretation der Paarbeziehung und des Lebensstils
- Beratung von Paaren im Übergang zur Elternschaft
- Der Präventionsgedanke
- Implikationen für die Praxis
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Übergang zur Elternschaft, insbesondere die Herausforderungen und Belastungen, die Paare in dieser Phase erleben. Sie analysiert die Veränderungsprozesse, die mit der Geburt eines Kindes einhergehen und die Auswirkungen auf die Paarbeziehung sowie den Lebensstil der Eltern.
- Der Familien-Transitions-Ansatz und seine Relevanz für die Elternschaft
- Belastungen und Triangulierungskonflikte im Übergang zur Elternschaft
- Die Bedeutung von Kommunikation und Rollenverteilung in der neuen Familiensituation
- Die Rolle von Prävention und Beratung in der Begleitung von Paaren im Übergang zur Elternschaft
- Die Neuinterpretation der Paarbeziehung und des Lebensstils durch die Elternschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt den Übergang zur Elternschaft als ein zentrales Lebensereignis dar, das mit vielfältigen Herausforderungen und Belastungen verbunden ist. Sie beleuchtet die Ambivalenz der Gefühle von Paaren in dieser Phase und die Bedeutung von Anpassungsleistungen für die Bewältigung des Übergangs.
Im zweiten Kapitel wird der Familien-Transitions-Ansatz vorgestellt, der den Übergang zur Elternschaft als einen Veränderungsprozess betrachtet. Dieser Ansatz hebt die Bedeutung von individuellen und familialen Anpassungsprozessen sowie die Entwicklung neuen Verhaltens hervor.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Belastungen und Triangulierungskonflikten, die im Übergang zur Elternschaft auftreten können. Es werden verschiedene Bereiche wie Beruf, Zeit, Finanzen, Rollentraditionalisierung und Kommunikation beleuchtet, die zu Konflikten führen können.
Das vierte Kapitel behandelt die Neuinterpretation der Paarbeziehung und des Lebensstils durch die Elternschaft. Es werden Beratungsmöglichkeiten für Paare im Übergang zur Elternschaft und der Präventionsgedanke als wichtige Elemente der Begleitung und Unterstützung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Familien-Transitions-Ansatz, Elternschaft, Übergang zur Elternschaft, Belastungen, Triangulierungskonflikte, Paarbeziehung, Kommunikation, Rollenverteilung, Prävention, Beratung.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert die Geburt des ersten Kindes die Paarbeziehung?
Der Übergang zur Elternschaft bedeutet eine fundamentale Umstellung von der Zweierbeziehung (Dyade) zur Dreierbeziehung (Triade), was oft zu Rollenveränderungen und neuen Belastungen führt.
Was ist der Familien-Transitions-Ansatz?
Dieser Ansatz betrachtet den Übergang zur Elternschaft als einen kritischen Lebensübergang, der von den Eltern erhebliche Anpassungsleistungen in den Bereichen Identität, Rollen und Kommunikation erfordert.
Welche Belastungen treten beim Übergang zur Elternschaft häufig auf?
Häufige Belastungen betreffen die Finanzen, die Zeitplanung, die Aufteilung der Hausarbeit (Rollentraditionalisierung), die Sexualität und die Kommunikation zwischen den Partnern.
Was sind Triangulierungskonflikte?
Dies sind Konflikte, die entstehen, wenn ein Partner sich durch die intensive Beziehung des anderen zum Kind ausgeschlossen fühlt oder wenn das Kind zum Zentrum von Paarkonflikten wird.
Wie kann Prävention Paaren beim Start in die Elternschaft helfen?
Präventive Beratung hilft Paaren, realistische Erwartungen zu entwickeln, Kommunikationsmuster zu verbessern und sich frühzeitig über die Aufteilung von Aufgaben und Rollen klar zu werden.
- Arbeit zitieren
- Sara Mix (Autor:in), 2011, Der Übergang zur Elternschaft - Wenn aus Paaren Eltern werden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189263