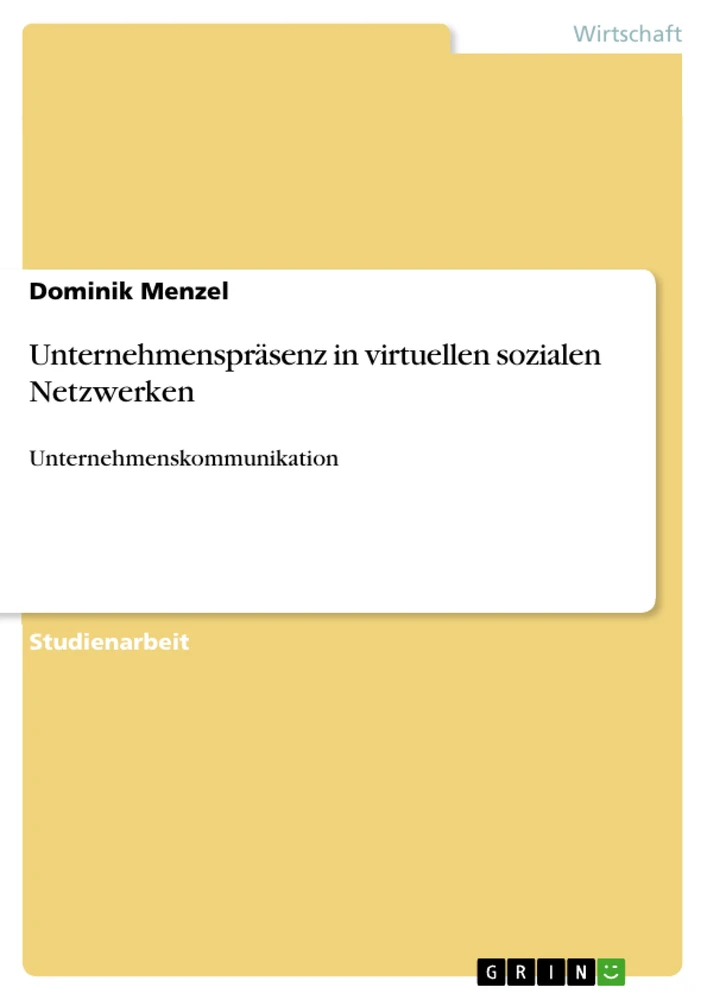Mit mehr als 43 Millionen Bundesbürgern, die das Internet auf täglicher Basis nutzen, hat sich dieses als Alltagsmedium in Deutschland etabliert. Die Möglichkeit, so viele Menschen mit einem relativ kostengünstigen Medium zu erreichen, zeugt, unter Berücksichtigung des schnellen Wachstums dieses Marktes, von dem großen wirtschaftlichen Potenzial. Da die Werbung immer noch eine hohe Akzeptanz beim Verbraucher hat, sucht eine Vielzahl wer-betreibender Industrien einen Weg dialogorientierte Werbung zu generieren. Dies erfordert eine mediale Herangehensweise der Unternehmen an die Konsumenten. Hieraus haben sich neue Geschäftsmodelle, sowie neue Marketingstrategien und -instrumente entwickelt. Ver-braucher nutzen das Internet verstärkt um sich bspw. zu informieren oder Einkäufe zu täti-gen. Unternehmen müssen hier ansetzen, um potenzielle Käufer aufmerksam zu machen und dadurch zusätzliche Potenziale auszuschöpfen. Die Entwicklung virtueller sozialer Netzwerke spielt dabei eine erhebliche Rolle. Nachdem Kommunikationsplattformen bislang hauptsächlich nur zu privaten Zwecken genutzt wurden und Unternehmen ihren Auftritt im Internet auf ihre Homepage und kleine Werbeanzeigen beschränkten, hält „die 2.0-Bewegung Einzug in die Unternehmenswelt“. Durch sie bekommen Unternehmen und Kun-de die Möglichkeit, virtuell auf einer Plattform miteinander zu kommunizieren, zu interagie-ren und Transaktionen zu tätigen. Über die Aktivität in virtuellen sozialen Netzwerken versu-chen sich Unternehmen neue Kommunikationszweige zu Nutze zu machen.
Die rasante Entwicklung und steigende Bedeutung des Internets in der Gesellschaft birgt ein spannendes Untersuchungsfeld. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Relevanz und den technischen Möglichkeiten der Werbung in virtuellen sozialen Netzwerken aus Sicht der Unternehmen und der Konsumenten. Virtuelle soziale Netzwerke werden dahingehend be-trachtet, wie diese als Marketinginstrument eingesetzt werden können. Desweiteren wird darauf eingegangen, welche Maßnahmen in virtuellen sozialen Netzwerken ergriffen wer-den, um Kundenakquise, Kundenbindung und Personalgewinnung zu betreiben. Für Anbieter, die im Rahmen dieser Arbeit als jene Unternehmen determiniert sind, die Waren oder Dienstleistungen produzieren und vertreiben, stellen virtuelle soziale Netzwerke ein Instru-mentarium dar, um ihren Absatzmarkt zu erweitern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung Web 2.0
- Virtuelle soziale Netzwerke als Kommunikationsinstrument im Web 2.0
- Begriffserklärung virtuelle soziale Netzwerke
- Motive für Nutzer
- Beispiel: StudiVZ
- Virtuelle soziale Netzwerke als Kommunikationsinstrument für Unternehmen
- Arten der Präsenz
- Profile in virtuellen sozialen Netzwerken
- Blogs
- Motive für Unternehmen
- Personalmarketing
- Personalbeschaffung
- Personalbewertung
- Mund-zu-Mund Kommunikation
- Personalmarketing
- Nutzen und Risiken für Unternehmen
- Nutzen für Unternehmen
- Beispiel: Otto Group GmbH & Co. KG
- Arten der Präsenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Relevanz und den technischen Möglichkeiten der Werbung in virtuellen sozialen Netzwerken aus Sicht der Unternehmen und der Konsumenten. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Nutzung von virtuellen sozialen Netzwerken als Marketinginstrument. Die Arbeit beleuchtet, welche Maßnahmen in diesen Netzwerken ergriffen werden können, um Kundenakquise, Kundenbindung und Personalgewinnung zu betreiben. Virtuelle soziale Netzwerke stellen für Unternehmen ein Instrumentarium dar, um ihren Absatzmarkt zu erweitern.
- Die Bedeutung des Web 2.0 und seine Auswirkungen auf die Unternehmenskommunikation.
- Die Nutzung von virtuellen sozialen Netzwerken als Kommunikationsinstrument für Unternehmen.
- Die verschiedenen Arten der Unternehmenspräsenz in virtuellen sozialen Netzwerken.
- Die Motive von Unternehmen für die Nutzung von virtuellen sozialen Netzwerken.
- Der Nutzen und die Risiken von virtuellen sozialen Netzwerken für Unternehmen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Unternehmenspräsenz in virtuellen sozialen Netzwerken dar und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie skizziert den aktuellen Stand des Internets als Alltagsmedium und die wachsende Bedeutung von Dialogorientierter Werbung.
- Begriffserklärung Web 2.0: Dieses Kapitel erläutert den Begriff Web 2.0, seine Entstehung und seine Charakteristika. Es wird auf die neuen Technologien, die Interaktivität und die Kundenintegration im Web 2.0 eingegangen.
- Virtuelle soziale Netzwerke als Kommunikationsinstrument im Web 2.0: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Typisierung virtueller sozialer Netzwerke. Es werden die Motive der Nutzer und das Beispiel von StudiVZ vorgestellt.
- Virtuelle soziale Netzwerke als Kommunikationsinstrument für Unternehmen: Dieses Kapitel widmet sich den Unternehmen und deren Einsatz von sozialen Netzwerken als Medium. Es werden die Arten der Präsenz, die Motive für Unternehmen und die Nutzen und Risiken dieser Netzwerke beleuchtet. Das Kapitel enthält zudem ein Beispiel für die Unternehmenspräsenz von Otto Group GmbH & Co. KG.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Web 2.0, virtuelle soziale Netzwerke, Unternehmenskommunikation, Marketing, Personalmarketing, Kundenakquise, Kundenbindung, Mund-zu-Mund Kommunikation, Nutzen und Risiken.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Web 2.0 für Unternehmen?
Web 2.0 ermöglicht einen interaktiven Dialog zwischen Unternehmen und Konsumenten. Es geht weg von der reinen Informationsvermittlung hin zur aktiven Kommunikation und Kundenintegration.
Wie können soziale Netzwerke als Marketinginstrument genutzt werden?
Unternehmen nutzen Profile und Blogs in Netzwerken zur Kundenakquise, zur Steigerung der Kundenbindung und zur Durchführung von dialogorientierten Werbekampagnen.
Welche Rolle spielt Social Media im Personalmarketing?
Virtuelle Netzwerke dienen der Personalbeschaffung (Recruiting) und der Bewertung potenzieller Mitarbeiter, wodurch neue Kanäle für die Gewinnung von Fachkräften entstehen.
Was sind die Risiken für Unternehmen in sozialen Netzwerken?
Neben dem Kontrollverlust über die Kommunikation besteht das Risiko negativer Mund-zu-Mund-Propaganda und Imageverlusten durch Fehltritte im virtuellen Raum.
Gibt es Praxisbeispiele für erfolgreiche Unternehmenspräsenzen?
In der Arbeit wird unter anderem die Otto Group GmbH & Co. KG als Beispiel für eine gelungene Integration von Social Media in die Unternehmensstrategie herangezogen.
- Quote paper
- B.Sc. Dominik Menzel (Author), 2010, Unternehmenspräsenz in virtuellen sozialen Netzwerken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189291