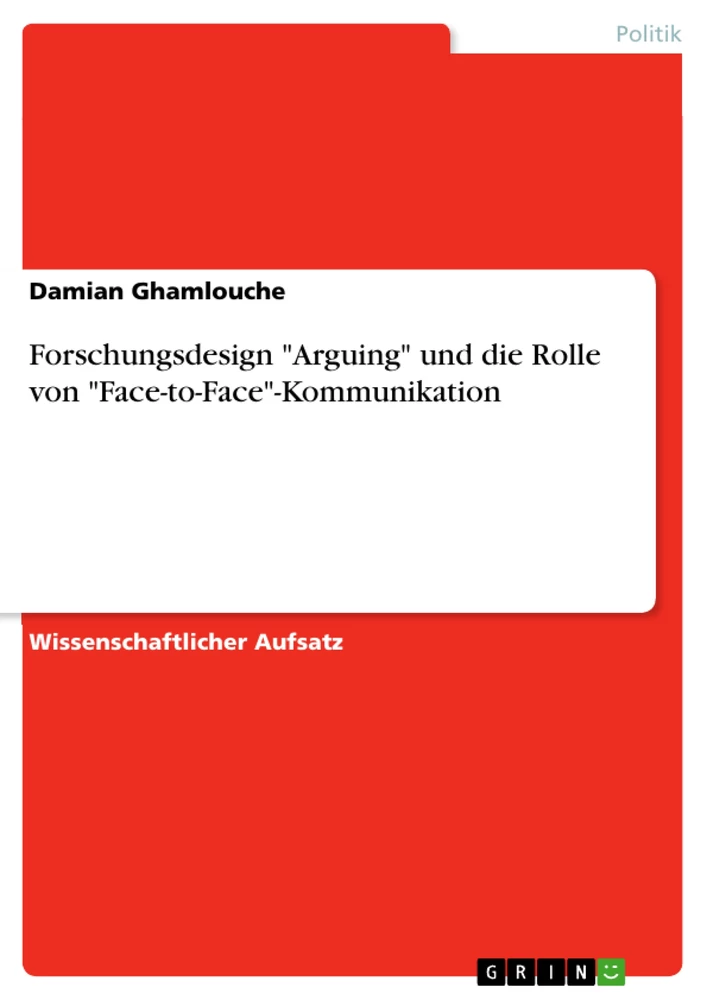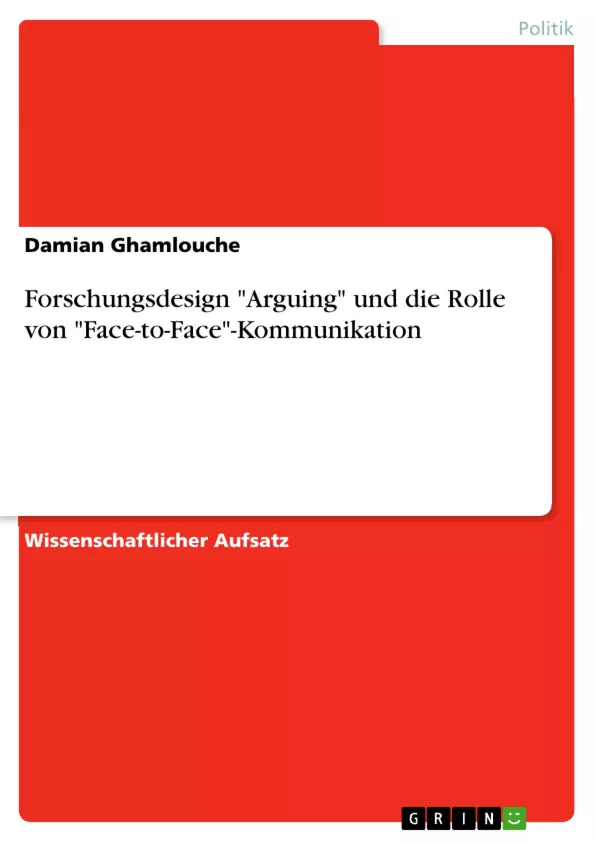Das vorliegende Forschungsdesign behandelt das empirische Thema des
Kommunikationsmodus „Arguing“ in multilateralen Verhandlungen, wobei analytisch
zwei Kommunikationsmodi unterschieden werden können: Verhandeln („Bargaining“)
und Argumentieren („Arguing“). „Bargaining“ wird primär durch rationalistische
Theorien und „Arguing“ primär durch konstruktivistische Ansätze erfasst, deswegen
sind Ansätze, die beide theoretischen Stränge vereinen, um die Kommunikationsmodi
zu erklären, zu bevorzugen. Die vorliegende Arbeit hat den Anspruch,
theorieerweiternd zu wirken, wobei nicht ein integrativer Ansatz beider Theoriestränge
gewählt wird. Es wird zwar nicht versucht, die analytische Dichotomie von „Arguing“
und „Bargaining zu überwinden, jedoch wird mit der Erkenntnis gearbeitet, dass
Formen des „Argumentierens“ auch im strategischen Handeln vorkommen, das dem
Kommunikationsmodus „Bargaining“ zugeschrieben wird, weshalb hier ein qualitatives
Konzept des Grades von „Arguing“ vorgeschlagen wird. Andererseits wird eine
Theorieerweiterung in der systematischen Erarbeitung der Rolle der
Kommunikationsform für den Kommunikationsmodus „Arguing“ vorgenommen, also
wird versucht, die Bedingungen für den Kommunikationsmodus „Arguing“ zu
erläutern. Somit ist das Ziel dieser Arbeit nicht, die Ergebnisse von Verhandlungen zu
erklären. Vielmehr wird versucht, den theoretischen Diskurs über die Kategorie
„Arguing“ zu reflektieren und eine weitere Variable in den Diskurs einzuführen,
nämlich die Kommunikationsform. Analytisch können zwei Formen der
Kommunikation unterschieden werden: „Face-to-Face“-Kommunikation (folgend
„FTF“-Kommunikation) und medialisierte Kommunikation (z. B. textbasierte
Kommunikation und computervermittelte Kommunikation). Die Variable der
Kommunikationsform wurde im bisherigen Diskurs vernachlässigt und als
selbstverständliche Kommunikationsstruktur betrachtet. Mediensoziologische Ansätze
diskutieren hingegen die Kommunikationsform als wichtige Struktur, die die inhaltliche
und formale Dimension der Kommunikation determiniert. Als Forschungsfrage kann
daher formuliert werden: Beeinflusst die Kommunikationsform den Grad von
„Arguing“?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Relevanz der Forschungsfrage
- Aktueller Forschungsstand und Verortung der Fragestellung
- Theoretische Hypothesen- und Variablengenerierung
- Theoretische Hypothesengenerierung
- Abhängige Variable: Grad von „Arguing“
- Unabhängige Variable: Grad von „FTF“-Kommunikation
- Kontrollvariablen
- Methodik
- komparative Fallstudie und „Process-Tracing“
- Operationalisierung der Variablen
- Begründung der Fallauswahl, Untersuchungszeitraum und „Most-Similar-Case-Design“
- „Process-Tracing“
- Empirische Datenlage
- Arbeitsplan
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Kommunikationsmodus „Arguing“ in multilateralen Verhandlungen und untersucht den Einfluss der Kommunikationsform auf den Grad von „Arguing“. Die Arbeit zielt darauf ab, den theoretischen Diskurs über die Kategorie „Arguing“ zu erweitern und eine weitere Variable, nämlich die Kommunikationsform, in den Diskurs einzuführen.
- Analyse des Kommunikationsmodus „Arguing“ in multilateralen Verhandlungen
- Einführung der Kommunikationsform als wichtige Variable im Diskurs über „Arguing“
- Untersuchung der Bedingungen für den Kommunikationsmodus „Arguing“
- Theoretische und methodische Erweiterung des Diskurses über „Arguing“
- Beitrag zur Erforschung von Kooperationsmechanismen in multilateralen Verhandlungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Relevanz der Forschungsfrage
Das Forschungsdesign beschäftigt sich mit dem Kommunikationsmodus „Arguing“ in multilateralen Verhandlungen. Es wird argumentiert, dass Formen des „Argumentierens“ auch im strategischen Handeln vorkommen, das dem Kommunikationsmodus „Bargaining“ zugeschrieben wird. Daher wird ein qualitatives Konzept des Grades von „Arguing“ vorgeschlagen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedingungen für den Kommunikationsmodus „Arguing“ zu erläutern und die Rolle der Kommunikationsform für „Arguing“ zu untersuchen. Die Forschungsfrage lautet: Beeinflusst die Kommunikationsform den Grad von „Arguing“?
Aktueller Forschungsstand und Verortung der Fragestellung
Die Fragestellung lässt sich in die Theorie der Internationalen Beziehung des Sozialkonstruktivismus einordnen. Der Sozialkonstruktivismus betrachtet die Realität als vermittelt über menschliches Handeln und geteilte Vorstellungen, die eine soziale Welt erzeugen. Für diese Arbeit ist insbesondere die sozialkonstruktivistische Literatur über „Arguing“ und die mediensoziologische Literatur über „FTF“-Kommunikation relevant.
Theoretische Hypothesen- und Variablengenerierung
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Erarbeitung theoretischer Hypothesen und der Definition der abhängigen und unabhängigen Variablen. Die abhängige Variable ist der Grad von „Arguing“, die unabhängige Variable ist der Grad von „FTF“-Kommunikation. Die Kontrollvariablen werden ebenfalls erläutert.
Methodik
Die Arbeit verwendet die komparative Fallstudie und „Process-Tracing“ als Methoden. Die Variablen werden operationalisiert und die Fallauswahl wird begründet. Es werden zwei empirische Fälle herangezogen, um eine Antizipation der Ergebnisse zu erhalten.
„Process-Tracing“
Dieser Abschnitt befasst sich mit dem „Process-Tracing“, um einen Kausalpfad, der die unabhängige und die abhängige Variable verbinden könnte, vorzuschlagen.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter dieser Arbeit sind „Arguing“, „Bargaining“, „FTF“-Kommunikation, multilaterale Verhandlungen, Sozialkonstruktivismus, „Process-Tracing“, komparative Fallstudie, mediensoziologische Ansätze, Kommunikationsform, Grad von „Arguing“.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen „Arguing“ und „Bargaining“?
„Bargaining“ (Verhandeln) basiert auf rationalistischem, strategischem Handeln zur Nutzenmaximierung. „Arguing“ (Argumentieren) ist ein konstruktivistischer Modus, bei dem Akteure durch gegenseitiges Überzeugen und den Austausch von Argumenten zu einem Konsens gelangen wollen.
Welchen Einfluss hat die „Face-to-Face“-Kommunikation auf Verhandlungen?
Die Arbeit untersucht die Hypothese, dass die physische Anwesenheit (Face-to-Face) den Grad von „Arguing“ erhöht, da sie soziale Bindungen stärkt und die inhaltliche sowie formale Dimension der Kommunikation anders strukturiert als medialisierte Formate.
Warum wird die Kommunikationsform als neue Variable eingeführt?
Bisher wurde die Kommunikationsstruktur oft als selbstverständlich vorausgesetzt. Mediensoziologische Ansätze zeigen jedoch, dass die Form (z. B. Text vs. Gespräch) maßgeblich bestimmt, wie Argumente wahrgenommen und ausgetauscht werden.
Was ist das Ziel des „Process-Tracing“ in dieser Arbeit?
Mit Process-Tracing wird versucht, den Kausalpfad zwischen der Kommunikationsform (unabhängige Variable) und dem Grad des Argumentierens (abhängige Variable) in multilateralen Verhandlungen detailliert nachzuzeichnen.
In welchen theoretischen Rahmen ist die Forschungsfrage eingebettet?
Die Arbeit verortet sich im Sozialkonstruktivismus der Internationalen Beziehungen. Dieser Ansatz betrachtet die soziale Welt und Kooperationsmechanismen als Ergebnis menschlichen Handelns und geteilter Vorstellungen.
- Arbeit zitieren
- Damian Ghamlouche (Autor:in), 2009, Forschungsdesign "Arguing" und die Rolle von "Face-to-Face"-Kommunikation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189366