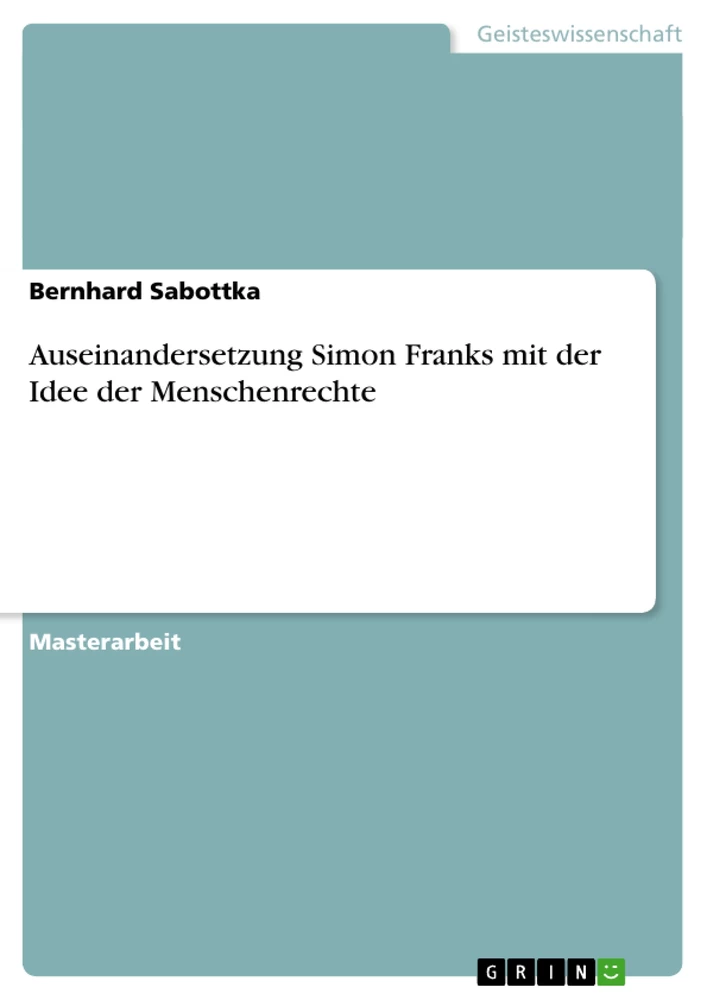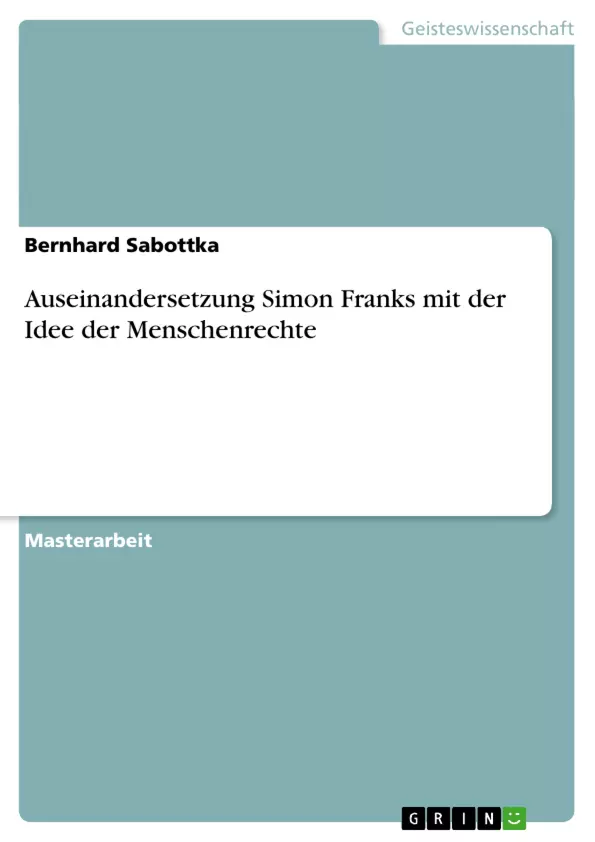Die Menschenrechte gelten heute als die Grundlage unserer westlichen Kultur. Im öffentlichen Bewusstsein wird ihre Geltung als selbstverständlich hingenommen. Gedanken machen wir uns nur, wenn über Menschenrechtsverletzungen in der Ferne berichtet wird, aber
auch dann findet eine Auseinandersetzung mit den Menschenrechten selbst kaum statt. Nur im Gespräch mit anderen Kulturen, vor allem ostasiatischen, die stärker vom Gemeinschaftsgedanken geprägt sind, kommt es mitunter zur Frage nach der Geltung der Menschenrechte.
Simon L. Frank, ein russischer Philosoph der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (gestorben 1950 in London), setzt sich in seinen Werken nur stellenweise direkt mit den Menschenrechten auseinander – doch wenn, ist sein Urteil äußerst kritisch. Sie sind für ihn Ausdruck
maßloser Ansprüche der Menschen, basierend auf ihrer Einstellung, die den einzelnen Menschen vergottet.
Wie kommt er zu solch einem Urteil? Dieser Frage gilt es in der vorliegenden Arbeit nachzugehen. Doch auch wenn eine solche Ansicht sicherlich für uns ungewöhnlich erscheint,ist es nicht primär dieses Urteil selbst, das eine Auseinandersetzung mit Simon Frank lohnenswert werden lässt. Als Metaphysiker versucht er das Sein als Ganzes und unser Verhältnis zu diesem zu erfassen. Er gehört zu den wenigen Philosophen, die erkennen, dass jede Frage letztlich eine ontologische ist und somit jede Antwort sich von den ontologischen
Grundlagen her, begründet wissen muss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in Franks Ontologie
- Die empirische Wirklichkeit
- Das ideale Sein
- Die Realität des Subjekts und das geistige Leben
- Die docta ignoratia
- Der Begriff des Menschen bei Simon Frank
- Die zwei Naturen des Menschen
- Der Mensch als Vertriebener
- Das Transzendieren nach außen
- Das Erkennen
- Ich und Du
- Vom Transzendieren nach innen zum Begriff Gottes
- Die Gottmenschlichkeit
- Randbetrachtung zu Franks Sprache über den Menschen
- Der sittliche Charakter des Menschen
- Die zweifache Beziehung des Selbst zum Guten
- Die Möglichkeit des Menschen zur Sünde
- Die Gesellschaft
- Die Realgeltung des Wir
- Die ontologische Natur der Gesellschaft
- Die zwei Aspekte der Gesellschaft
- Die geistige Natur der Gesellschaft
- Das Heilige in der Gesellschaft
- Der sittliche Charakter der Gesellschaft
- Das Prinzip des Dienstes
- Franks Auseinandersetzung mit der Idee der Menschenrechte
- Franks Blick auf die Menschenrechte
- Die Hierarchie
- Die Gleichheit
- Die Freiheit
- Die Glaubensfreiheit
- Auseinandersetzung mit Franks Menschenrechtsbegriff
- Der Staat
- Die bürgerliche Gesellschaft
- Das Recht
- Der Staat und der einzelne Mensch
- Franks Blick auf die Menschenrechte
- Franks Beitrag zur aktuellen Debatte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Auseinandersetzung des russischen Philosophen Simon L. Frank mit der Idee der Menschenrechte. Sie analysiert Franks Kritik an den Menschenrechten als Ausdruck maßloser Ansprüche des Menschen, die auf einer Vergötterung des Individuums basieren. Das Ziel ist es, Franks Kritik zu verstehen und in den Kontext seiner philosophischen Grundlegung zu stellen.
- Franks ontologische Grundlegung des Seins als Ganzes
- Das Verständnis des Menschen und seiner Beziehung zur Gesellschaft bei Frank
- Franks Kritik an den Menschenrechten und deren Begründung
- Die Relevanz von Franks Denken für das Verständnis der Menschenrechte in der heutigen Zeit
- Die Frage nach der Geltung von Menschenrechten im Kontext der westlichen Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung der Menschenrechte in der heutigen Zeit und Franks kritische Sichtweise auf sie hervorhebt. Das zweite Kapitel stellt Franks Ontologie dar, die als Grundlage für sein Verständnis von Mensch und Gesellschaft dient.
Kapitel 3 konzentriert sich auf den Begriff des Menschen bei Frank, einschließlich seiner Doppelnatur, seiner Rolle als Vertriebener und seiner Fähigkeit zum Transzendieren. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Gesellschaft, ihrer Realgeltung und ihrer ontologischen Natur.
Kapitel 5 analysiert Franks Auseinandersetzung mit der Idee der Menschenrechte, seine Kritik an den Prinzipien der Hierarchie, Gleichheit, Freiheit und Glaubensfreiheit sowie seine Position zum Staat, zur bürgerlichen Gesellschaft, zum Recht und dem Verhältnis zwischen Staat und Individuum.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf Simon L. Franks philosophische Anthropologie und seine Kritik an den Menschenrechten. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Ontologie, Sein, Mensch, Gesellschaft, Realgeltung, Transzendieren, Hierarchie, Gleichheit, Freiheit, Glaubensfreiheit, Staat, bürgerliche Gesellschaft, Recht, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Warum kritisierte Simon Frank die Idee der Menschenrechte?
Frank sah in ihnen Ausdruck maßloser Ansprüche des Menschen, die auf einer „Vergötterung“ des Individuums und einer Abkehr von ontologischen Pflichten basieren.
Was versteht Frank unter „Gottmenschlichkeit“?
Es ist ein zentraler Begriff seiner Anthropologie, der die untrennbare Verbindung des menschlichen Seins mit dem göttlichen Urgrund beschreibt.
Wie definiert Frank die Natur der Gesellschaft?
Für Frank hat die Gesellschaft eine ontologische Natur; er betont die Realgeltung des „Wir“ und den sittlichen Charakter der Gemeinschaft über dem Individuum.
Was bedeutet „Prinzip des Dienstes“ bei Simon Frank?
Anstelle von Rechten betont Frank die Pflicht des Menschen zum Dienst an der Gemeinschaft und an Gott als wahre Grundlage des Zusammenlebens.
Wie steht Frank zu Freiheit und Gleichheit?
Er setzt sich kritisch mit diesen Begriffen auseinander und hinterfragt deren rein säkulare Auslegung in den westlichen Menschenrechtserklärungen.
Welchen Beitrag leistet Frank zur aktuellen Debatte?
Sein Denken bietet eine metaphysische Perspektive, die das westliche Verständnis von Individualrechten im Dialog mit gemeinschaftsorientierten Kulturen hinterfragt.
- Quote paper
- Bernhard Sabottka (Author), 2007, Auseinandersetzung Simon Franks mit der Idee der Menschenrechte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189369