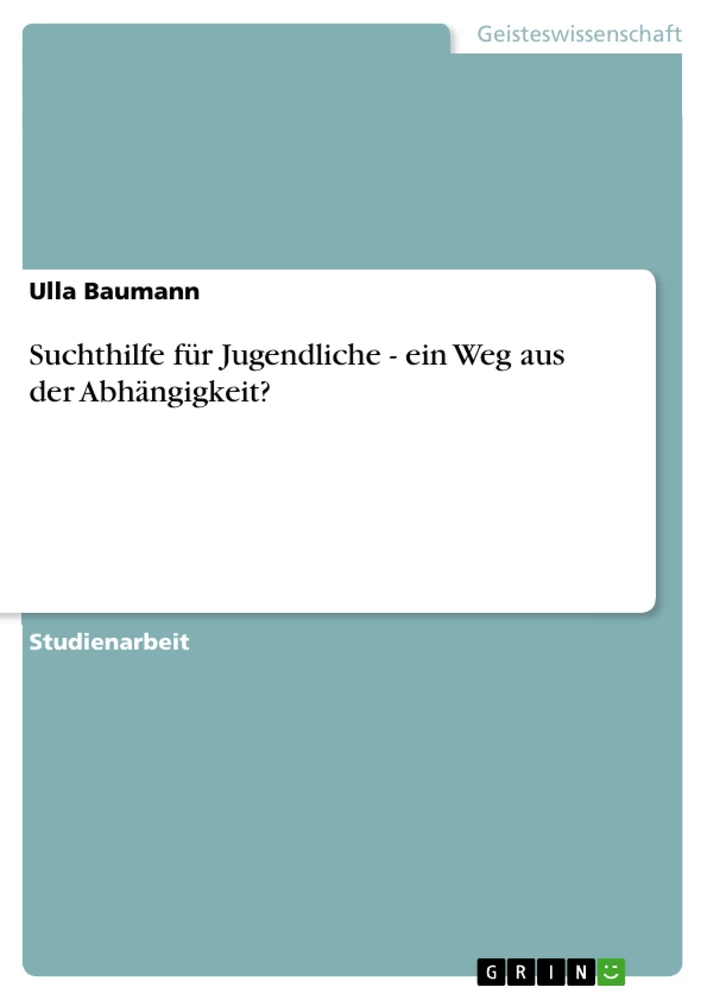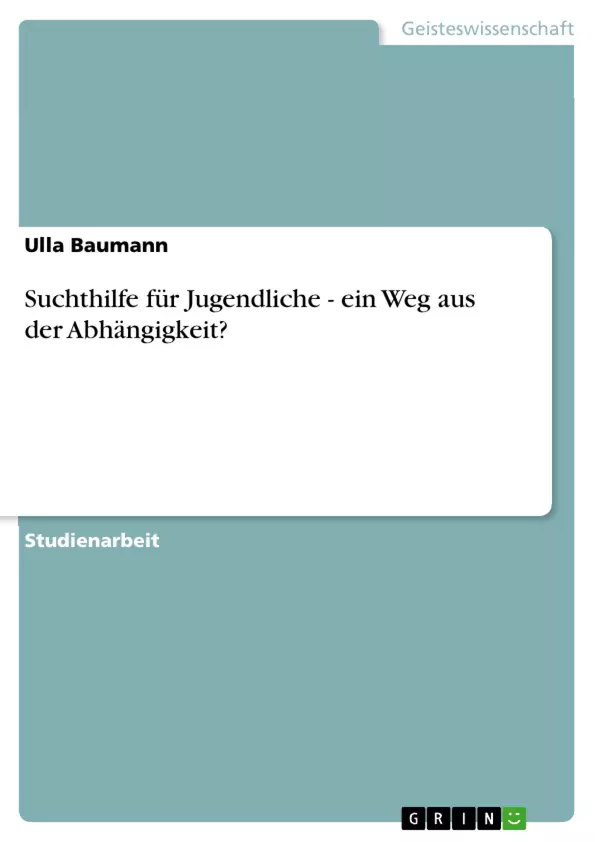Einleitung
Nach Angaben der BZGA trinken bereits 20,4 % der 12-16 Jährigen mindestens einmal im Monat Bier. Im Hinblick auf die Gruppe der 16-18 Jährigen liegt dieser Wert mit 63% erheb-lich darüber. Auch „harte Drogen“ wie zum Beispiel Kokain und LSD werden inzwischen (Stand 2008) zu 14,1 % von Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren konsumiert.
Die Schlagzeilen der Berichterstattung der Massenmedien häufen sich in entsprechender Wei-se: „Sucht nach dem Vollrausch“ (Spiegel online 04.02.2011), „Gesellschaftsdroge Alkohol-Die Krankheit Jugend“ (Süddeutsche, 09.08.2011), „Koma-Saufen - Trainiert die Jugend im Drogenkonsum!“ (Welt.de, 12.03.2007). Das sind nur einige Beispiele, die ein erschreckendes Jugendbild abzeichnen. Das Thema Rauschmittel in Verbindung mit Jugendlichen hat derzeit Hochkonjunktur. Und was dem Vollrausch folgt, ist nicht selten der Weg in die Sucht. So verzeichnete die ambulante Suchthilfe 2009 in Deutschland 152.304 Neuzugänge. Unter den substanzgebundenen Abhängigkeiten nimmt Alkohol mit 53,7%, der sich an Suchthilfe wen-denden Betroffenen, die größte Rolle ein. Aber auch Cannabis, Kokain und weitere „harte Drogen“ stellen einen beträchtlichen Anteil Hilfesuchender von 36,4%. Die Inanspruchnahme von Suchthilfe ist bei Tabakkonsum mit 1,2 % der geringste Bereich (www.deutsche Sucht-hilfestatistik.de).
Diese alarmierenden Ergebnisse weisen deutlich auf eine gefährliche Entwicklung hin und sind Erfordernis genug, die Aufgaben und Wirksamkeit der Suchthilfe, speziell hinsichtlich des rasant ansteigenden Suchtpotenzials Jugendlicher, zu hinterfragen, um mögliche Mängel des Hilfesystems erkennbar zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Suchthilfe bei Jugendlichen als ein Handlungsfeld der Sozialpädagogik
- Begriffsklärung Sucht
- Definition Suchthilfe
- Besonderheiten der Suchthilfe bei Heranwachsenden
- Mindeststandards – Aufgaben und Ziele
- Arbeitsfelder der Suchthilfe
- Suchtprävention als Bildungsaufgabe der Schulen
- Suchtprävention in der Jugendarbeit
- Suchtberatung Heranwachsender im Internet
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, denen sich die soziale Arbeit im Bereich der suchtspezifischen Prävention für Jugendliche gegenübersieht. Sie konzentriert sich auf die Lebensphase der Jugend, da diese im Fokus gesellschaftlicher und sozialpolitischer Debatten steht.
- Erläuterung der grundlegenden Merkmale sozialpädagogischer Suchthilfe
- Analyse der Besonderheiten und Anforderungen der Suchthilfe bei Jugendlichen
- Bewertung gesetzlicher und gesellschaftlicher Mindeststandards in der Suchthilfe
- Vorstellung verschiedener Arbeitsfelder der jugendspezifischen Suchthilfe
- Diskussion der Chancen und Schwierigkeiten der Sozialpädagogik in diesem Handlungsbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die aktuelle Situation des Jugendalkoholkonsums und die alarmierenden Zahlen der Suchthilfe in Deutschland. Die Arbeit stellt die Frage nach den Herausforderungen für die soziale Arbeit im Bereich der suchtspezifischen Prävention von Jugendlichen.
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Sucht und Suchthilfe und analysiert die besonderen Herausforderungen der Suchthilfe bei Jugendlichen.
Das zweite Kapitel präsentiert verschiedene Arbeitsfelder der jugendspezifischen Suchthilfe, wie beispielsweise Suchtprävention in Schulen und Jugendarbeit, sowie die neue Entwicklung der virtuellen Suchthilfe.
Schlüsselwörter
Sozialpädagogische Suchthilfe, Jugendspezifische Prävention, Sucht, Abhängigkeit, Substanzgebundene Abhängigkeit, Nicht-Substanzgebundene Abhängigkeit, Suchtberatung, Jugendhilfe, Schule, Internet.
Häufig gestellte Fragen
Wie verbreitet ist Alkoholkonsum unter Jugendlichen in Deutschland?
Laut BZGA trinken über 20 % der 12-16-Jährigen und über 60 % der 16-18-Jährigen mindestens einmal im Monat Alkohol.
Was sind die Aufgaben der jugendspezifischen Suchthilfe?
Sie umfasst Prävention, Beratung und Hilfe beim Ausstieg aus der Abhängigkeit, wobei sie besonders auf die Lebensphase der Jugend zugeschnitten ist.
Welche Rolle spielt Suchtprävention in Schulen?
Schulen haben einen Bildungsauftrag zur Prävention, um über Gefahren aufzuklären und die Lebenskompetenzen der Schüler zu stärken.
Gibt es Suchtberatung auch online?
Ja, die virtuelle Suchthilfe im Internet ist ein wachsendes Arbeitsfeld, das besonders für technikaffine Heranwachsende einen niederschwelligen Zugang bietet.
Was ist der Unterschied zwischen substanzgebundener und nicht-substanzgebundener Sucht?
Substanzgebunden bezieht sich auf Drogen/Alkohol, während nicht-substanzgebunden Verhaltenssüchte wie Spiel- oder Mediensucht meint.
- Citar trabajo
- Ulla Baumann (Autor), 2011, Suchthilfe für Jugendliche - ein Weg aus der Abhängigkeit?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189420