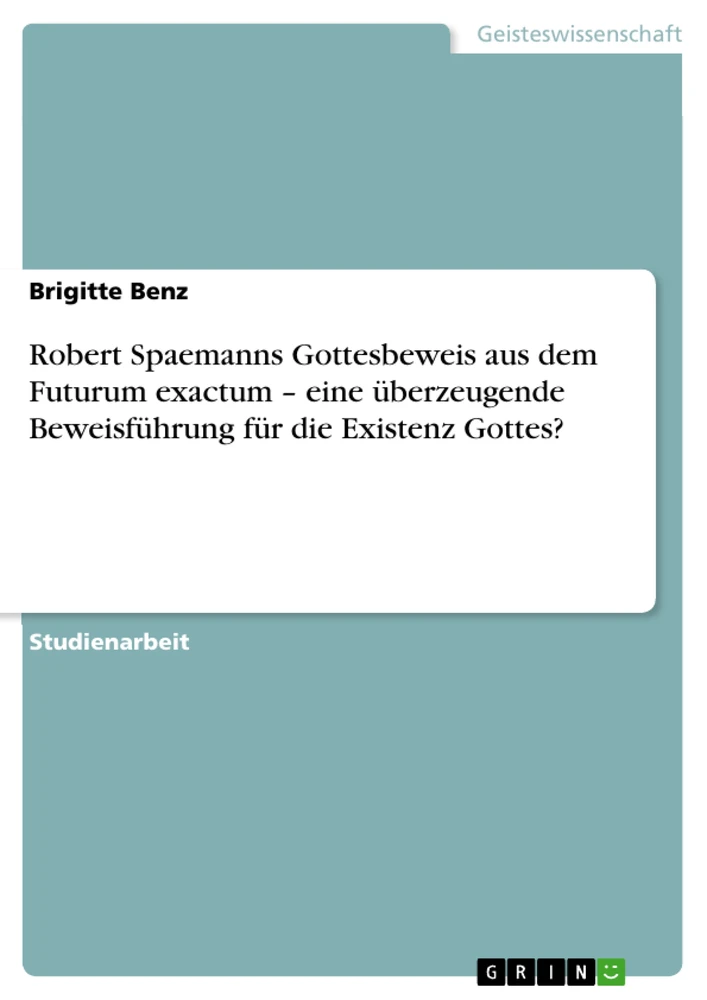Seit die Menschen begannen zu philosophieren, stellten sie die Frage nach dem Urgrund des Seins / der Welt. Dieser Urgrund wurde langsam mit Gott identifiziert und bereits bei den Vorsokratikern, aber auch bei Platon und Aristoteles findet man Ansätze für Gottesbeweise, die später entfaltet wurden. Auch in der Geschichte des Christentums gab es immer wieder Bestrebungen, Gottesbeweise zu formulieren, wobei schon Thomas v. Aquin seine Ausführungen nicht als Beweise, sondern als fünf Wege zu Gott bezeichnete. Einen neuen Versuch, abgeleitet aus der Grammatik – speziell dem Futurum exactum - stellte Robert Spaemann in seinem Vortrag “Die Vernünftigkeit des Glaubens an Gott“ vor, welcher 2007 in Buchform unter dem Titel „Der letzte Gottesbeweis“ erschien.
Die vorliegende Arbeit wird sich mit den Überlegungen Spaemanns auseinandersetzen und dabei vor allem der Frage nachgehen, ob hier eine überzeugende Beweisführung für die Existenz Gottes vorliegt. Dabei wird sich die Kritik vor allem auf die Ausführungen Thomas Buchheims stützen, welcher die bisher einzige ausführliche Auseinandersetzung mit dem spaemannschen Gottesbeweis vorgelegt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Gottesbeweis Robert Spaemanns
- Kritische Auseinandersetzung mit Spaemanns Gottesbeweis
- Was ist ein Gottesbeweis?
- Spaemanns Überlegungen ein Gottesbeweis?
- Das Argument - ein argumentum ad hominem
- Das Argument aus dem Futurum exactum
- Das Argument - nietzsche-resistent?
- Das Gerücht von Gott und die Begründungspflicht
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Robert Spaemanns Gottesbeweis, der auf dem Futurum exactum basiert, und analysiert dessen Überzeugungskraft. Die Arbeit hinterfragt, ob Spaemanns Argumentation eine stichhaltige Beweisführung für die Existenz Gottes darstellt und bezieht dabei kritische Auseinandersetzungen mit ein.
- Analyse von Spaemanns Gottesbeweis und dessen methodischer Grundlage.
- Kritische Bewertung der Argumentationslinie im Hinblick auf ihre Logik und Stringenz.
- Diskussion der Frage nach der Definition und den Anforderungen an einen Gottesbeweis.
- Einordnung des Gottesbeweises in den Kontext philosophischer und theologischer Debatten.
- Bewertung der Nietzsche-Resistenz des Arguments.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Gottesbeweise ein und beschreibt den historischen Kontext, in dem Spaemanns Gottesbeweis zu sehen ist. Sie skizziert den Forschungsansatz der Arbeit, der sich kritisch mit Spaemanns Argument auseinandersetzen und dessen Überzeugungskraft untersuchen wird, wobei die Ausführungen Thomas Buchheims als zentrale Referenz dienen.
Der Gottesbeweis Robert Spaemanns: Dieses Kapitel präsentiert Spaemanns Gottesbeweis, der sich auf die Grammatik, insbesondere das Futurum exactum, stützt. Spaemann argumentiert, dass die Denkbarkeit des Futurum exactums die Existenz eines absoluten Bewusstseins, also Gottes, voraussetzt, da nur Gott alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Wahrheiten erfassen kann. Der Beweis wird als „Nietzsche-resistent“ dargestellt, was impliziert, dass er die Kritik Nietzsches an traditionellen Gottesbeweisen überwindet.
Kritische Auseinandersetzung mit Spaemanns Gottesbeweis: Dieses Kapitel befasst sich kritisch mit Spaemanns Argumentation. Es klärt zunächst den Begriff „Gottesbeweis“ und differenziert zwischen einem Beweis im naturwissenschaftlichen Sinn und der Legitimation des Glaubens durch rationale Argumente. Die Kapitel-Abschnitte analysieren die einzelnen Aspekte von Spaemanns Beweisführung, hinterfragen deren logische Konsequenzen und diskutieren etwaige Schwachstellen. Die Nietzsche-Resistenz des Arguments wird im Detail hinterfragt.
Schlüsselwörter
Gottesbeweis, Robert Spaemann, Futurum exactum, Vernunft, Glaube, Nietzsche, Thomas von Aquin, Existenz Gottes, kritische Analyse, Theologie, Philosophie.
Häufig gestellte Fragen zu Robert Spaemanns Gottesbeweis
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert kritisch Robert Spaemanns Gottesbeweis, der auf dem grammatischen Konzept des Futurum exactums basiert. Sie untersucht die Überzeugungskraft dieses Arguments und bewertet seine methodischen Grundlagen und logischen Konsequenzen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Definition eines Gottesbeweises, die Analyse von Spaemanns Argumentation, die kritische Bewertung der Logik und Stringenz des Arguments, die Einordnung in philosophische und theologische Debatten und die Auseinandersetzung mit der Frage der „Nietzsche-Resistenz“ des Beweises.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Darstellung von Spaemanns Gottesbeweis, ein Kapitel zur kritischen Auseinandersetzung mit diesem Beweis und ein Resümee. Die kritische Auseinandersetzung umfasst eine detaillierte Analyse der einzelnen Argumente Spaemanns.
Was ist Spaemanns Gottesbeweis?
Spaemanns Gottesbeweis basiert auf der Idee, dass die Denkbarkeit des Futurum exactums (der Ausdruck für ein vergangenes zukünftiges Ereignis) die Existenz eines absoluten Bewusstseins, also Gottes, voraussetzt. Nur Gott kann alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Wahrheiten erfassen. Der Beweis wird von Spaemann als „Nietzsche-resistent“ präsentiert.
Welche Kritikpunkte werden an Spaemanns Beweis gerichtet?
Die Arbeit analysiert die logischen Konsequenzen von Spaemanns Argumentation und untersucht mögliche Schwachstellen. Dabei wird die Frage diskutiert, ob Spaemanns Argument tatsächlich einen stichhaltigen Beweis für die Existenz Gottes darstellt und inwieweit es die Kritik Nietzsches an traditionellen Gottesbeweisen tatsächlich überwindet.
Welche Bedeutung hat das Futurum exactum in Spaemanns Argumentation?
Das Futurum exactum dient Spaemann als Ausgangspunkt seiner Argumentation. Er argumentiert, dass die Möglichkeit, über vergangene zukünftige Ereignisse zu sprechen, die Existenz eines Bewusstseins voraussetzt, das alle Zeiten umfasst – ein absolutes Bewusstsein, das er mit Gott identifiziert.
Welche Rolle spielt Nietzsche in dieser Arbeit?
Nietzsche’s Kritik an traditionellen Gottesbeweisen bildet einen wichtigen Hintergrund für die Analyse. Die Arbeit untersucht, ob Spaemanns Argument tatsächlich „Nietzsche-resistent“ ist, also ob es die von Nietzsche erhobenen Einwände widerlegt.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Gottesbeweis, Robert Spaemann, Futurum exactum, Vernunft, Glaube, Nietzsche, Thomas von Aquin, Existenz Gottes, kritische Analyse, Theologie, Philosophie.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich explizit auf Thomas Buchheims Arbeiten als zentrale Referenz, obwohl keine expliziten Zitate im gegebenen Text enthalten sind.
- Citar trabajo
- Brigitte Benz (Autor), 2011, Robert Spaemanns Gottesbeweis aus dem Futurum exactum – eine überzeugende Beweisführung für die Existenz Gottes?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189441