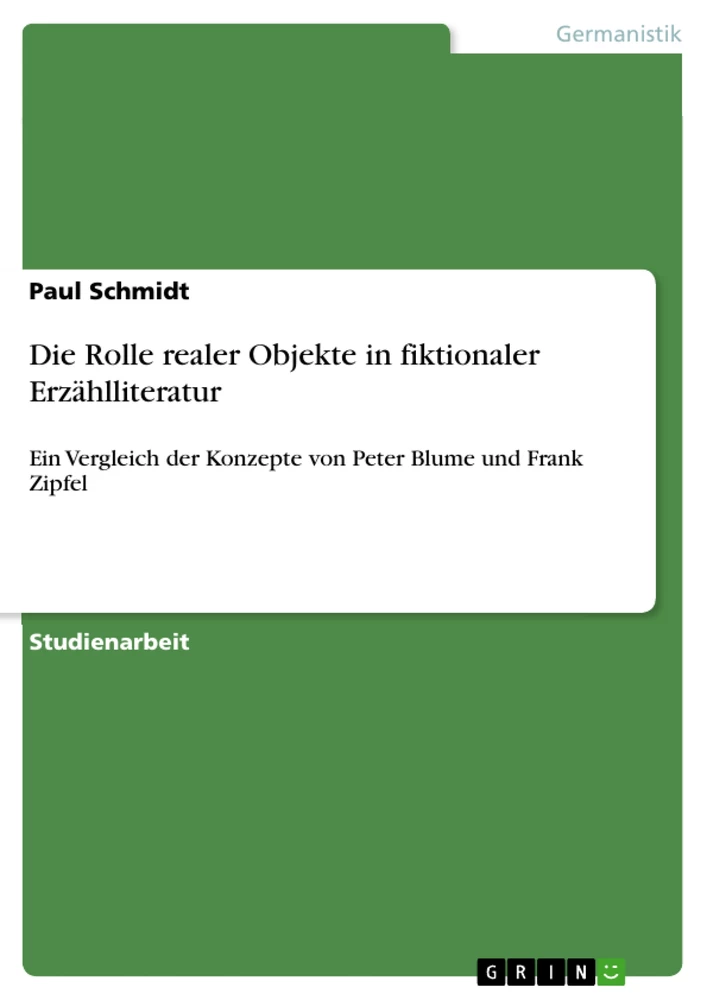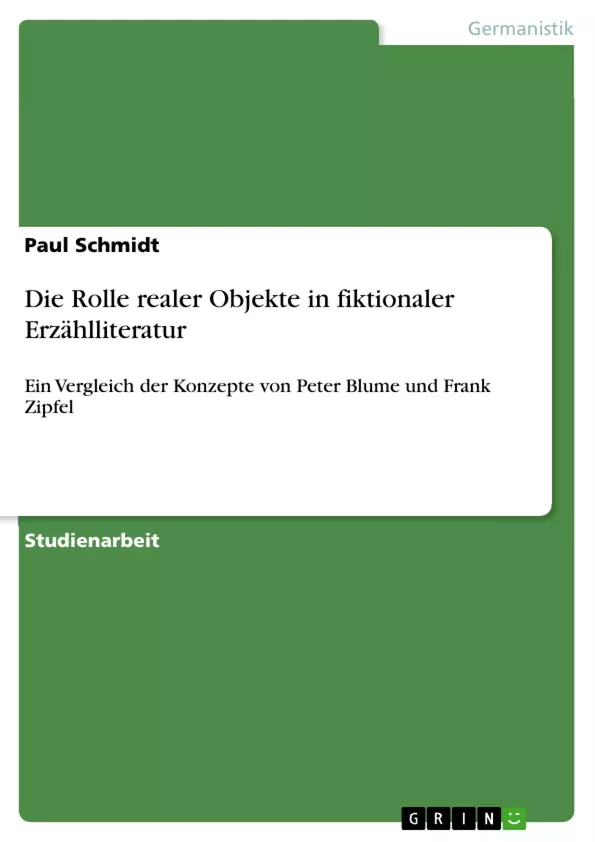Fiktivität und Fiktionalität sind Begriffe, die im literaturwissenschaftlichen Diskurs eine große Rolle spielen und dabei nicht immer trennscharf genutzt werden. Die vorliegende Arbeit klärt nicht nur den Unterschied zwischen ihnen, sondern setzt sich auch mit der Frage auseinander, ob es denkbar ist, fiktionale Geschichten völlig losgelöst von der Wirklichkeit zu produzieren.
Am Beispiel des Romans "Vaterland" von Robert Harris wird die Rolle realer Elemente in fiktionaler Erzählliteratur nachgezogen. Dabei wird unter Bezugnahme der Konzepte Peter Blumes und Frank Zipfels die Frage beantwortet, ob es sich beispielsweise bei in literarischen Texten beschrieben Orten um faktuale Gegebenheiten innerhalb eines fiktionalen Textes handelt oder ob diese losgelöst von ihren jeweiligen Referenzen zu betrachten sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Klärung zentraler Begriffe
- 2.1 Das Begriffspaar „fiktional - fiktiv“
- 2.2 Nicht-fiktionale Elemente
- 3. Peter Blume – Nicht-fiktionale Konzepte in fiktionaler Erzählliteratur
- 3.1 Panfiktionalismus
- 3.2 Autonomismus
- 3.3 Kompositionalismus
- 4. Frank Zipfel – Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität
- 4.1 Wirklichkeit in verschiedenen Welt-Versionen
- 4.2 Ereignisträger, Ort und Zeit als Bestandteile fiktiver Geschichten
- 4.3 Reale Entitäten in fiktiven Geschichten
- 4.4 Pseudo-reale Entitäten in fiktiven Geschichten
- 5. Schlussbetrachtung
- 6. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle realer Objekte in fiktionaler Erzählliteratur, indem sie die Konzepte von Peter Blume und Frank Zipfel vergleicht. Der Fokus liegt auf der Frage, wie sich in fiktionalen Texten auftretende Objekte (Personen, Orte, Gegenstände etc.) auf möglicherweise vorhandene reale Entsprechungen beziehen. Es wird analysiert, ob und unter welchen Bedingungen eine Loslösung von der Realität stattfinden kann.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „fiktional“ und „fiktiv“
- Analyse nicht-fiktionaler Elemente in fiktionalen Texten
- Vergleich der Konzepte von Peter Blume und Frank Zipfel zur Fiktionalität
- Untersuchung der Beziehung zwischen fiktionaler Welt und Realität anhand von Beispielen
- Anwendung der theoretischen Konzepte auf den Roman „Vaterland“ von Robert Harris
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Rolle realer Objekte in fiktionaler Literatur ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Fiktionalität und Realität. Sie benennt die Notwendigkeit, die Begriffe „fiktional“ und „fiktiv“ zu definieren und untersucht, ob Autor*innen und Leser*innen fiktionale Geschichten vollkommen losgelöst von der Wirklichkeit produzieren und rezipieren können. Die Arbeit fokussiert auf die Untersuchung nicht-fiktionaler Entitäten in fiktiven Texten und kündigt den Vergleich der Konzepte von Peter Blume und Frank Zipfel an, wobei der Roman „Vaterland“ von Robert Harris als Beispiel dient. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage, ob der fiktive Odilo Lotario Globocnik und das fiktive Berlin im Roman als reale Objekte in einer fiktiven Geschichte betrachtet werden können.
2. Klärung zentraler Begriffe: Dieses Kapitel liefert Arbeitsdefinitionen für die zentralen Begriffe „fiktional“ und „fiktiv“. Es wird Bezug genommen auf Lutz Rühling, der „fiktional“ der Art der Darstellung und „fiktiv“ dem Status des Dargestellten zuordnet. Die Arbeit merkt an, dass eine konsequente Trennung in der Fachliteratur oft fehlt. Der Begriff „fiktiv“ wird als „nur angenommen, erdacht“ definiert. Fiktive Objekte können wahre Aussagen enthalten, jedoch nur im Kontext ihrer fiktiven Welt. Fiktionalität hingegen wird als Eigenschaft literarischer Texte beschrieben, die einen scheinbaren Widerspruch zwischen Behauptung und Wirklichkeit aufweisen. Autor*innen unterscheiden sich von Lügnern durch den Verzicht auf Täuschungsabsicht, da sie Geschichten in einer imaginären Welt präsentieren. Fiktionssignale helfen den Leser*innen bei der Unterscheidung von fiktionaler und faktualer Rezeption.
3. Peter Blume – Nicht-fiktionale Konzepte in fiktionaler Erzählliteratur: Dieses Kapitel präsentiert die nicht-fiktionalen Konzepte von Peter Blume im Kontext fiktionaler Erzähliteratur. Es würde eine detaillierte Auseinandersetzung mit Bluemes Panfiktionalismus, Autonomismus und Kompositionalismus beinhalten, inklusive einer Analyse, wie diese Konzepte die Beziehung zwischen fiktionalen Welten und der Realität erklären. Der Fokus läge auf der Interpretation von Bluemes Ansätzen und ihrer Anwendung auf die Analyse literarischer Texte, um die Integration nicht-fiktionaler Elemente zu verstehen.
4. Frank Zipfel – Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität: Dieses Kapitel behandelt die Theorien von Frank Zipfel zur Fiktion, Fiktivität und Fiktionalität. Es würde Zipfels Ansichten zur Wirklichkeit in verschiedenen Weltversionen, zur Rolle von Ereignisträgern, Orten und Zeiten in fiktiven Geschichten, und zur Behandlung realer und pseudo-realer Entitäten in fiktiven Erzählungen umfassend darstellen. Die Analyse würde Zipfels Methode zur Unterscheidung verschiedener Ebenen der Realität in fiktionalen Texten untersuchen und deren Relevanz für das Verständnis der Rolle realer Objekte beleuchten.
Schlüsselwörter
Fiktionalität, Fiktivität, reale Objekte, fiktive Geschichten, Peter Blume, Frank Zipfel, Robert Harris, Vaterland, Nicht-fiktionale Elemente, kontrafaktische Geschichte, Wirklichkeitsbezug, Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Rolle realer Objekte in fiktionaler Erzählliteratur
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle realer Objekte in fiktionaler Erzählliteratur. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis zwischen fiktionalen Texten und der Realität, insbesondere darauf, wie sich in fiktionalen Texten auftretende Objekte (Personen, Orte, Gegenstände etc.) auf möglicherweise vorhandene reale Entsprechungen beziehen und ob und unter welchen Bedingungen eine Loslösung von der Realität stattfinden kann.
Welche theoretischen Konzepte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Konzepte von Peter Blume (Panfiktionalismus, Autonomismus, Kompositionalismus) und Frank Zipfel (Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität) zur Analyse der Beziehung zwischen fiktionaler Welt und Realität. Dabei werden die Ansätze beider Autoren auf die Frage angewendet, wie reale Objekte in fiktiven Geschichten behandelt werden.
Wie werden die Begriffe „fiktional“ und „fiktiv“ definiert?
Die Arbeit bezieht sich auf Lutz Rühling, der „fiktional“ der Art der Darstellung und „fiktiv“ dem Status des Dargestellten zuordnet. „Fiktiv“ wird als „nur angenommen, erdacht“ definiert. Fiktive Objekte können wahre Aussagen enthalten, jedoch nur im Kontext ihrer fiktiven Welt. Fiktionalität wird als Eigenschaft literarischer Texte beschrieben, die einen scheinbaren Widerspruch zwischen Behauptung und Wirklichkeit aufweisen.
Welche Rolle spielt der Roman „Vaterland“ von Robert Harris?
Der Roman „Vaterland“ von Robert Harris dient als Beispieltext zur Anwendung der theoretischen Konzepte. Die Arbeit untersucht, ob der fiktive Odilo Lotario Globocnik und das fiktive Berlin im Roman als reale Objekte in einer fiktiven Geschichte betrachtet werden können.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Klärung zentraler Begriffe, Peter Blume – Nicht-fiktionale Konzepte in fiktionaler Erzählliteratur, Frank Zipfel – Fiktion, Fiktivität, Fiktionalität, Schlussbetrachtung und Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel analysiert einen Aspekt der Beziehung zwischen Realität und Fiktion in Literatur, von der Definition zentraler Begriffe bis hin zur Anwendung theoretischer Konzepte auf einen konkreten Fall.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie verhalten sich reale Objekte zu fiktiven Geschichten? Die Arbeit untersucht, ob und wie eine vollständige Loslösung von der Realität in fiktionalen Texten möglich ist und analysiert die verschiedenen theoretischen Ansätze, um diese Frage zu beantworten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fiktionalität, Fiktivität, reale Objekte, fiktive Geschichten, Peter Blume, Frank Zipfel, Robert Harris, Vaterland, Nicht-fiktionale Elemente, kontrafaktische Geschichte, Wirklichkeitsbezug, Literaturwissenschaft.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle realer Objekte in fiktionaler Erzählliteratur zu untersuchen, indem sie die Konzepte von Peter Blume und Frank Zipfel vergleicht. Sie analysiert, wie sich in fiktionalen Texten auftretende Objekte auf möglicherweise vorhandene reale Entsprechungen beziehen und ob und unter welchen Bedingungen eine Loslösung von der Realität stattfinden kann.
- Quote paper
- Paul Schmidt (Author), 2010, Die Rolle realer Objekte in fiktionaler Erzählliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189528