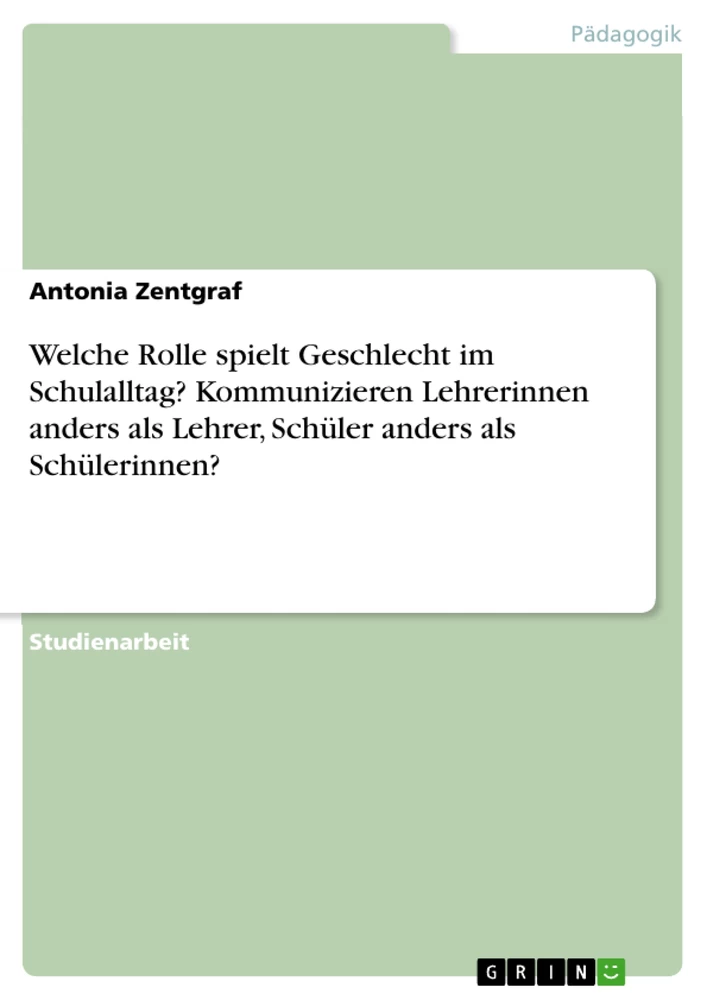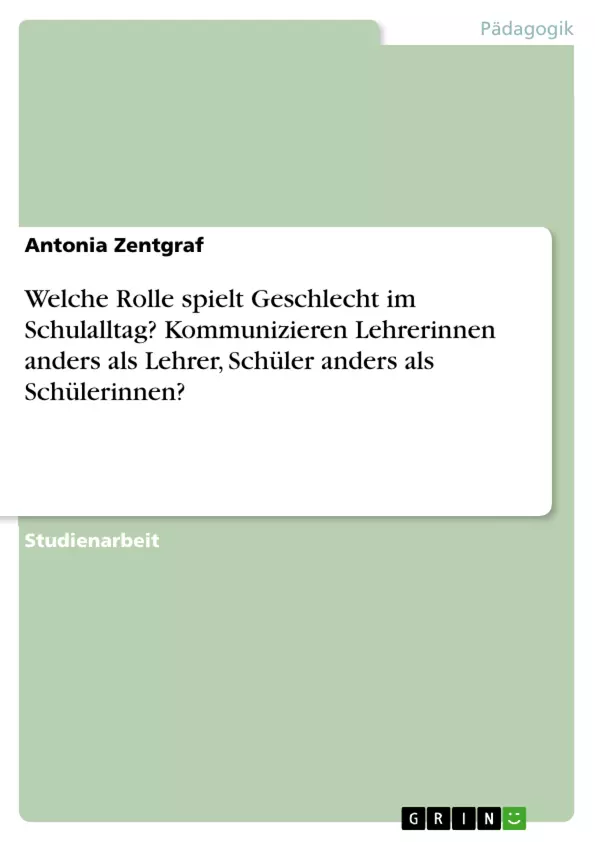Der Schulalltag von Schülerinnen und Schülern wird von den vielfältigsten soziologischen Aspekten begleitet – so durchläuft beispielsweise jeder Schüler und jede Schülerin einen Sozialisationsprozess, welcher durch die Institution Schule maßgeblich geprägt werden kann. Des Weiteren sind dort unter anderem soziale Gebilde vorzufinden - sogenannte Figurationen wie Peergroups oder Cliquen. In der vorliegenden Ausarbeitung soll nun dargestellt werden, welche Rolle das Geschlecht von Schülerinnen und Schülern ebenso wie das des Lehrpersonals im Schulalltag spielt. Im Rahmen dieser Frage ist es vonnöten, vorweg zu klären, ob Geschlecht überhaupt in der Schule konstruiert und thematisiert wird. Birgt eine bewusste Thematisierung und damit Dramatisierung von Geschlecht Gefahren? Können Lehrerinnen und Lehrer etwas dagegen unternehmen? In zwei weiteren Punkten wird darauf eingegangen, inwiefern es männliche und weibliche Interaktionsmuster gibt und ob speziell das Geschlecht des Lehrpersonals Einfluss auf den Schulerfolg der SuS (im Folgenden steht SuS als Abkürzung für Schülerinnen und Schüler) nimmt. Des Weiteren wird anhand dessen im Fazit versucht, folgende Fragen zu beantworten: Kommunizieren Lehrerinnen anders als Lehrer, Schüler anders als Schülerinnen? Welche Schlussfolgerungen lassen sich insgesamt für die Schule ziehen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschlecht in der Schule
- 2.1. Thematisierung von Geschlecht im Schulalltag
- 2.2. Die Gefahr der Dramatisierung von Geschlecht
- 3. „Männliche“ und „weibliche“ Interaktionsmuster
- 4. Einfluss des Geschlechts des Lehrpersonals auf Schulerfolg
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Rolle des Geschlechts im Schulalltag. Sie untersucht, wie Geschlecht in der Schule konstruiert und thematisiert wird, ob eine bewusste Thematisierung von Geschlecht Gefahren birgt und wie Lehrkräfte damit umgehen können. Darüber hinaus beleuchtet die Ausarbeitung, ob es männliche und weibliche Interaktionsmuster gibt und ob das Geschlecht des Lehrpersonals den Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern beeinflusst.
- Thematisierung von Geschlecht im Schulalltag und die Konstruktion von Geschlechterrollen
- Die Gefahren der Dramatisierung von Geschlecht und die Bedeutung der Entdramatisierung
- Männliche und weibliche Interaktionsmuster im Schulkontext
- Der Einfluss des Geschlechts des Lehrpersonals auf den Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern
- Kommunikationsunterschiede zwischen Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage der Arbeit vor: Welche Rolle spielt Geschlecht im Schulalltag? Sie verdeutlicht, dass die institutionelle Schule einen maßgeblichen Einfluss auf den Sozialisationsprozess von Schülerinnen und Schülern hat. Die Arbeit befasst sich mit der Konstruktion von Geschlecht im Schulalltag, möglichen Gefahren einer bewussten Thematisierung und der Rolle von Lehrkräften in diesem Kontext.
2. Geschlecht in der Schule
Dieser Abschnitt erläutert, wie das sozial konstruierte Geschlecht (gender) in der Schule thematisiert und an welchen Stellen es eher im Hintergrund bleibt oder entdramatisiert wird. Dazu wird auf den Ansatz des "doing gender" von Jürgen Budde eingegangen.
2.1. Thematisierung von Geschlecht im Schulalltag
Das Konzept des "doing gender" beschreibt, wie Menschen durch Interaktionen ihr soziales Geschlecht konstruieren und darstellen. Dieses soziale Geschlecht wird durch bestimmte Verhaltensweisen und Interaktionen sichtbar gemacht und von anderen Personen erkannt. Die Arbeit untersucht, wie sich diese Mechanismen im Schulalltag manifestieren und welche Folgen sie für die Wahrnehmung von Schülerinnen und Schülern haben können.
2.2. Die Gefahr der Dramatisierung von Geschlecht
Dieser Abschnitt beleuchtet die Gefahren einer bewussten Thematisierung von Geschlecht im Schulalltag. Oftmals wird die Konstruktion von Geschlechtergerechtigkeit durch eine Zweigeschlechtlichkeit geprägt, was zu einer künstlichen Trennung von Mädchen und Jungen führen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Geschlechterkonstruktionen, "doing gender", Dramatisierung und Entdramatisierung von Geschlecht, männliche und weibliche Interaktionsmuster, Einfluss des Geschlechts des Lehrpersonals auf den Schulerfolg sowie Kommunikationsunterschiede zwischen Lehrerinnen und Lehrern, sowie Schülerinnen und Schülern. Sie beleuchtet die Rolle der Institution Schule im Sozialisationsprozess von Schülerinnen und Schülern und analysiert die Implikationen von Geschlechterrollen für den Schulalltag.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Geschlecht im Schulalltag konstruiert?
Geschlecht wird durch den Prozess des „doing gender“ in täglichen Interaktionen zwischen Schülern und Lehrkräften ständig neu hergestellt.
Was ist die Gefahr der Dramatisierung von Geschlecht?
Eine bewusste Thematisierung kann zu einer künstlichen Trennung und Stereotypisierung von Mädchen und Jungen führen, statt echte Chancengerechtigkeit zu fördern.
Beeinflusst das Geschlecht der Lehrkraft den Schulerfolg?
Die Arbeit untersucht, ob Schülerinnen und Schüler bei Lehrkräften des eigenen Geschlechts erfolgreicher sind oder ob andere Faktoren überwiegen.
Gibt es typisch männliche oder weibliche Interaktionsmuster?
Ja, Studien deuten auf unterschiedliche Kommunikationsstile hin, die sich in Peergroups und im Unterricht manifestieren können.
Was können Lehrer tun, um Geschlechterrollen zu entdramatisieren?
Lehrkräfte können durch bewusste Reflexion ihres eigenen Verhaltens und die Vermeidung von geschlechtsspezifischen Zuschreibungen zur Entdramatisierung beitragen.
- Quote paper
- Antonia Zentgraf (Author), 2012, Welche Rolle spielt Geschlecht im Schulalltag? Kommunizieren Lehrerinnen anders als Lehrer, Schüler anders als Schülerinnen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189566