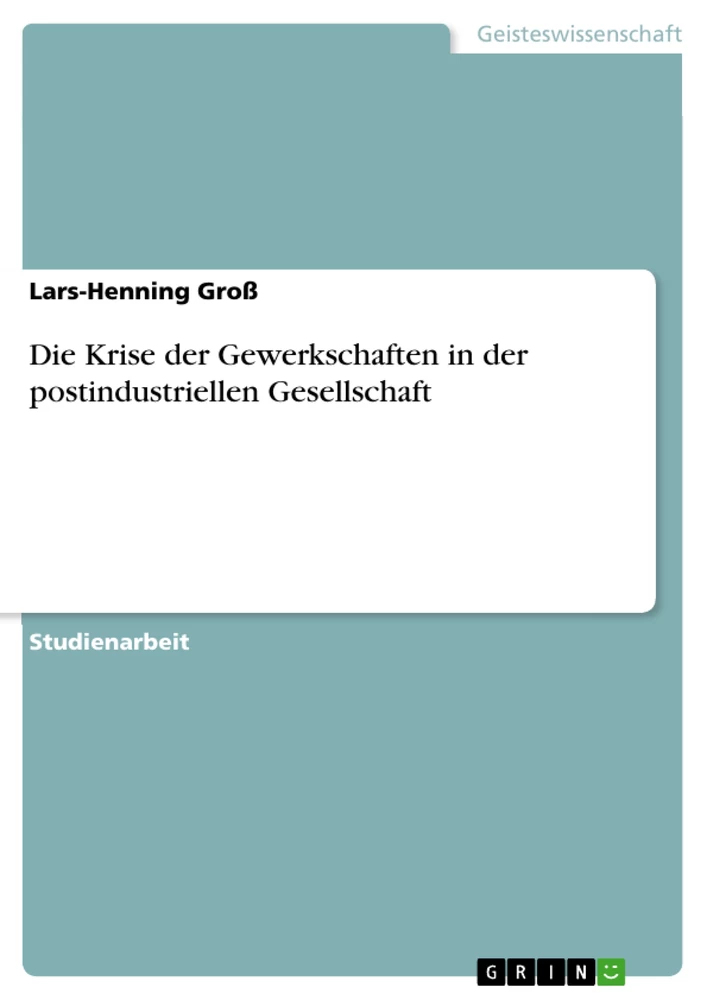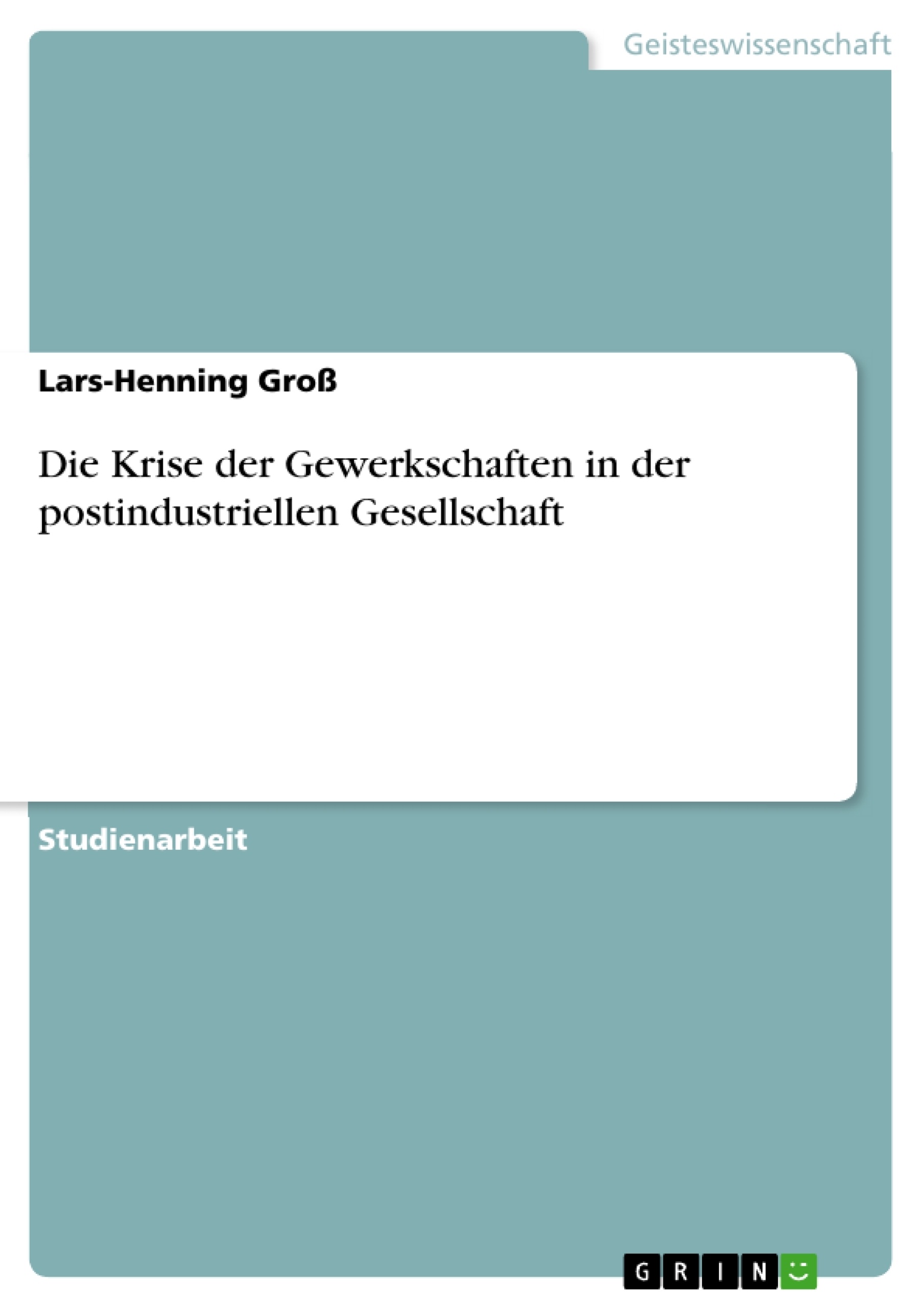Die Frage, die mich in dieser Arbeit beschäftigen wird ist die, in welchem Verhältnis die Gewerkschaften in dieser Wissensgesellschafft zum Faktor "Arbeit" stehen. Sind die Gewerkschaften nach wie vor der wichtige Akteur im Spannungsfeld zwischen "Arbeit" und "Kapital" oder sind die auferlegten Ansprüche der Gewerkschaften, also Wohlstand und soziale Sicherheit für die Arbeitenden, haltbar oder sind sie längst über Bord gegangen?
Die These der vorliegenden Argumentation ist die, dass die Gewerkschaften als sozialer Akteur die gravierende Dynamisierung und strukturelle Wandlung der globalisierten Gesellschaft nicht mitvollzogen haben, bzw. dies nicht konnten. Daraus ergeben sich eine Reihe Schwierigkeiten für die Gewerkschaften im Hinblick auf die industriellen Beziehungen. Aus diesen Schwierigkeiten folgt, dass die Gewerkschaften in einer (Legitimations-)Krise stecken.
Zunächst ist einmal zu klären, auf welchen Kernelementen die gewerkschaftliche Tätigkeit beruht. Hier möchte ich mich mit vier Punkten beschäftigen, nämlich dem Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital und der Repräsentation der Arbeitnehmer durch die Gewerkschaften.
Desweiteren möchte ich mir das Normalarbeitsverhältnis als eine wichtige Errungenschaft und Element der Gewerkschaften, sowie dessen Erosion ab den 1980er Jahren anschauen. Was ist unter dem Begriff des Normalarbeitsverhältnisses zu verstehen, welcher im Grunde durch die gewerkschaftliche Tätigkeit geprägt wurde? Dieser Begriff versucht den Zustand des Arbeitsverhältnisses und der industriellen Beziehungen zu beschreiben, wie sie sich in der Mitte des 20. Jhd. dargestellt haben. Da dieser Zustand im 21. Jhd. allerdings ein anderer ist, ist auch der Begriff des Normalarbeitsverhältnisses nicht mehr treffend. Wir finden in der Wissensgesellschaft Arbeitsformen, die nicht mehr mit diesem Begriff fassbar sind, da sie eben nicht mehr "normal" sind. Also geht es im zweiten Schritt um die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses.
Daran anschließend gilt es zu untersuchen, welche Lösungswege für die Krise der Gewerkschaften zu sehen sind. Wird die strukturelle Anpassungslücke zwischen globalisierter Wirtschaft und gewerkschaftlicher Interessenvertretung überbrückt werden können oder müssen die Gewerkschaften ihren Selbstanspruch hinterfragen oder vielleicht sogar aufgeben? An dieser Stelle ist besonders das Konzept "Auto-5000" des Volkswagen-Konzerns, als Innovationsversuch, interessant.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemaufriss und Aufbau dieser Arbeit
- 2 Die Gewerkschaften in der Krise
- 2.1 Grundlegende Elemente gewerkschaftlicher Organisationsfähigkeit
- 2.2 Bestimmungsfaktoren für das NAV und die Erosion des NAV
- 2.3 Der Wegfall eines konkreten Arbeitsplatzes
- 2.4 Die Auflösung der Trennung von Arbeit und Kapital
- 2.5 Die schwindende Repräsentation der Arbeitnehmer durch die Gewerkschaften
- 3 AUTO 5000 als Modellversuch. Wie sollten Konzepte zur Neuorientierung der Gewerkschaften in der post-industriellen Gesellschaft aussehen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Krise der Gewerkschaften im Kontext der postindustriellen Gesellschaft. Sie analysiert die Herausforderungen, denen Gewerkschaften angesichts der Globalisierung, der Flexibilisierung der Arbeitswelt und des Wandels hin zu einer Wissensgesellschaft gegenüberstehen.
- Erosion des Normalarbeitsverhältnisses (NAV)
- Veränderung des Verhältnisses von Arbeit und Kapital
- Schwindende Repräsentationsfähigkeit der Gewerkschaften
- Die Rolle des Faktors "Wissen" in der ökonomischen Entwicklung
- Modelle zur Neuorientierung der Gewerkschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt den Problemaufriss der Arbeit dar und skizziert den Aufbau. Es werden die Veränderungen der Produktionsweise und der Arbeitswelt seit den 1970er Jahren beleuchtet und die Rolle der Gewerkschaften im Spannungsfeld zwischen "Arbeit" und "Kapital" erläutert. Kapitel 2 widmet sich der Krise der Gewerkschaften. Es werden die Grundelemente gewerkschaftlicher Organisationsfähigkeit analysiert sowie die Erosion des NAV und die Ursachen dafür untersucht. Kapitel 3 beleuchtet das Konzept "Auto 5000" als Beispiel für einen Innovationsversuch in der gewerkschaftlichen Arbeit und diskutiert mögliche Lösungswege für die Krise der Gewerkschaften in der postindustriellen Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Gewerkschaften, Krise, postindustrielle Gesellschaft, Normalarbeitsverhältnis, Erosion, Wissensgesellschaft, Globalisierung, Flexibilisierung, Arbeit, Kapital, Repräsentation, Auto 5000, Neuorientierung.
Häufig gestellte Fragen
Warum stecken Gewerkschaften in der postindustriellen Gesellschaft in einer Krise?
Gewerkschaften haben Schwierigkeiten, sich an die Dynamik der Globalisierung und den Wandel zur Wissensgesellschaft anzupassen, was zu einer Legitimationskrise führt.
Was versteht man unter der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses?
Es beschreibt den Rückgang unbefristeter, sozialversicherter Vollzeitstellen zugunsten flexiblerer, aber oft prekärer Arbeitsformen in der Wissensgesellschaft.
Wie verändert die Wissensgesellschaft die Rolle der Gewerkschaften?
In der Wissensgesellschaft lösen sich klassische Trennungen zwischen Arbeit und Kapital auf, was die traditionelle gewerkschaftliche Interessenvertretung erschwert.
Was war das Modellprojekt „Auto 5000“ bei Volkswagen?
Es war ein Innovationsversuch zur Neuorientierung der industriellen Beziehungen, der neue Arbeitszeitmodelle und Entlohnungsstrukturen erprobte.
Warum schwindet die Repräsentationsfähigkeit der Gewerkschaften?
Die zunehmende Individualisierung der Arbeitnehmer und der Wegfall klassischer Großbetriebe erschweren die kollektive Organisation und Repräsentation.
Können Gewerkschaften die Anpassungslücke zur globalisierten Wirtschaft schließen?
Die Arbeit diskutiert, ob Gewerkschaften ihren Selbstanspruch radikal hinterfragen müssen, um als soziale Akteure relevant zu bleiben.
- Citar trabajo
- Lars-Henning Groß (Autor), 2011, Die Krise der Gewerkschaften in der postindustriellen Gesellschaft, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189592