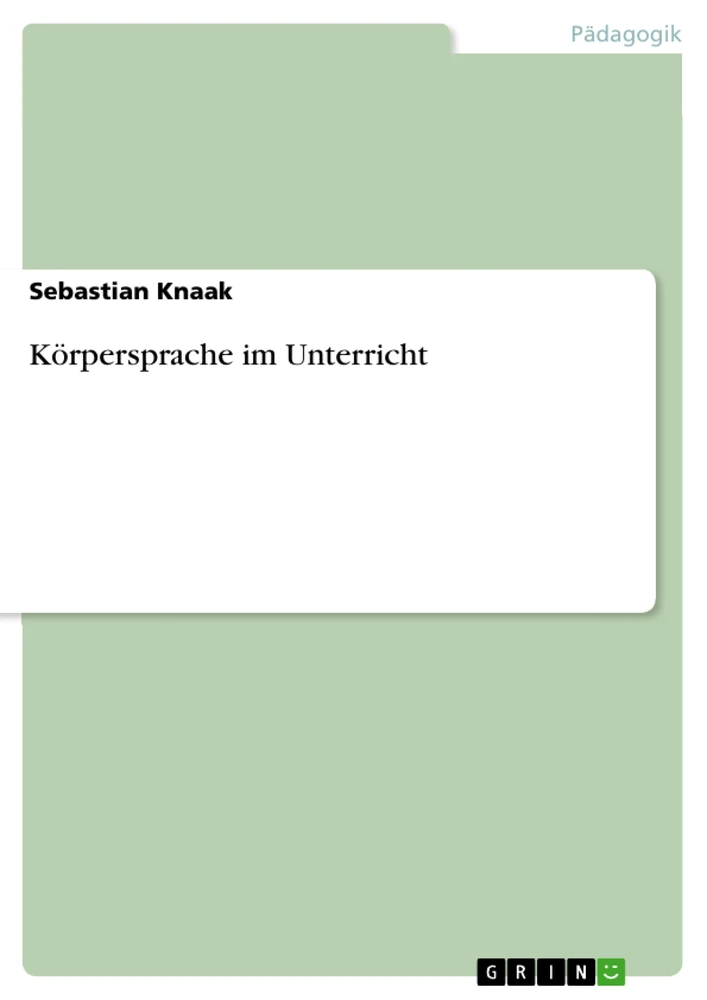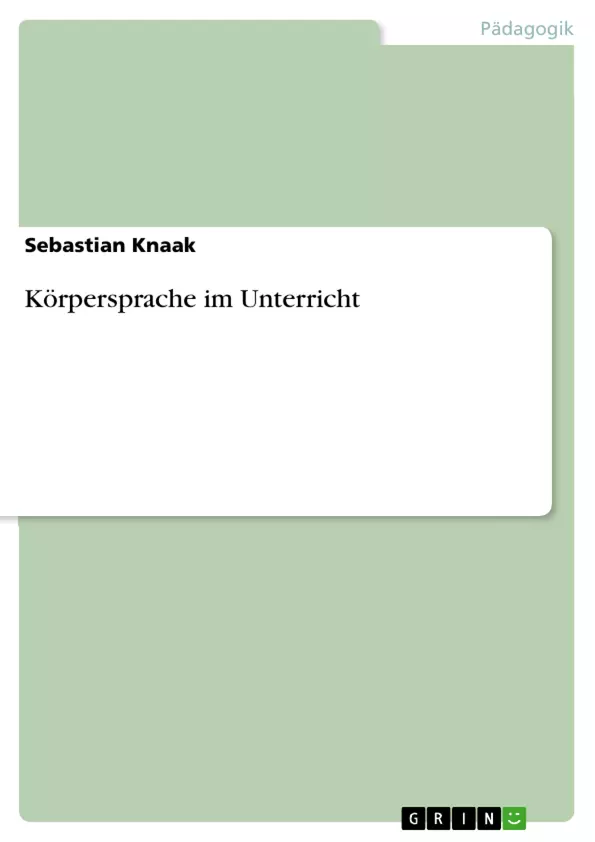Der in die USA ausgewanderte und in Österreich geborene Psychologe Paul Watzlawick stellt zusammen mit seinen Mitautoren Beavin und Jackson fünf Axiome zur menschlichen Kommunikation auf. Eines dieser Axiome lautet: „Man kann nicht nicht kommunizieren“. Anhand dieses ersten Axioms zur menschlichen Kommunikation wird schnell deutlich, dass Kommunikation eben nicht immer nur mit Sprache verbunden ist, vielmehr ist die Sprache lediglich ein Teil der zur Kommunikation beiträgt. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der zur Kommunikation beiträgt, sind die Gestik und Mimik der kommunizierenden Individuen. In der nun folgenden Ausarbeitung möchte ich genauer auf eben diese Gestik und Mimik, die auch als Körpersprache bezeichnet werden kann, genauer eingehen. Meinen Schwerpunkt möchte ich dabei auf die Körpersprache von Lehrern im Unterrichtsgeschehen setzen. Ich werde damit beginnen einige grundlegende Begrifflichkeiten zu klären um im späteren Verlauf präziser auf eine zu bevorzugende Art der Körpersprache im Unterricht einzugehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definition Kommunikation
- 2.1 Verbale Kommunikation
- 2.2 Nonverbale Kommunikation
- 2.3 Paraverbale Kommunikation
- 3 Nonverbales Verhalten des Pädagogen gegenüber der Klasse
- 3.1 Der Blickkontakt
- 3.2 Die Körperstellung vor der Klasse
- 3.3 Das proxemische Verhalten
- 3.4 Die Körperhaltung
- 3.5 Die Gestik und Mimik
- 3.6 Die Sicherheit
- 3.6.1 Selbstbejahung
- 3.6.2 Phasen der Entspannung
- 3.6.3 Einsatz von Hilfsmitteln
- 3.6.4 Lampenfieber positiv sehen
- 3.7 Die Kleidung und das äußere Erscheinungsbild
- 4 Dominanz durch Drohung?
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung untersucht die Bedeutung nonverbaler Kommunikation, insbesondere der Körpersprache, im Unterricht. Der Fokus liegt auf dem Verhalten von Lehrkräften und wie ihre Körpersprache die Aufmerksamkeit der Schüler beeinflusst und das Klassenklima prägt. Die Arbeit analysiert verschiedene Aspekte nonverbaler Kommunikation und deren Auswirkungen auf den Lernerfolg.
- Bedeutung nonverbaler Kommunikation im pädagogischen Kontext
- Einfluss der Körpersprache des Lehrers auf die Schüler
- Analyse verschiedener Komponenten nonverbaler Kommunikation (Blickkontakt, Körpersprache, Gestik etc.)
- Der Aufbau einer positiven Lernatmosphäre durch bewusste Körpersprache
- Mögliche negative Auswirkungen von unangemessener nonverbaler Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der nonverbalen Kommunikation ein und verweist auf das Axiom von Watzlawick "Man kann nicht nicht kommunizieren". Sie begründet die Relevanz der Körpersprache im Unterricht und kündigt den Fokus auf die Körpersprache von Lehrern an. Die Arbeit zielt darauf ab, grundlegende Begrifflichkeiten zu klären und im weiteren Verlauf eine zu bevorzugende Art der Körpersprache im Unterricht zu beleuchten.
2 Definition Kommunikation: Dieses Kapitel definiert Kommunikation als Verständigungsprozess und differenziert zwischen verbaler, nonverbaler und paraverbaler Kommunikation. Es beschreibt die verbale Kommunikation als die Kommunikation mittels Worten, die nonverbale Kommunikation als die Sprache des Körpers (Mimik, Gestik und Haltung) und die paraverbale Kommunikation als die Kommunikation durch sprachbegleitende Merkmale wie Betonung, Tonhöhe etc. Diese differenzierte Betrachtungsweise legt den Grundstein für die detaillierte Analyse der nonverbalen Kommunikation im weiteren Verlauf der Arbeit.
3 Nonverbales Verhalten des Pädagogen gegenüber der Klasse: Dieses Kapitel behandelt die Herausforderungen, vor denen Pädagogen stehen, um die Aufmerksamkeit ihrer Schüler zu gewinnen und eine positive Lernatmosphäre zu schaffen. Es wird der Einfluss verschiedener Aspekte der nonverbaler Kommunikation, wie Blickkontakt, Körperstellung, proxemisches Verhalten, Körperhaltung, Gestik und Mimik, sowie Kleidung und äußeres Erscheinungsbild, auf das Klassenklima und die Schüler-Lehrer-Interaktion untersucht. Es werden Strategien und Hinweise zur Anwendung einer positiven, effektiven Körpersprache im Unterricht gegeben, um Missverständnisse und negative Auswirkungen zu vermeiden. Der Fokus liegt auf der subtilen und bewussten Nutzung nonverbaler Signale zur Förderung des Lernprozesses.
Schlüsselwörter
Nonverbale Kommunikation, Körpersprache, Lehrerverhalten, Unterricht, Klassenklima, Blickkontakt, Gestik, Mimik, Kommunikationstheorien, Pädagogik, Lernatmosphäre.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Nonverbale Kommunikation im Unterricht"
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung nonverbaler Kommunikation, insbesondere der Körpersprache von Lehrkräften, im Unterricht und deren Einfluss auf die Aufmerksamkeit der Schüler und das Klassenklima. Es wird analysiert, wie verschiedene Aspekte nonverbaler Kommunikation den Lernerfolg beeinflussen.
Welche Arten von Kommunikation werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen verbaler Kommunikation (mit Worten), nonverbaler Kommunikation (Körpersprache, Mimik, Gestik, Haltung) und paraverbaler Kommunikation (sprachbegleitende Merkmale wie Betonung, Tonhöhe).
Welche Aspekte nonverbalen Verhaltens von Lehrkräften werden analysiert?
Die Analyse umfasst Blickkontakt, Körperstellung, proxemisches Verhalten (räumliche Distanz), Körperhaltung, Gestik und Mimik, sowie Kleidung und äußeres Erscheinungsbild. Es wird untersucht, wie diese Aspekte das Klassenklima und die Schüler-Lehrer-Interaktion beeinflussen.
Wie wird die Bedeutung nonverbaler Kommunikation im pädagogischen Kontext dargestellt?
Die Arbeit betont die Relevanz nonverbaler Kommunikation im Unterricht, ausgehend vom Axiom von Watzlawick "Man kann nicht nicht kommunizieren". Sie zeigt auf, wie bewusste und angemessene Körpersprache eine positive Lernatmosphäre fördert und Missverständnisse vermeidet.
Welche Strategien werden zur Anwendung einer positiven Körpersprache im Unterricht vorgeschlagen?
Die Arbeit gibt Hinweise und Strategien zur effektiven Nutzung nonverbaler Signale im Unterricht, um den Lernprozess zu fördern. Dies beinhaltet Aspekte wie Selbstbejahung, Entspannungstechniken und den positiven Umgang mit Lampenfieber.
Welche negativen Auswirkungen unangemessener nonverbaler Kommunikation werden thematisiert?
Die Arbeit beleuchtet mögliche negative Auswirkungen unangemessener nonverbaler Kommunikation auf das Klassenklima und die Schüler-Lehrer-Beziehung. Sie verdeutlicht die Wichtigkeit einer bewussten und positiven Körpersprache.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nonverbale Kommunikation, Körpersprache, Lehrerverhalten, Unterricht, Klassenklima, Blickkontakt, Gestik, Mimik, Kommunikationstheorien, Pädagogik, Lernatmosphäre.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Kommunikation (mit Unterkapiteln zu verbaler, nonverbaler und paraverbaler Kommunikation), ein Kapitel zum nonverbalen Verhalten von Pädagogen (mit detaillierter Analyse verschiedener Aspekte), ein Kapitel zu möglicher Dominanz durch Drohung und ein Fazit.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Knaak (Autor:in), 2012, Körpersprache im Unterricht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189595