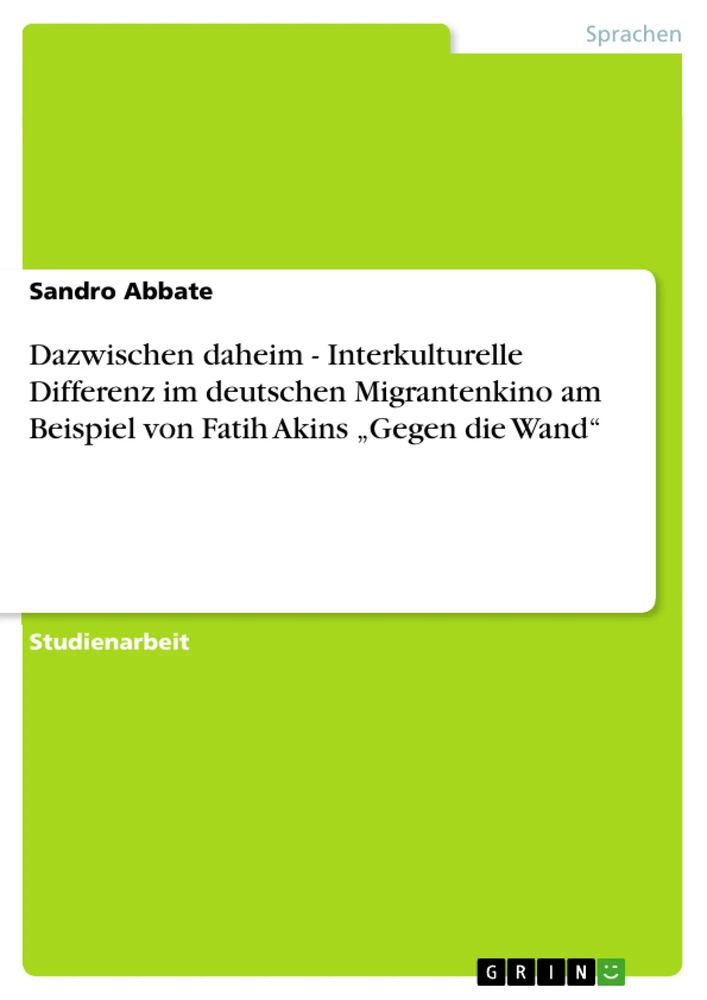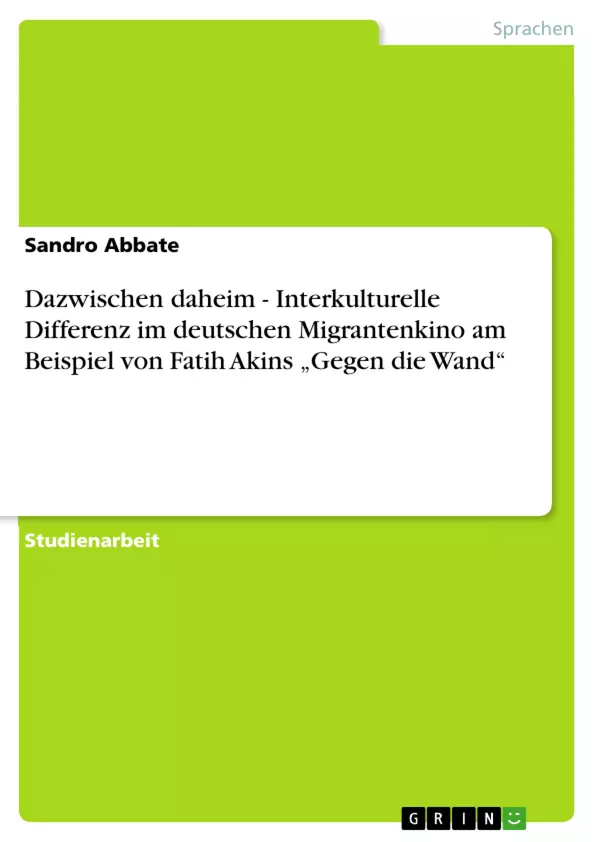Es war 1961, als die Bundesrepublik Deutschland beschloss, auch türkische Arbeitskräfte ins Land zu holen. Die meisten der so genannten Gastarbeiter planten für ein paar Jahre im fremden Deutschland zu arbeiten, um dann wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Doch ein Großteil der Einwanderer blieb. Auch wenn immer wieder Diskussionen über mangelnde Integration und Parallelgesellschaften aufkommen, wurde Deutschland zur Heimat für viele dieser Einwanderer und noch mehr für die Deutschtürken der zweiten und dritten Generation, die bereits in Deutschland geboren wurden. Und so sind in allen alltäglichen sowie kulturellen Bereichen die Einflüsse türkischer Einwanderer und deren Nachkommen zu finden. Sei es in der Esskultur oder seien es türkischstämmige Schriftsteller wie Feridun Zaimoglu oder deutsch-türkische Filmemacher wie Fatih Akin, dessen Film „Gegen die Wand“ bei der Berlinale 2004 mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde.
Diese 50 Jahre bedeuten auch fünf Jahrzehnte des Miteinanders und ebenso fünf Jahrzehnte der Bilder dieses Miteinanders. Die ersten Versuche, filmisch mit den Einwanderern umzugehen, waren häufig von der Darstellung des Gastarbeiters als Opfer des Industriekapitalismus oder auch von Klischees, wie der unterdrückten türkischen Frau, bestimmt. Der Versuch des Zusammenlebens ist in diesen Filmen fast immer zum Scheitern verurteilt. Hier stellen noch vorwiegend deutsche Filmemacher, wie Fassbinder, eine Art Sprachrohr für eine gesellschaftliche Randgruppe dar, die über keine Lobby verfügte.
In den 1990er Jahren übernahm die Generation der in Deutschland geborenen Einwandererkinder zunehmend selbst Regie. Zu dieser Generation gehören Filmemacher wie Thomas Arslan, Filippos Tsitos und eben Fatih Akin.
Das Thema Migration spielt zwar immer noch eine mal größere mal weniger große Rolle, doch stellt das Leben zwischen den Kulturen für diese Generation kein Problem mehr dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Dazwischen daheim
- Migration und Identität
- Kurzer geschichtlicher Überblick der Einwanderung im Rahmen der Anwerbeabkommen
- Migration und Kino in Deutschland
- Türkenbild aus Deutschensicht
- Vom Gastarbeiterkino zum deutsch-türkischen Kino der Gegenwart
- Filmanalyse „Gegen die Wand“ (Fatih Akin, 2004)
- Der Regisseur Fatih Akin
- Filmdaten
- Filmanalyse
- Inhaltsanalyse
- Figurenanalyse
- Sibel
- Cahit
- Sibels Bruder Yilmaz
- Normen- und Werteanalyse
- Filmästhetische Aspekte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung interkultureller Differenz im deutschen Migrantenkino am Beispiel von Fatih Akins Film „Gegen die Wand“. Sie untersucht, wie die Thematik der Migration und Identität im Film dargestellt wird und welche Bedeutung sie für die Entwicklung des deutsch-türkischen Kinos hat.
- Die Rolle der Migration im deutschen Kino
- Die Darstellung von interkulturellen Differenzen im Film
- Die Entwicklung des deutsch-türkischen Kinos
- Die filmische Analyse von „Gegen die Wand“
- Die Bedeutung des Films für die deutsche Filmlandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt in die Thematik der Migration und Identität im deutschen Kino ein. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Thema der Migration und Identität im Allgemeinen, wobei ein historischer Überblick über die Einwanderung im Rahmen der Anwerbeabkommen gegeben wird. Das dritte Kapitel analysiert die Entwicklung des deutschen Migrantenkinos, insbesondere die Darstellung des Türkenbildes aus deutscher Sicht. Der Schwerpunkt des vierten Kapitels liegt auf der Filmanalyse von „Gegen die Wand“, wobei die Inhaltsanalyse, die Figurenanalyse, die Normen- und Werteanalyse sowie die filmästhetischen Aspekte im Detail betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Migration, Identität, interkulturelle Differenz, deutsch-türkisches Kino, Filmanalyse und „Gegen die Wand“. Dabei werden Themen wie die Darstellung des Türkenbildes in deutschen Filmen, die Entwicklung des deutsch-türkischen Kinos und die filmische Inszenierung von interkulturellen Konflikten untersucht.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Film „Gegen die Wand“ von Fatih Akin?
Der Film thematisiert das Leben von zwei Deutschtürken, Sibel und Cahit, die versuchen, aus ihren familiären und kulturellen Zwängen auszubrechen, und dabei zwischen den Kulturen schwanken.
Was ist das Besondere am deutsch-türkischen Kino der Gegenwart?
Es wird zunehmend von Regisseuren der zweiten und dritten Generation geprägt, für die das Leben zwischen den Kulturen kein reines „Opfer-Thema“ mehr ist, sondern eine facettenreiche Identitätsgrundlage.
Wie hat sich das Bild der Türken im deutschen Film gewandelt?
Früher dominierten Klischees vom Gastarbeiter als Opfer oder der unterdrückten Frau. Heute zeigen Filmemacher wie Fatih Akin komplexere, individuellere Charaktere jenseits dieser Stereotypen.
Welche Rolle spielt die Musik in „Gegen die Wand“?
Die Arbeit analysiert filmästhetische Aspekte, wobei die Musik oft als emotionales Bindeglied zwischen den türkischen Wurzeln und der deutschen Realität fungiert.
Was bedeutet der Titel „Dazwischen daheim“?
Er beschreibt das Lebensgefühl vieler Migranten, die weder in der Türkei noch in Deutschland vollständig „fremd“ sind, sondern ihre Heimat in der hybriden Identität dazwischen finden.
- Quote paper
- Sandro Abbate (Author), 2011, Dazwischen daheim - Interkulturelle Differenz im deutschen Migrantenkino am Beispiel von Fatih Akins „Gegen die Wand“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189669