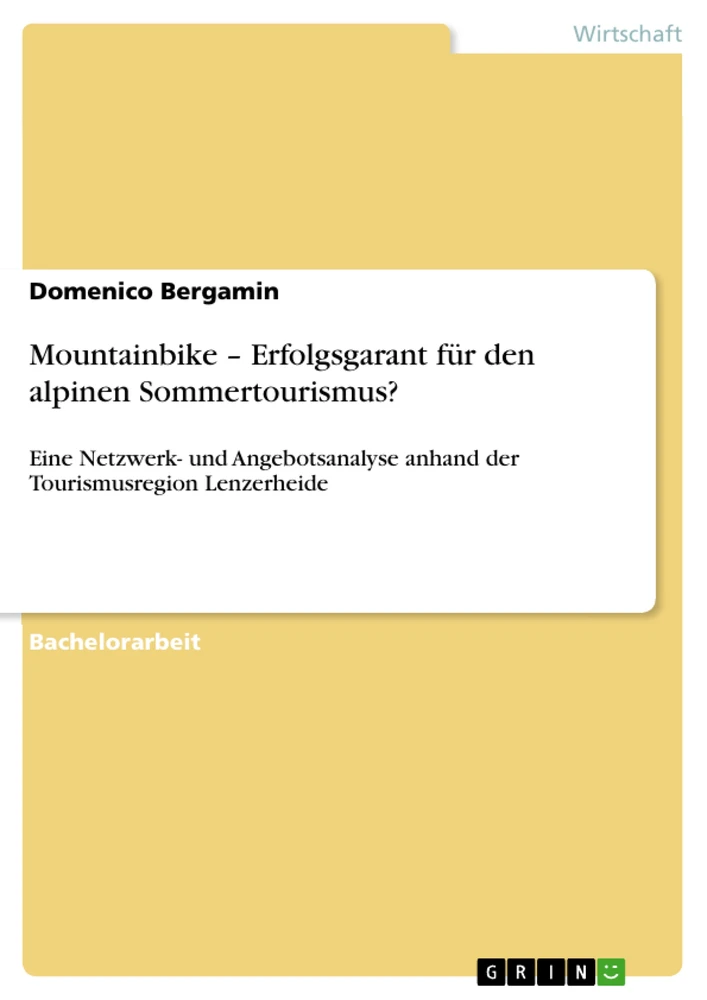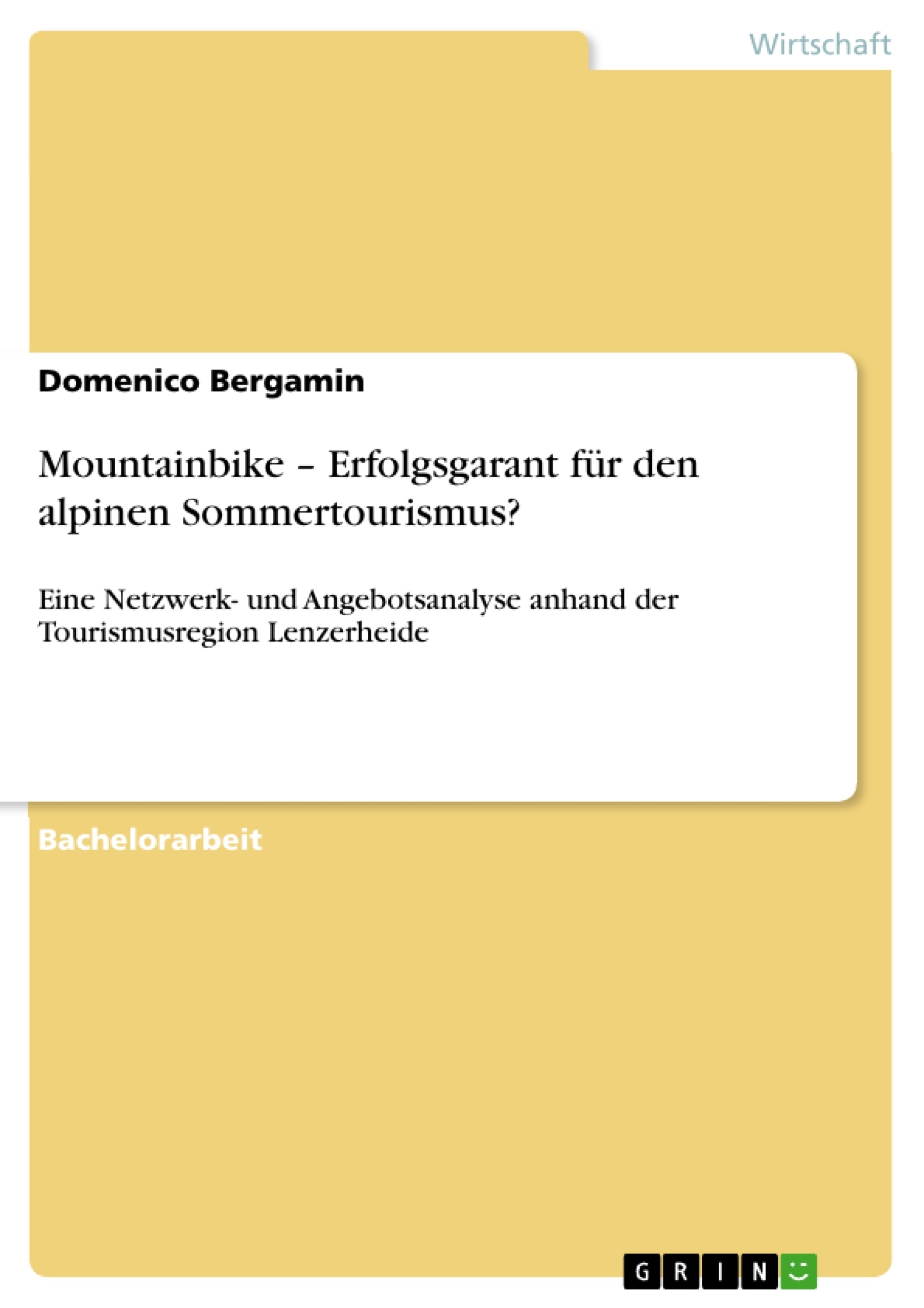Alpine Tourismusdestinationen, die im Sommer eher einem Geisterdorf gleichen, gehören in der Schweiz seit Jahren zum normalen Erscheinungsbild. Abgesehen von wenigen Wochen während der sommerlichen Hauptsaison, in denen Wanderer, Familien und andere Erholungssuchende für ein paar Tage Ferien machen, steht das Leben, in den während den Wintermonaten pulsierenden Regionen, praktisch still. Da in Bergregionen ein Grossteil der Bevölkerung vom Tourismus lebt, wird seit langem nach Alternativen gesucht, die es ermöglichen, einen funktionierenden und ausgelasteten alpinen Sommertourismus aufzuziehen. Mit dem Mountainbiking wurde eine solche mögliche Alternative identifiziert und es wird grosse Hoffnung in diese Sportart gesteckt. Grund dafür sind hauptsächlich die stetig steigende Anhängerschaft der Mountainbiker sowie einige erfolgreiche Praxisbeispiele aus verschiedenen Regionen der Welt.
Um den Mountainbike-Tourismus erfolgreich zu implementieren, müssen von der Destination und deren Leistungsträgern einige spezifische Angebote bereitgestellt werden, welche von Mountainbikern gefordert werden. Als besonders wichtig gelten abwechslungsreiche und grosse Wegenetze, Bike-Hotels mit besonderen, auf Mountainbiker abgestimmten Angeboten, spezielle gastronomische Angebote, Fachgeschäfte mit Reparaturwerkstatt und Fahrradverleih, Bike-Events sowie Bergbahntransport. Damit diese Angebote erfolgreich umgesetzt werden können, bzw. das touristische Gesamtpaket Anklang findet, müssen die verschiedenen Akteure in einer Kooperation zusammenfinden. In einem Netzwerk bearbeiten diese mittels verschiedener Marketingaktivitäten gemeinsam den Markt und stimmen ihre jeweiligen Produkte aufeinander ab, um einen möglichst grossen Kundennutzen zu generieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen von Tourismus und Netzwerken
- Begriffsbestimmung Tourismus
- Alpiner Sporttourismus
- Was sind Netzwerke?
- Regionale Touristische Netzwerke
- Zusammenfassung der Theoretischen Grundlagen
- Entwicklung der Mountainbike-Industrie
- Entstehungsgeschichte des Mountainbikes und dessen Typen
- Warum Mountainbike?
- Ökonomische Bedeutung des Mountainbike-Tourismus
- Fallbeispiel Moab
- Fallbeispiel Leogang
- Empirische Untersuchung
- Analyse des Mountainbike-Tourismus Netzwerk-Konzepts
- Motive der Mountainbiker
- Ansprüche der Mountainbiker an ihre Feriendestination
- Mountainbike-Tourismus-Netzwerk
- Analyse des Mountainbike-Tourismus-Netzwerks in Lenzeheride
- Tourismusregion Lenzerheide
- Mountainbike-Konzept Lenzerheide
- Identifikation der Akteure in Lenzerheide und ihre Vernetzung
- Mountainbike Angebote in Lenzerheide
- Zusammenfassung der empirischen Untersuchung
- Analyse des Mountainbike-Tourismus Netzwerk-Konzepts
- Zusammenfassung, Diskussion und Ausblick
- Zusammenfassung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Mountainbiking ein Erfolgsgarant für den alpinen Sommertourismus sein kann. Anhand der Tourismusregion Lenzerheide wird untersucht, ob das Angebot an Mountainbike-Touren und -Dienstleistungen ausreichend ist und welche Rolle die Vernetzung der verschiedenen Akteure im Tourismus spielt. Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen des Tourismus und der Netzwerktheorie sowie die Entwicklung der Mountainbike-Industrie. In der empirischen Untersuchung werden die Motive und Ansprüche der Mountainbiker sowie die vorhandene Mountainbike-Infrastruktur und -Angebote in Lenzerheide analysiert.
- Entwicklung des Mountainbike-Tourismus
- Netzwerktheorie im Tourismus
- Mountainbike-Angebote und -Infrastruktur
- Kooperation und Vernetzung der Akteure
- Potenzial des Mountainbiking für den alpinen Sommertourismus
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in die Thematik des Mountainbiking als Erfolgsgarant für den alpinen Sommertourismus ein. Es stellt die Problematik des saisonalen Tourismus in den Alpen sowie die steigende Bedeutung des Mountainbiking als touristische Alternative dar.
Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Tourismus und der Netzwerktheorie. Es definiert den Begriff Tourismus und betrachtet dessen spezifische Ausprägung im alpinen Sporttourismus. Die Bedeutung von Netzwerken in der Tourismusbranche wird erläutert und die Rolle regionaler touristischer Netzwerke wird hervorgehoben.
Kapitel 3 befasst sich mit der Entwicklung der Mountainbike-Industrie. Die Entstehungsgeschichte des Mountainbikes und die verschiedenen Bike-Typen werden vorgestellt. Die ökonomische Bedeutung des Mountainbike-Tourismus wird erläutert und anhand der Fallbeispiele Moab und Leogang veranschaulicht.
Im vierten Kapitel wird die empirische Untersuchung durchgeführt. Die Analyse des Mountainbike-Tourismus Netzwerk-Konzepts umfasst die Motivation und Ansprüche der Mountainbiker sowie die Struktur des Mountainbike-Tourismus-Netzwerks. Im Anschluss daran wird das Mountainbike-Tourismus-Netzwerk in Lenzerheide analysiert. Es werden die Akteure und ihre Vernetzung, die Angebote sowie die vorhandene Infrastruktur untersucht.
Schlüsselwörter
Mountainbike-Tourismus, alpiner Sommertourismus, Netzwerktheorie, Tourismusregion Lenzerheide, Akteure im Tourismus, Mountainbike-Angebote, Kooperation, Vernetzung, Nachhaltigkeit, Wettbewerbsvorteil.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Mountainbiking für den alpinen Sommertourismus so wichtig?
In den Sommermonaten stehen viele Wintersportregionen leer. Mountainbiking gilt als wachstumsstarke Alternative, um diese Regionen auch im Sommer auszulasten.
Welche Infrastruktur benötigen Mountainbiker in einer Destination?
Wichtig sind ein großes Wegenetz, spezialisierte Bike-Hotels, Werkstätten, Verleihstationen, Bike-Events und der Transport durch Bergbahnen.
Was wurde in der Region Lenzerheide speziell untersucht?
Die Arbeit analysiert das Mountainbike-Konzept der Region, die Vernetzung der Akteure und ob die vorhandenen Angebote den Ansprüchen der Zielgruppe genügen.
Warum spielt die Netzwerktheorie im Tourismus eine Rolle?
Nur durch die Kooperation verschiedener Akteure (Hotels, Bahnen, Shops) kann ein wettbewerbsfähiges Gesamtpaket geschnürt werden, das den Kundennutzen maximiert.
Welche Fallbeispiele für erfolgreichen Bike-Tourismus werden genannt?
Die Arbeit zieht Vergleiche zu erfolgreichen Regionen wie Moab (USA) und Leogang (Österreich).
- Citation du texte
- Domenico Bergamin (Auteur), 2009, Mountainbike – Erfolgsgarant für den alpinen Sommertourismus?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189769