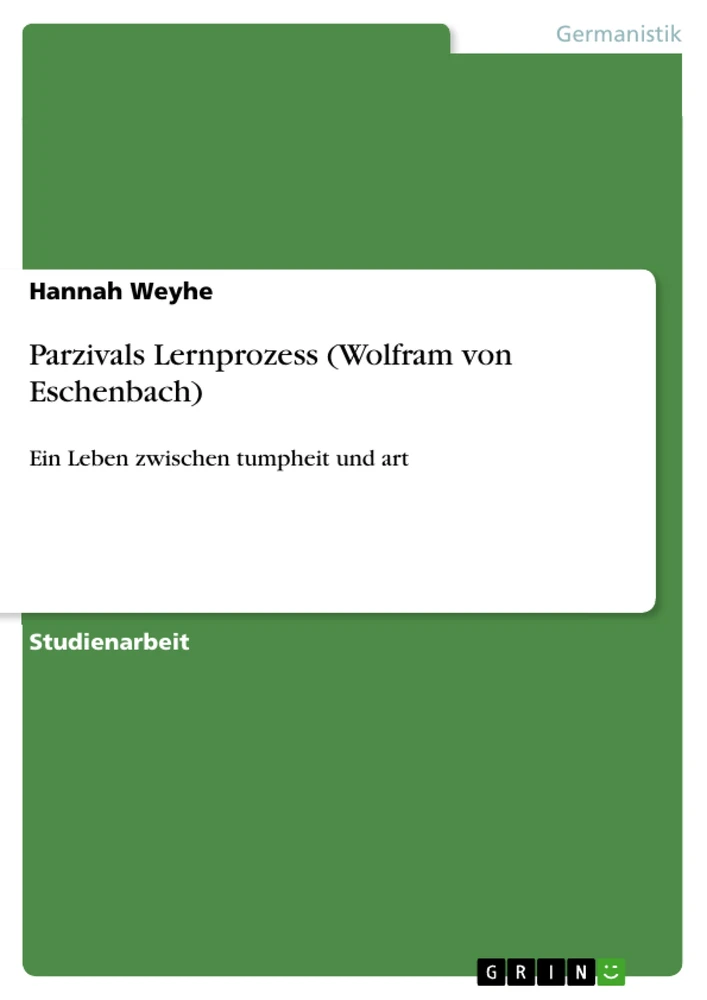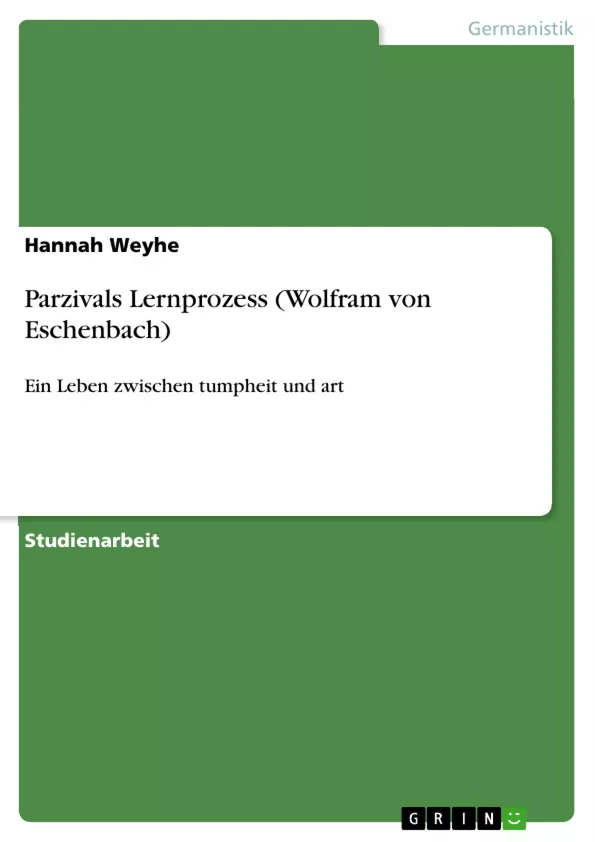Einleitung
1.Die Kindheit Parzivals in Soltane und die Lehren Herzeloydes
1.1Ein Leben für den Einen: Herzeloyde als Mutter und Witwe
1.2 Parzivals Kindheit in Soltane
2. Parzivals Aufbruch in die Welt
3. Die Ritterlehre bei Gurnemanz
Fazit
Literaturverzeichnis
Der mittelhochdeutsche Versroman „Parzival“ von Wolfram von Eschen-bach, bestehend aus 24810 Versen, eingeteilt in 16 Bücher, zählt zu den bekanntesten Artus-Gral-Romanen.
Die folgende Hausarbeit widmet sich dem Lernprozess des Titelhelden. Dieser lässt sich grob in drei Stufen einteilen. Zuerst seine Kindheit in Soltane und die Lehren seiner Mutter Herzeloyde, anschließend die ritterli-che Belehrung in Theorie und Praxis von Gurnemanz und zuletzt die religi-öse Unterweisung bei Trevrizent.
Im Folgenden werden hauptsächlich die ersten beiden Stufen genauer be-trachtet und auf ihren Lehr- und Lerninhalt untersucht, sowie auf deren Auswirkungen auf Parzivals Lernprozess. Somit widmet sich die Hausarbeit dem III. Buch Wolframs von Eschenbach. Augenmerk ist dabei ebenfalls, in welchen Handlungs- und Charakterzügen sich Parzivals ritterliche art gegen seine tumpheit durchsetzt.
Das erste Kapitel der Hausarbeit thematisiert, entsprechend den Stufen des Lernprozesses, Parzivals Kindheit in Soltane und den Lehren Herzeloydes. Um deren Beweggründe zu einer solch ungewöhnlichen Erziehung besser begreifen zu können, wird im ersten Unterkapitel Herzeloydes Vorgeschich-te als Frau Gahmurets und schwangere Witwe genauer beleuchtet. Im zwei-ten Unterkapitel soll Parzivals Kindheit in Soltane beschrieben und der Fra-ge nachgegangen werden, ob und durch welche Ratschläge Herzeloydes Erziehung Grund für dessen tumpheit ist. Gleichzeitig wird aufgezeigt, durch welches Denken, Handeln und welche Aussagen Parzivals vererbte ritterliche art zum Vorschein kommt.
Die Auswirkungen der mütterlichen Lehren zeigen sich auch weiterhin im Abschnitt, der im zweiten Kapitel behandelt werden soll: der Weg Parzivals von Soltane bis zu Gurnemanz. Hier stellt sich die Frage, ob viele der Ver-gehen und Verfehlungen seine Schuld sind oder sich auf Herzeloyde und das aus ihrer Erziehung resultierende kindliche Gemüt Parzivals zurückfüh-ren lassen.
Das dritte Kapitel untersucht abschließend die Ritterlehre Gurnemanz da-hingehend, an welchen Stellen auch diese Unterweisung Lücken aufweist und welche bis dahin bestehenden Wissenslücken sie füllt
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Kindheit Parzivals in Soltane und die Lehren Herzeloydes
- 1.1 Ein Leben für den Einen: Herzeloyde als Mutter und Witwe
- 1.2 Parzivals Kindheit in Soltane
- 2. Parzivals Aufbruch in die Welt
- 3. Die Ritterlehre bei Gurnemanz
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Lernprozess des Titelhelden Parzival im mittelhochdeutschen Versroman „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach. Dabei werden die drei Phasen seiner Entwicklung beleuchtet: zunächst seine Kindheit in Soltane und die Lehren seiner Mutter Herzeloyde, anschließend die ritterliche Belehrung bei Gurnemanz und schließlich die religiöse Unterweisung bei Trevrizent. Im Fokus stehen die ersten beiden Phasen, wobei untersucht wird, welche Lehren Parzival erhält, wie er diese aufnimmt und welche Auswirkungen sie auf seinen Lernprozess haben. Die Arbeit analysiert auch, wie sich Parzivals ritterliche Art gegen seine Tumpheit durchsetzt.
- Parzivals Entwicklung von der Kindheit bis zur Ritterlehre
- Die Rolle der Mutter Herzeloyde in Parzivals Erziehung und ihre Auswirkungen auf seine Entwicklung
- Der Einfluss der ritterlichen Lehren Gurnemanz' auf Parzivals Lernen
- Der Konflikt zwischen Parzivals Tumpheit und seiner ritterlichen Art
- Die Bedeutung von Parzivals Erfahrungen für seine Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet Parzivals Kindheit in Soltane und die Lehren seiner Mutter Herzeloyde. Es wird analysiert, wie Herzeloydes eigene Geschichte als Frau Gahmurets und schwangere Witwe ihre Erziehung ihres Sohnes beeinflusst. Dabei werden die Auswirkungen von Herzeloydes Lehren auf Parzivals Tumpheit und die Herausforderungen, die sich daraus für seine Entwicklung ergeben, untersucht. Des Weiteren wird gezeigt, wie sich Parzivals vererbte ritterliche Art in seinem Denken, Handeln und seinen Aussagen zeigt.
Das zweite Kapitel analysiert Parzivals Aufbruch von Soltane bis zu Gurnemanz. Es wird untersucht, inwieweit seine Fehler und Irrtümer auf seine eigene Schuld zurückzuführen sind oder ob sie auf die von Herzeloyde vermittelte Erziehung und Parzivals kindliches Gemüt zurückzuführen sind.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Ritterlehre Gurnemanz. Es wird untersucht, an welchen Stellen auch diese Unterweisung Lücken aufweist und welche bis dahin bestehenden Wissenslücken sie füllt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Parzivals Lernprozess, Ritterkultur, Tumpheit, ritterliche Art, Mutter-Sohn-Beziehung, Erziehung, Einfluss der Umwelt auf die Entwicklung, Herzeloyde, Gahmuret, Gurnemanz, mittelalterlicher Versroman, Artus-Gral-Roman, Wolfram von Eschenbach.
Häufig gestellte Fragen
Wer schrieb den Versroman 'Parzival'?
Das Werk stammt von Wolfram von Eschenbach und ist einer der bedeutendsten Artus-Gral-Romane des Mittelalters.
In welche Stufen lässt sich Parzivals Lernprozess einteilen?
Der Prozess umfasst drei Stufen: Die mütterliche Erziehung in Soltane, die ritterliche Lehre bei Gurnemanz und die religiöse Unterweisung bei Trevrizent.
Warum erzog Herzeloyde Parzival in der Einöde von Soltane?
Nach dem Tod ihres Mannes Gahmuret wollte sie ihren Sohn vor den Gefahren des Rittertums schützen und ihn in Unwissenheit darüber aufwachsen lassen.
Was bedeutet 'tumpheit' im Kontext von Parzival?
'Tumpheit' bezeichnet Parzivals anfängliche Torheit, Unwissenheit und mangelnde Lebenserfahrung, die oft zu Fehlern und Verfehlungen führt.
Welche Rolle spielt Gurnemanz in Parzivals Entwicklung?
Gurnemanz vermittelt Parzival die ritterlichen Tugenden und Verhaltensregeln in Theorie und Praxis, füllt aber nicht alle seine Wissenslücken.
Setzt sich Parzivals ritterliche Art gegen seine Tumpheit durch?
Ja, die Arbeit untersucht, wie seine vererbte ritterliche Natur trotz der mangelhaften Erziehung in seinen Handlungen und seinem Charakter zum Vorschein kommt.
- Quote paper
- Hannah Weyhe (Author), 2011, Parzivals Lernprozess (Wolfram von Eschenbach), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189889