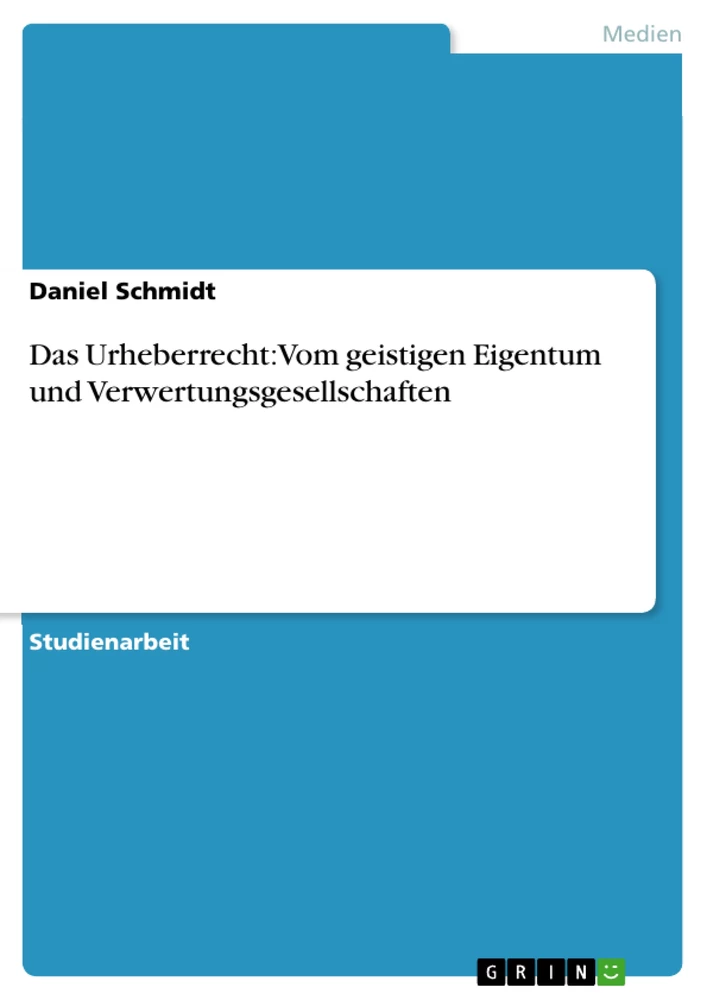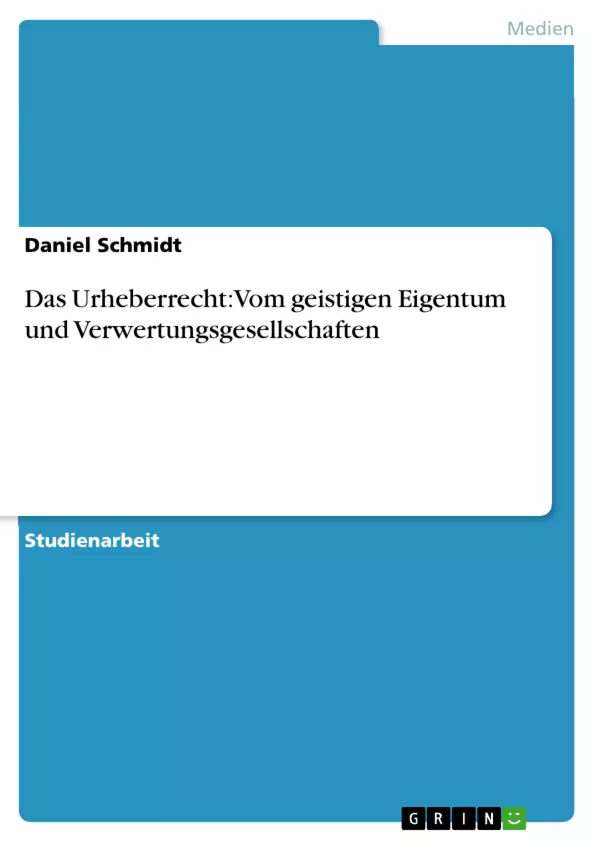Das Recht für geistiges Eigentum oder auch Urheberrecht bildete sich zwischen Spätmittelalter und dem Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa. In der Antike bis zum Hochmittelalter existierte kein Schutz für geistiges Eigentum, sondern vielmehr Regelungen für Sachbesitz als Eigentum (vgl. Schickert 2005 : 52), jedoch war der Begriff bereits bekannt. Wichtige Werke wurden in der Antike ununterbrochen von Mönchen von Hand kopiert, in verschiedene Sprachen übersetzt und somit ohne Einwilligung des Urhebers vervielfältigt. Lediglich das Stehlen oder Zerstören von Besitzgegenständen wurde bestraft. Der Urheber eines Buches konnte sich allerdings mit Flüchen vor ungewollten Kopien schützen. So schreibt Markus Junker, dass „Eike Repgow im Sachsenspiegel denjenigen, die sein Werk verfälschten“ (Junker 2002), schriftlich mit „Aussatz und Hölle“ drohte. Das Wort Plagiat stammt von dem lateinischen Wort plagium ab und bedeutet „die Entführung freier Menschen in die Sklaverei“ (Schickert 2005 : 69). Marcus Valerius Martialis prägte diesen Begriff, da er diesen mir einer Person namens Fidentius in Verbindung brachte, der Martials Gedichte unter eigenem Namen vorlas und somit diese bildlich gesehen versklavte.
Inhaltsverzeichnis
- Die Geschichte des Urheberrechts
- Antike bis Spätmittelalter
- Spätmittelalter
- 18. bis 19. Jahrhundert
- 20. Jahrhundert
- 21. Jahrhundert
- Der Inhalt des Urheberrechtsgesetzes (UrhG)
- Das Werk
- Der Urheber
- Urheberpersönlichkeitsrecht und Verwertungsrechte
- Folgerecht (§ 26)
- Vergütungsrechte für Vermietung und Verleihen (§ 27)
- Einschränkungen des Urheberrechts (Schrankenbestimmungen)
- Urheberrechtsverletzung
- Zivilrechtliche Folgen (vom Verletzten erwirkt)
- Strafrechtliche Folgen (vom Staat verfolgt)
- Urheberrecht und Copyright
- Begriffsklärung und digitale Methoden zur Wahrung des Urheberrechts
- Verwertungsgesellschaften
- Definition
- Geschichte der Verwertungsgesellschaften
- Die GEMA
- Geschichte der GEMA
- Interner Aufbau
- Mitgliedschaften
- Ausschüttungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Geschichte, dem Inhalt und der Anwendung des Urheberrechts im Kontext von geistigem Eigentum. Sie beleuchtet die Entwicklung des Urheberrechts von der Antike bis zum 21. Jahrhundert und analysiert das Urheberrechtsgesetz (UrhG) im Detail. Darüber hinaus werden Verwertungsgesellschaften, insbesondere die GEMA, als wichtige Akteure im Urheberrechtsbereich vorgestellt.
- Entwicklung des Urheberrechts
- Inhalt und Schutz des Urheberrechts
- Digital Rights Management (DRM) und Netlabels
- Funktion und Bedeutung von Verwertungsgesellschaften
- Beispielhafte Anwendung des Urheberrechts in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Geschichte des Urheberrechts: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Urheberrechts von der Antike bis zum 21. Jahrhundert. Dabei werden wichtige Meilensteine wie die Erfindung des Buchdrucks, die Einführung von Privilegien und die Entstehung des modernen Urheberrechtskonzepts dargestellt.
- Der Inhalt des Urheberrechtsgesetzes (UrhG): Das Kapitel behandelt die zentralen Inhalte des UrhG, darunter die Definition von Werk und Urheber, die Unterscheidung zwischen Urheberpersönlichkeitsrecht und Verwertungsrechten sowie die Schrankenbestimmungen des Urheberrechts.
- Begriffsklärung und digitale Methoden zur Wahrung des Urheberrechts: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Begriffen wie „Digital Rights Management“ (DRM) und „Netlabels“ und erklärt deren Bedeutung im Kontext des Urheberrechts im digitalen Zeitalter.
- Verwertungsgesellschaften: Das Kapitel gibt eine allgemeine Einführung in Verwertungsgesellschaften und deren Bedeutung für die Durchsetzung des Urheberrechts. Es beleuchtet die Geschichte dieser Organisationen und ihre Funktionsweise.
- Die GEMA: Dieses Kapitel widmet sich der GEMA als einer der wichtigsten Verwertungsgesellschaften weltweit. Es beschreibt die Geschichte, den internen Aufbau, die Mitgliedschaften und die Ausschüttungsmechanismen der GEMA.
Schlüsselwörter
Urheberrecht, geistiges Eigentum, Verwertungsgesellschaften, GEMA, Digital Rights Management (DRM), Netlabels, Werk, Urheber, Urheberpersönlichkeitsrecht, Verwertungsrechte, Schrankenbestimmungen, Urheberrechtsverletzung, Copyright, Geschichte, Entwicklung, Anwendung.
Häufig gestellte Fragen
Seit wann gibt es Schutz für geistiges Eigentum?
Während in der Antike nur Sachbesitz geschützt war, entwickelte sich das moderne Urheberrecht in Europa zwischen dem Spätmittelalter und dem 19. Jahrhundert.
Was ist der Unterschied zwischen Urheberrecht und Copyright?
Das deutsche Urheberrecht schützt die persönliche Beziehung des Urhebers zu seinem Werk, während das angelsächsische Copyright eher die ökonomische Verwertung fokussiert.
Welche Aufgaben übernimmt die GEMA?
Die GEMA verwaltet als Verwertungsgesellschaft die Nutzungsrechte von Musikschaffenden und sorgt für die Ausschüttung von Vergütungen bei öffentlicher Wiedergabe.
Was sind 'Schrankenbestimmungen' im Urheberrecht?
Das sind gesetzliche Ausnahmen, die die Nutzung geschützter Werke ohne Erlaubnis erlauben, etwa für Zitate, Bildung oder den Privatgebrauch.
Wie wird das Urheberrecht im digitalen Zeitalter geschützt?
Zum Einsatz kommen Methoden wie das Digital Rights Management (DRM), um unerlaubte Vervielfältigungen im Internet zu verhindern.
- Arbeit zitieren
- Daniel Schmidt (Autor:in), 2011, Das Urheberrecht: Vom geistigen Eigentum und Verwertungsgesellschaften, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189916