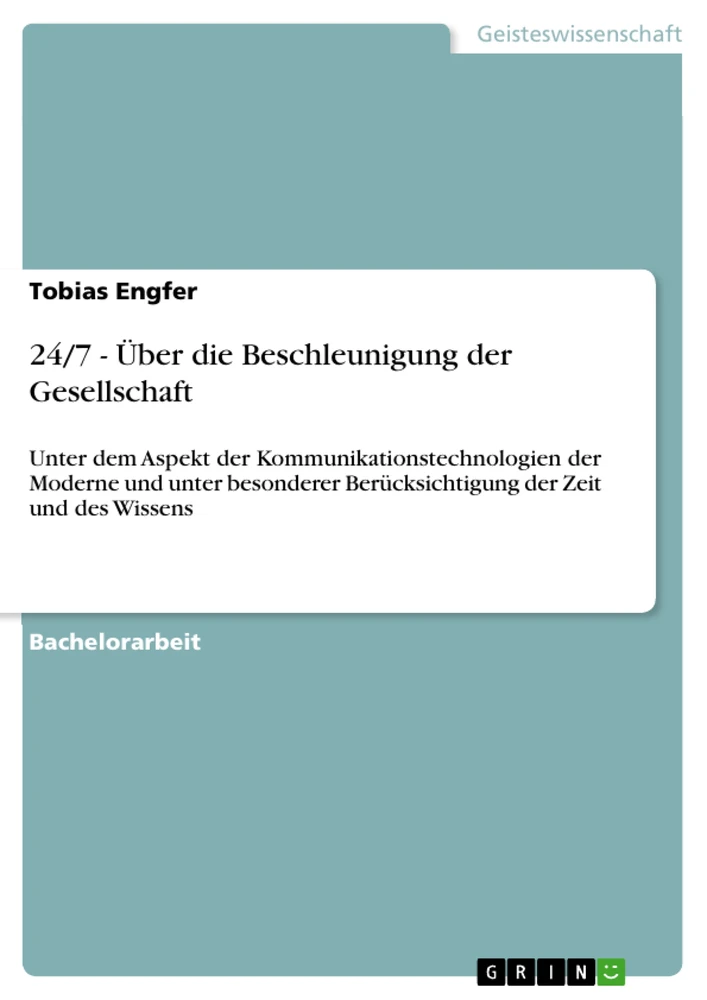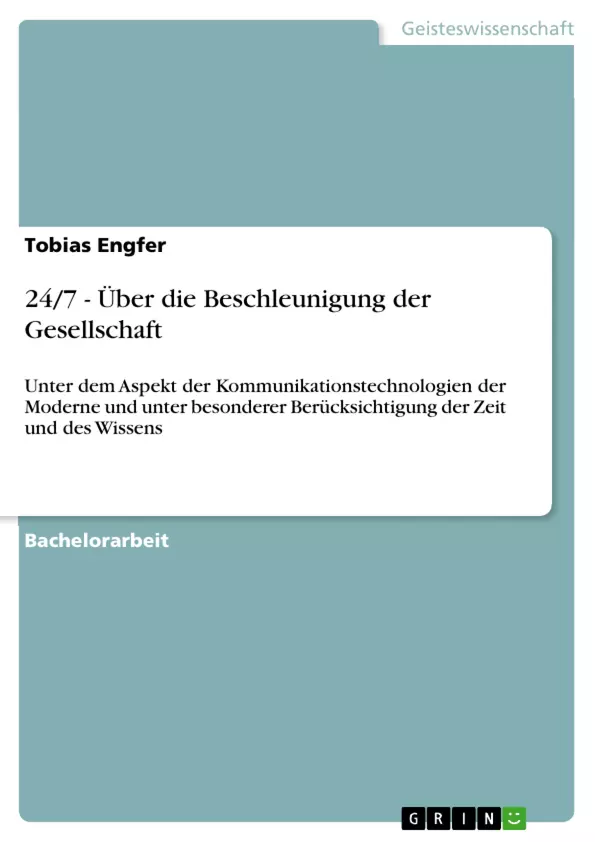Jeder ist immer erreichbar. Die ganze Welt beschleunigt sich, alles ist dringend, und wo alles dringend ist, ist nichts mehr dringend, und damit schlittern wir in eine Bedeutungslosigkeit hinein.
Joseph Weizenbaum, 2004
Obgleich emeritierter Professor des Computer Departments am MIT, ist er auch ein scharfer Kritiker der Computer- und Technologiegläubigkeit. Ein Bestreben dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen dass jeder immer erreichbar ist. Doch die Intention ist eine grundlegend andere. Beschleunigung fördert die Dringlichkeit, aber diese wird nicht zum Selbstzweck und gerät somit auch nicht in die Bedeutungslosigkeit. Gerade in unserer heutigen Zeit, dem 21. Jahrhundert und unter dem Aspekt, dass die Technik sich förmlich jeden Tag selbst überholt, ist der Mensch gefordert persönliche Grenzen zu ziehen. Es kann dabei nicht um eine solche negative Generalisierung wie bei Weizenbaum gehen. Der Mensch ist ein Individuum und als solches muss er auch handeln. „Wer gerade am meisten Gas gibt, ist vorn. Wir stehen immer auf Vollgas“ (Ferdinand Piëch, 1999). So wird es immer Personen geben, die diese Beschleunigung mittragen und solche die sie vollends ablehnen.
Diese Arbeit soll die positiven, sowie negativen Aspekte der Beschleunigung und im Besonderen der kommunikationstechnischen Akzeleration betrachten und ein ausdifferenziertes Bild zeichnen über die Bedeutungslosigkeit wie sie Weizenbaum nennt und über das Vollgas wie es Piëch bezeichnet.
Dafür beschäftigt sich der sich anschließende Abschnitt mit dem Begriff der Zeit. In dem Versuch einer Definition, werden die grundlegenden Aussagen von drei Disziplinen angeführt, nämlich der Physik, der Philosophie und der Soziologie. Damit soll die Begrifflichkeit Zeit klarer ausdifferenziert werden, um so einen exakteren Blick auf die akzelerierenden Vorgänge werfen zu können.
Der Abschnitt drei beschäftigt sich mit dem großen Gebiet des Wissens. So wird eingangs die Frage gestellt, was Wissen eigentlich ist. Danach wird in einem kurzen verlauf die Geschichte des Wissens in der Gesellschaft dargestellt. Dabei wird intensiver auf die Technisierung im 20. Jahrhundert eingegangen, als Vorreiter unser modernen Entwicklungen. Die Ausführungen über die Informations- und Wissensgesellschaft beenden diesen Abschnitt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Zeit?
- Physik
- Philosophie
- Soziologie
- Das Wissen um die Entwicklung
- Die Frage nach dem Wissen
- Wissen im Laufe der Zeit
- Technisierung im 20. Jahrhundert
- Informations- und Wissensgesellschaft
- Die technische Beschleunigung des Lebens
- Triebmotor Internet
- Kommunikation 2.0
- Soziale Netzwerke
- Blogs
- Smartphones
- Der Preis den wir zahlen
- Wider der Be- und Entschleunigung. Ein Plädoyer an die Vernunft
- Ein Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Beschleunigung der Gesellschaft im Kontext moderner Kommunikationstechnologien, insbesondere in Bezug auf Zeit und Wissen. Sie beleuchtet die Auswirkungen dieser Beschleunigung auf das menschliche Leben und die Notwendigkeit, persönliche Grenzen zu setzen.
- Die Bedeutung des Zeitbegriffs in der Physik, Philosophie und Soziologie
- Die Entwicklung von Wissen und die Rolle der Technisierung im 20. Jahrhundert
- Der Einfluss des Internets und der Kommunikation 2.0 auf die Gesellschaft
- Die positiven und negativen Aspekte der Beschleunigung und die Notwendigkeit eines ausgewogenen Blicks
- Ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft im Kontext technischer Fortschritte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die These auf, dass die heutige Gesellschaft durch die Beschleunigung geprägt ist, die durch moderne Kommunikationstechnologien vorangetrieben wird. Sie beleuchtet die ambivalente Bedeutung dieser Entwicklung und strebt danach, ein ausgewogenes Bild zu zeichnen.
- Was ist Zeit?: Dieser Abschnitt analysiert den Zeitbegriff aus verschiedenen Perspektiven, insbesondere der Physik, Philosophie und Soziologie. Die Ausführungen sollen dazu beitragen, die Komplexität des Zeitbegriffs zu verdeutlichen und die Bedeutung der Zeit im Kontext der Beschleunigung zu verdeutlichen.
- Das Wissen um die Entwicklung: Dieser Abschnitt betrachtet die Entwicklung von Wissen in der Gesellschaft, wobei die Technisierung im 20. Jahrhundert als wichtiger Faktor hervorgehoben wird. Er setzt sich mit der Bedeutung von Wissen und Information in der modernen Gesellschaft auseinander.
- Die technische Beschleunigung des Lebens: Dieser Abschnitt analysiert den Einfluss des Internets und der Kommunikation 2.0 auf die Beschleunigung der Gesellschaft. Er beleuchtet verschiedene Aspekte der digitalen Kommunikation, darunter E-Mail, soziale Netzwerke, Blogs und Smartphones, sowie die Auswirkungen dieser Entwicklungen.
- Wider der Be- und Entschleunigung. Ein Plädoyer an die Vernunft: Dieser Abschnitt argumentiert für die Notwendigkeit einer positiven Sicht auf die Beschleunigung. Er betont die Chancen, die die technische Entwicklung bietet, und plädiert für eine bewusste Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Beschleunigung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Beschleunigung, Zeit, Wissen, Kommunikationstechnologien, Internet, Kommunikation 2.0, soziale Netzwerke, Smartphones, und die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum beschleunigt sich unsere Gesellschaft immer mehr?
Haupttreiber sind die rasanten Fortschritte in der Kommunikationstechnologie (Internet, Smartphones), die eine ständige Erreichbarkeit und schnellere Informationsverarbeitung ermöglichen.
Was versteht man unter „Kommunikation 2.0“?
Dazu gehören soziale Netzwerke, Blogs und Instant Messaging, die den Austausch von Informationen in Echtzeit und über globale Distanzen hinweg erlauben.
Welchen Preis zahlen wir für die ständige Erreichbarkeit?
Mögliche Folgen sind Stress, der Verlust von Erholungsphasen und eine gefühlte Bedeutungslosigkeit von Informationen, da alles als „dringend“ wahrgenommen wird.
Wie definieren Physik und Soziologie den Begriff Zeit unterschiedlich?
Während die Physik Zeit als messbare Dimension betrachtet, untersucht die Soziologie, wie Menschen Zeit erleben und wie gesellschaftliche Strukturen das Zeitempfinden prägen.
Ist Beschleunigung nur negativ zu bewerten?
Nein, sie bietet auch Chancen für Effizienz und Wissenszuwachs. Entscheidend ist die Fähigkeit des Individuums, persönliche Grenzen zu ziehen und Vernunft walten zu lassen.
- Quote paper
- Tobias Engfer (Author), 2011, 24/7 - Über die Beschleunigung der Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189931